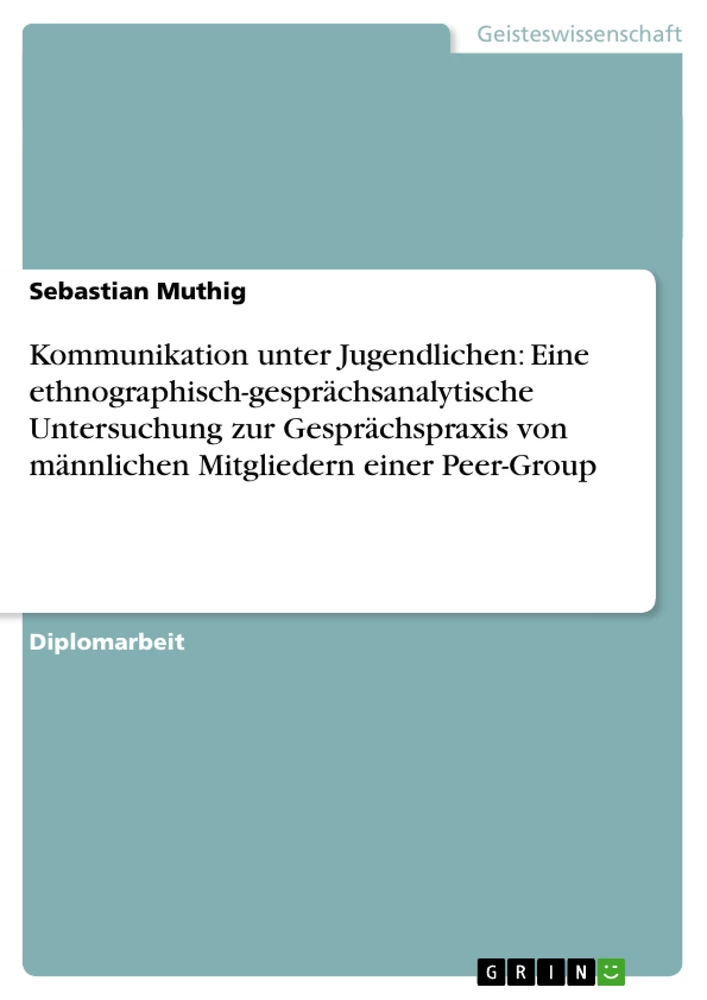Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem alltagsweltlichen Phänomen intentionalitätsdiskursiver Kommunikationspraxis und fokussiert v.a. auf motiventlarvende Sprachspiele, als integralem Bestandteil im kommunikativen Haushalt (Luckmann 1986) einer bestimmten lebensstilistischen Kommunikationsgemeinschaft. Als sprachlicher Ausdruck der Kommunikationskultur einer männlichen Peer-Group, beschreibt der empirische Gegenstand dieser Untersuchung die genuinste Form sozialer Interaktion: informelle, i.e. aufgabenentbundene und nicht institutionalisierte Konversation unter Adoleszenten. Das analytische Erkenntnisinteresse gilt den vielfältigen lebensweltlichen Kommunikationsstrategien, durch welche Akteure1 Handlungsabsichten und –ziele thematisieren, problematisieren und verhandeln. Intentionalität emergiert nicht als handlungsprimordialer oder transzendentaler Wert, sondern vielmehr als dynamische und gemeinschaftlich konstruierte/-bare Größe von spezifisch pragmatischer Relevanz. D.h. die Sinnhaftigkeit sozialen Handelns wird erst durch einen sozialen Ratifikationsprozess konstituiert und Sprechhandlungen nachträglich als bedeutungsvoll ausgewiesen. Im Zuge dessen findet ein Wettstreit um die definitorische Hoheit über explizit artikulierte Wirklichkeitskonzeptionen und inhärente Identitätsansprüche statt. Die Deutungsmacht über intentionale Handlungsbegründung repräsentiert hierbei eine mächtige Ressource zur Askription lokaler Identitäten. Soziale Handlung wird dabei als genuine Manifestation respektive als Indikator für lokale Identität veranschlagt (Coulter 1989). Das Anliegen dieser Arbeit gilt letztendlich der Synthetisierung formallogischer Strukturmerkmale, sowie soziologisch relevanter Funktionalitäten intentionalitätsdiskursiver Sprachpraxis. Dabei müssen die Eigenarten adoleszenter Gesprächspraxis berücksichtigt werden, welche es schlichtweg verunmöglichen den Maßstab idealisierter Diskurstheorien (i.e. Habermas 1981; Searle 1996) anzulegen. Eine analytische Annäherung an das Phänomen intentionalitätsdiskursiver Praxis ist nur durch eine Analyse konkreter Kommunikationspraxis möglich. Aus diesem Grunde ist diese Forschungsarbeit empirisch konzeptualisiert und bedient sich der Ethnographischen Gesprächsanalyse (Deppermann 1999) als hermeneutischem Analyseinstrument.
...
Inhaltsverzeichnis
-
-
- Begriffsbestimmung und Entwicklungsgeschichte
- Die,,Ethno-Methoden“ der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit
-
- Begriffsbestimmung und Entwicklungsgeschichte
- Die Ethnomethodologische Grundhaltung der Konversationsanalyse
- Die Indexikalität und sequentielle Implikativität von Darstellungen („accounts“)
- Analytisches Interesse und methodische Prinzipien
-
- Die Ethnographische Gesprächsanalyse
- Begriffsbestimmung „Jugendsprache“
- Jugendsprachforschung in der Soziolinguistik
- Zur Methodik der Untersuchung adoleszenter Kommunikationskultur in Peer-Groups
-
-
-
- Zur Problematik der epistemischen Konzeptualisierung von Realität
- Zur sprachlichen Konstruktivität von Wirklichkeit
- Kritik des Kommunikationsmodells von Sprache
-
- (Bewusstseins-)theoretische und praktische Intentionalitätskonzeption
- Handlungstheoretische Reflexionen
- Zum Bedeutungsverständnis menschlicher Artefakte und menschlichen Handelns
- Kritik des kognitivistischen und psychologistischen Bedeutungsverständnisses
- Intersubjektivität qua Partizipation an einem gemeinsamen Bedeutungshorizont
- Kommunikative Intentionen und Sprachverständnis
-
- Aufrichtigkeit als rhetorische Größe
- Manifeste und verborgenen Intentionen oder die Problematik der Rekonstruktion „,wahrer“ Handlungsmotive
- Ausdrucksspiele als Form strategischen Handelns
- Die soziale Konstruktion personaler Identität
- Motivdiskurse als Identitätsdiskurse
-
- Bedeutungsverschiebung in der Scherzkommunikation
- Zum Verhältnis von Humor und Höflichkeit in privater Scherzkommunikation
- Die drei häufigsten Formen konversationellen Scherzens (Fiktionalisierung, Frotzelei & Ironie)
- Zur Entwicklung eines pragmatischen Bedeutungsverständnismodells am Beispiel kommunikativer Ironie
-
-
- Der Datenkorpus
- Fallanalyse „Absahnen“
- Fallanalyse „Kreuz und Quer❝
- Fallanalyse „,shots“
- Fallübergreifender Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die alltägliche Kommunikationspraxis von Jugendlichen, insbesondere die Verwendung von Sprachspielen, die die wahren Beweggründe verschleiern. Dabei wird eine männliche Peer-Group als Fallbeispiel betrachtet, um die vielfältigen Kommunikationsstrategien zu analysieren, mit denen die Akteure ihre Absichten und Ziele thematisieren, problematisieren und aushandeln. Die Arbeit fokussiert auf die dynamische Konstruktion von Intentionalität als sozialer Prozess, der durch einen gemeinsamen Ratifikationsmechanismus Sinn und Bedeutung konstituiert. Dieser Prozess beinhaltet auch einen Wettstreit um die definitorische Hoheit über die Wirklichkeit und die damit verbundenen Identitätsansprüche.
- Intentionalitätsdiskurse als Bestandteil informeller Kommunikationspraxis
- Motiventlarvungen als strategisches Instrument in der Kommunikation
- Die Konstruktion von Bedeutung und Sinn durch soziale Ratifikation
- Wettstreit um die definitorische Hoheit über Wirklichkeit und Identität
- Kommunikative Verfahren zur Verhandlung von Intentionalität und zur Abwehr von gesichtsbedrohendem Potenzial
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Einführung der methodischen Grundlagen der Ethnographischen Gesprächsanalyse, die als Analyseinstrument für die Untersuchung der Kommunikationspraxis dient. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen diskutiert, einschließlich des Verhältnisses von Sprache und Kommunikation, des Verständnisses kommunikativer Intentionen und bedeutungsvollen Handelns, sowie der strategischen Interaktion und Motivaushandlung. Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse der Fallanalysen vorgestellt, die sich auf drei verschiedene Kommunikationssituationen konzentrieren: „Absahnen“, „Kreuz und Quer“ und „shots“. Die Analysen zeigen die vielfältigen Formen der Motiventlarvung, der sozialen Konstruktion von Identität und der Verhandlung von Bedeutung innerhalb der untersuchten Peer-Group.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Intentionalitätsdiskurse, Motiventlarvungen, Ethnographische Gesprächsanalyse, Jugendsprache, Peer-Group, Kommunikationskultur, Handlungstheorie, Bedeutungskonstruktion, soziale Ratifikation, Identitätsdiskurse, strategische Interaktion, scherzhafte Kommunikation, Ironie, Argumentation.
Häufig gestellte Fragen zur Kommunikation Jugendlicher
Was ist eine "intentionalitätsdiskursive Kommunikationspraxis"?
Es bezeichnet Strategien in der Kommunikation, bei denen Handlungsabsichten und Ziele dynamisch verhandelt und oft durch Sprachspiele verschleiert werden.
Warum nutzen Jugendliche Motiventlarvungen?
Um die "wahren" Beweggründe anderer aufzudecken oder die eigene Identität innerhalb der Peer-Group zu behaupten.
Welche Rolle spielt Humor in der Peer-Group-Kommunikation?
Scherzkommunikation (Ironie, Frotzelei) dient dazu, Bedeutungen zu verschieben und soziale Spannungen abzubauen oder zu erzeugen.
Was ist Ethnographische Gesprächsanalyse?
Eine Methode, die konkrete Gespräche in ihrem sozialen Kontext untersucht, um die Konstruktion von Wirklichkeit durch die Akteure zu verstehen.
Sind die Absichten der Sprecher immer klar erkennbar?
Nein, Intentionalität wird oft erst nachträglich durch einen sozialen Ratifikationsprozess als bedeutungsvoll ausgewiesen.
- Quote paper
- Sebastian Muthig (Author), 2003, Kommunikation unter Jugendlichen: Eine ethnographisch-gesprächsanalytische Untersuchung zur Gesprächspraxis von männlichen Mitgliedern einer Peer-Group, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20209