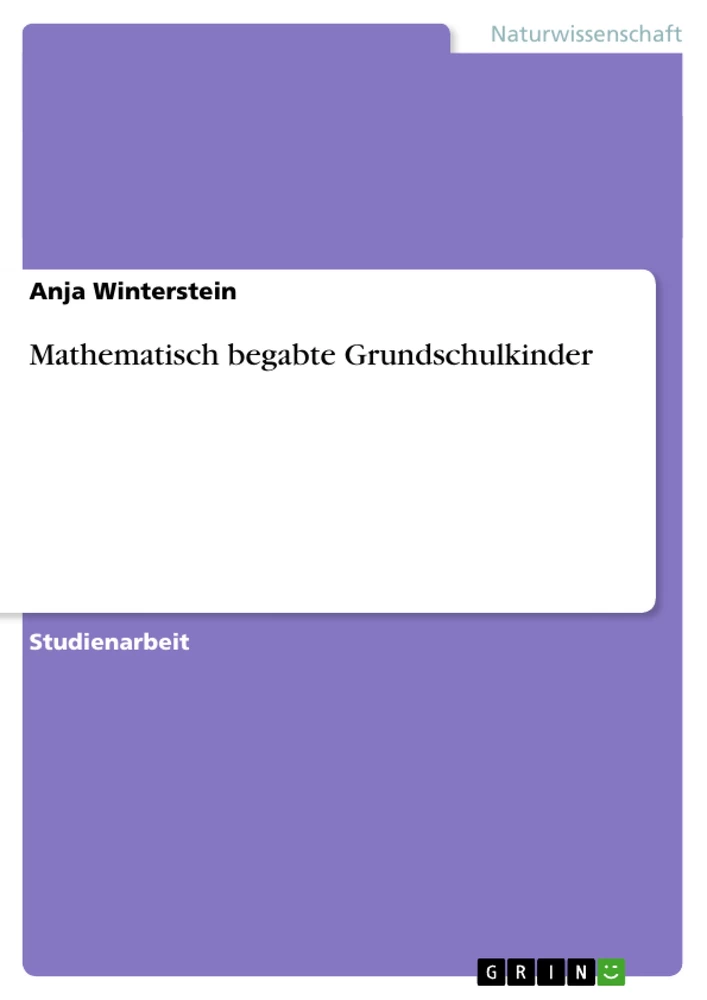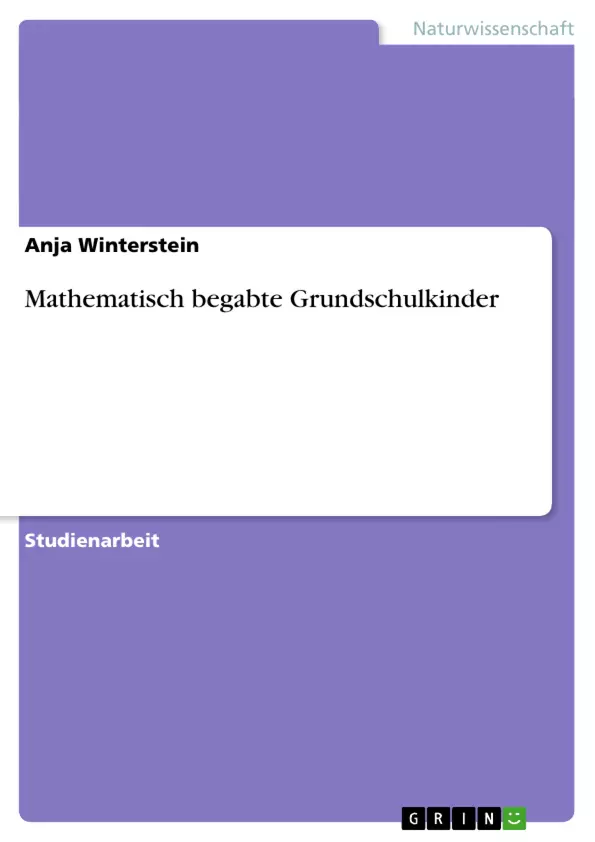Hochbegabung ist heutzutage immer noch ein relativ wenig erforschtes Thema. Es herrscht Unwissenheit und Unsicherheit bei den Eltern, aber genauso bei vielen Lehrern, Pädagogen und Erziehern. Oft haben diese ebenso wenige Informationen wie betroffene Eltern, bzw. haben keine spezielle Ausbildung zu diesem Thema.
Circa 2% der Schulkinder (ca. 300.000) sind hochbegabt und weitere 8% (1,2 Mio.) bereits stark in den Schulen unterfordert. Von diesen 2% Hochbegabten werden bis zur gymnasialen Oberstufe 15% zu Schulversagern (underachiever). Das sind immerhin ca. 45.000 Schulkinder. Wenn man diese Zahlen betrachtet, fragt man sich natürlich wie man dies in Zukunft verhindern und die Betroffenen speziell fördern kann.
Die PISA-Studie und andere empirische Studien haben deutlich gemacht, dass alle Schüler in gleichem Maße gefördert und unterstützt werden müssen. Dies betrifft neben den lernschwachen Schülern ebenso die Begabten und Hochbegabten. Dennoch hat sich, v.a. in der Schulpraxis, immer wieder gezeigt, dass der Schwerpunkt hierbei meist auf lernschwache Schüler gesetzt wird. In nahezu jeder Grundschule gibt es eigens hierfür ins Leben gerufene Förderprogramme, oder Nachhilfegruppen. Die begabten Schüler werden hierbei leider oft konsequent vernachlässigt. Argumente von Lehrern und Pädagogen ist oft, dass die begrenzte Anzahl der Förderstunden einfach lieber für lernschwache Schüler genutzt werden. Außerdem herrscht das Vorurteil, dass begabte Schüler keine Hilfe benötigen, da sie ja schon hochbegabt sind. Doch auch diese Schüler brauchen Förderung und Unterstützung. Jedes Kind in einer Schule muss entsprechend seines Bildungsstandes, und somit seinen speziellen Bedürfnissen, optimal betreut und gefördert werden.
Leider wurde auch in der Mathematikdidaktik die Erforschung mathematischer Denkprozesse von Hochbegabten lange Zeit stark vernachlässigt. Hochbegabtenforschung hat in der Bundesrepublik Deutschland bis Anfang der 80er Jahre kaum eine Rolle gespielt. Lediglich im Bereich des Sportes fand intensive Förderung der starken Schüler statt. Erst in den 90er Jahren hat die Forschung ihren Blick auch verstärkt auf das Gebiet der Hochbegabung gerichtet. Friedhelm Käpnicks Studien bilden hierbei eine nennenswerte Ausnahme. Seine Arbeit zeigt wie wichtig es ist begabte Kinder richtig und erfolgreich zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegendes zum Essen und Essstörungen
- Gestörtes Essverhalten
- Einteilung und Definition von Essstörungen
- Essstörungen als behandlungsbedürftige Krankheiten
- Was liegt Essstörungen zugrunde?
- Welches Gewicht ist „normal“?
- Anorexia nervosa (Magersucht)
- Definition
- Charakteristika der Anorexia nervosa
- Diagnostische Kriterien
- Das klinische Bild
- Körperliche Folgeschäden
- Bulimia nervosa (Ess-Brech-Sucht)
- Definition
- Charakteristika der Bulimia nervosa
- Diagnostische Kriterien
- Das klinische Bild
- Körperliche Folgeschäden
- Ursachen der Magersucht und Bulimie
- Die Gesellschaft
- Die Familie
- Die Persönlichkeit
- Sexueller Missbrauch als besondere Ursache der Magersucht
- Therapiemöglichkeiten
- Prävention von Essstörungen
- Allgemeine Aspekte zur Therapie
- Formen der Therapie
- Heilungschancen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Essstörungen und zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Formen, Ursachen und Therapiemöglichkeiten zu geben. Dabei werden die häufigsten Essstörungen, die Anorexia nervosa und die Bulimia nervosa, im Detail betrachtet.
- Definition und Einteilung von Essstörungen
- Symptome, Folgen und Diagnostik von Anorexia nervosa und Bulimia nervosa
- Soziokulturelle, familiäre und psychologische Ursachen von Essstörungen
- Prävention und Therapieansätze für Essstörungen
- Das Konzept von „Normalgewicht“ und die Bedeutung von Körperbild und Selbstwertgefühl
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Essstörungen ein und beleuchtet die Bedeutung des Themas sowie die Herausforderungen im Umgang mit diesen Erkrankungen.
- Kapitel 2: Grundlegendes zum Essen und Essstörungen: Dieses Kapitel liefert einen grundlegenden Überblick über das Thema Essstörungen. Es werden verschiedene Formen und Definitionen erläutert, sowie die Ursachen und Auswirkungen von Essstörungen auf den Körper und die Psyche beleuchtet.
- Kapitel 3: Anorexia nervosa (Magersucht): Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Anorexia nervosa. Es werden die Symptome, die Diagnostik, die körperlichen Folgen und die Ursachen der Magersucht behandelt.
- Kapitel 4: Bulimia nervosa (Ess-Brech-Sucht): Analog zu Kapitel 3 wird in diesem Kapitel die Bulimia nervosa näher betrachtet. Die Fokuspunkte liegen auf den Symptomen, der Diagnostik, den körperlichen Folgen und den Ursachen der Ess-Brech-Sucht.
- Kapitel 5: Ursachen der Magersucht und Bulimie: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Ursachen von Magersucht und Bulimie genauer betrachtet. Es werden sowohl gesellschaftliche, familiäre als auch persönliche Faktoren beleuchtet, die zu Essstörungen beitragen können.
- Kapitel 6: Therapiemöglichkeiten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Behandlung von Essstörungen. Es werden verschiedene Therapieformen vorgestellt, sowie Präventionsmaßnahmen und die Heilungschancen erläutert.
Schlüsselwörter
Essstörungen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Magersucht, Ess-Brech-Sucht, Körperbild, Selbstwertgefühl, Ursachen, Therapie, Prävention, Diagnostik, Gesellschaft, Familie, Persönlichkeit, Körperliche Folgeschäden.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptmerkmale von Anorexia nervosa (Magersucht)?
Magersucht ist durch ein klinisches Bild von extremem Untergewicht, intensiver Angst vor einer Gewichtszunahme und einer gestörten Wahrnehmung des eigenen Körpers gekennzeichnet.
Wie unterscheidet sich Bulimia nervosa von Magersucht?
Bulimie (Ess-Brech-Sucht) ist geprägt durch wiederkehrende Essanfälle, gefolgt von kompensatorischen Maßnahmen wie selbst herbeigeführtem Erbrechen, um eine Gewichtszunahme zu verhindern.
Welche Ursachen führen zu Essstörungen?
Die Ursachen sind komplex und liegen in einem Zusammenspiel aus gesellschaftlichen Schönheitsidealen, familiären Strukturen, Persönlichkeitsmerkmalen und teilweise traumatischen Erlebnissen wie sexuellem Missbrauch.
Welche körperlichen Folgeschäden können auftreten?
Essstörungen können zu schweren Organschäden, Herz-Kreislauf-Problemen, hormonellen Störungen und bei Magersucht bis zum Tod durch Verhungern führen.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Die Behandlung umfasst verschiedene Formen der Psychotherapie (einzeln oder in Gruppen), medizinische Betreuung sowie Präventionsprogramme zur Stärkung des Selbstwertgefühls.
- Quote paper
- Anja Winterstein (Author), 2003, Mathematisch begabte Grundschulkinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20221