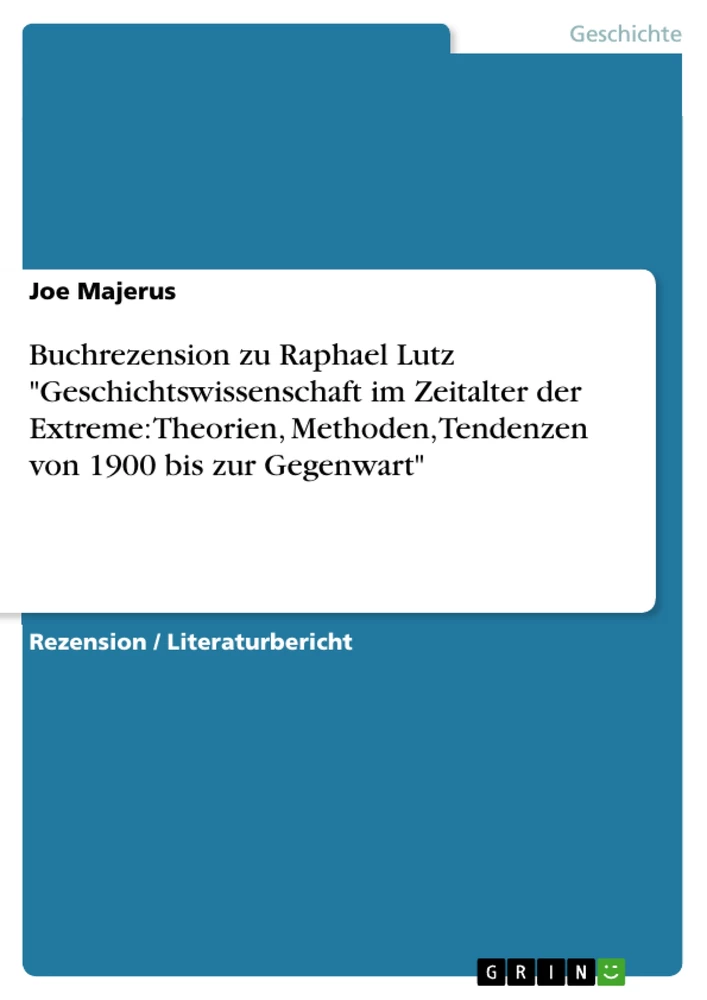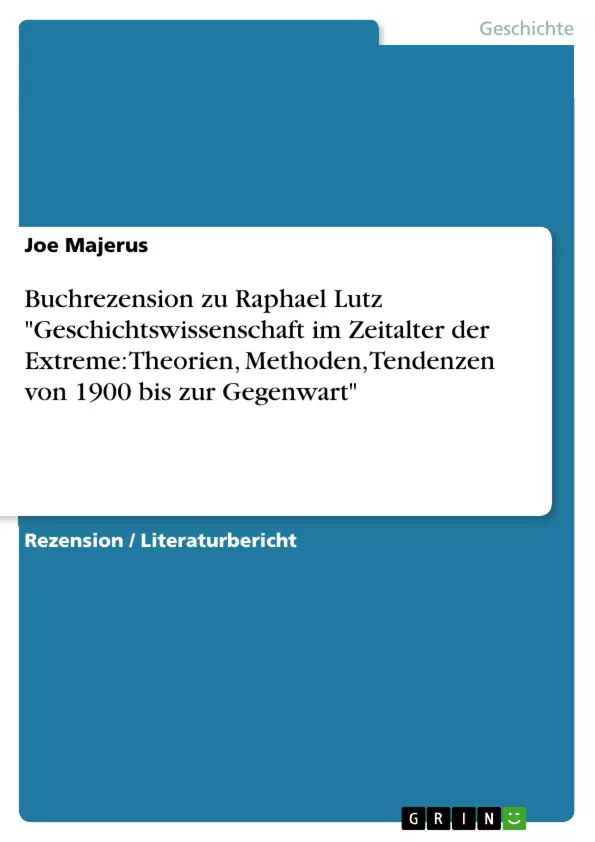Kritische Bewertung von Raphael Lutz' historiographischer Überblicksdarstellung über die Entwicklung der Geschichtswissenschaften im 20. und frühen 21. Jahrhundert.
Buchrezension zu „Lutz Raphael. Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart. C. H. Beck, München 2003.“
Joe Majerus
BCE – Histoire (6)
Das Werk „Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme“[1] des deutschen Historikers Raphel Lutz ist eine im Münchener Beck Verlag erschienene, historiographische Überblickdarstellung, welche über die allgemeinen Hauptströmungen und internen Entwicklungen im Bereich der historischen Geschichtswissenschaften während der letzten einhundert Jahre informiert. Dabei bewegt sich der Autor durchaus auf ihm bestens vertrauten Pfaden, wovon nicht zuletzt die im Rahmen seiner Habilitationsarbeit erfolgte Beschäftigung mit dem Wirken und Einfluss der französischen „Annales-Schule“ in der Nachkriegszeit sowie seine leitende Beteiligung am Projekt „Atlas of the institutions of European Historiography 1800-2005“ ein überzeugendes Zeugnis ablegen.[2]
In der Tradition vorheriger Arbeiten liegt der Hauptakzent des Buches allen voran auf einer ausführlichen, thematisch strukturierten Abfassung über die allgemeine Entwicklung und interne Umorientierung einzelner historischer Fachdisziplinen im Laufe der letzten Jahrzehnte. Alleine schon aufgrund der chronologischen Anordnung des Buches entlang der internen Entwicklung verschiedener historischer Teildisziplinen, insbesondere den von ihnen auf andere historische Fachrichtungen ausgehenden Impulsen sowie umgekehrt den von diesen auf sie einwirkenden Einflüssen, wird deutlich, dass sich für den Autor die historiographische Entwicklung prinzipiell nicht über ein Paradigmenmodell universeller, fächerübergreifender Interpretationsschemata definieren lässt, mit anderen Worten also nicht im Sinne einer über „Brüche [und] radikale Veränderungen der Deutungsmuster“[3] gekennzeichneten „Abfolge dominanter Paradigmen“[4] .
Vielmehr versucht der Autor zu verdeutlichen, dass sich in der Geschichtswissenschaft generell keine solch eindeutig festzumachende Schnittstelle zwischen großen Theorien und Methodenkontroversen“ ausmachen lässt, sondern dass sich gerade im Verlauf des 20. Jahrhunderts verschiedenartige Erklärungsmodelle und methodologische Praktiken weitestgehend in wetteifernder Konkurrenz zueinander befanden, ohne dabei allerdings jemals vollständig einen allumfassenden Gültigkeitsanspruch gegenüber anderen Deutungsansätzen errungen zu haben. Laut Lutz befanden sich unterschiedliche konzeptuelle Methodiken vielmehr im Zustand eines „friedlich[en] Nebeneinander[s] unterschiedlicher Ansätze“[5] , ein Vorgang der vor allem durch den wechselseitigen Austausch von Ideen und Forschungspraktiken aus benachbarten sozialwissenschaftlichen Disziplinen geprägt war und folglich ganz wesentlich zur systematischen Pluralisierung und Diversifikation von fachspezifischen „Schulen“ und „Konzepten“ beigetragen hat.[6]
Diese strukturelle Öffnung hin zu einer auf multiplen Ansätzen basierenden Geschichtswissenschaft gründet für Lutz auf dem Zusammenspiel einiger wegweisender Entwicklungen innerhalb der Geschichts- bzw. Humanwissenschaften, beginnend mit der für für die Internationalisierung der Geschichte zentralen Voraussetzung einer allmählichen Professionalisierung.[7] Der mit dieser Entwicklung einhergehende, höhere Autonomiegrad wissenschaftlicher Forschung von (national)-staatlichen Vorgaben schuf laut Lutz überhaupt erst den institutionellen Rahmen dafür, damit einzelne Historiker vermehrt auf externe Methodiken und Interpretationsmodelle zurückgriffen, zunächst allen voran durch die Einbindung empirischer Erkenntnisgewinne aus den Bereichen der Soziologie, Psychologie, Ökonomie und Geographie, später dann auch ergänzend durch neuere sozial- bzw. kulturgeschichtliche Ansätze.[8]
Eine unmittelbare Folge davon war die Ausdifferenzierung der Geschichtswissenschaft hin zu einer fach-internen Spezialisierung, was trotz der nach wie vor bedeutsamen Vorrangstellung einer national-staatlichen Politikgeschichte zur allmählichen Verbreitung und Aufwertung vergleichsweise junger Disziplinen wie der Kulturgeschichte, später dann auch der Alltagsgeschichte oder Global History, führte. Im Zuge von Globalisierung und akademischer Internationalisierung, maßgeblich begünstigt durch eine fächerübergreifende Angleichung professioneller Mindeststandards, erfasste diese Pluralisierung der historischen Forschungslandschaft letztlich sämtliche Teile der Erde, auch wenn es in Folge politisch-ideologischer Trennlinien, post-kolonialer Umorientierungen sowie dem z.T. starren Festhalten an althergebrachten Praktiken[9] bisweilen weiterhin unterschiedliche thematische Schwerpunktsetzungen, Präferenzen gegenüber bestimmten Erklärungsmodellen oder eine bewusste Konzentration auf regional- bzw. kulturspezifische Eigenarten zu verzeichnen gab.
[...]
[1] Eine offensichtliche Anspielung an Eric Hobsbawm's Abhandlung über die von ideologischer Zerrissenheit gekennzeichnete Geschichte des 20. Jahrhunderts, eine Entwicklung die sich in Folge politischer Instrumentalisierung mitunter auch ganz erheblich auf die Gestaltung historischer Forschungsarbeiten bzw. deren Schwerpunktsetzung auswirkte.
[2] http://geschichte.uni-trier.de/index.php?id=27 (11. April 2012)
[3] S. 14.
[4] S. 15.
[5] S. 16.
[6] S. 16.
[7] S. 25.
[8] S. 18; 70-76.
[9] Z.B. die in vielen islamischen Ländern fortwährende Konkurrenz einer an säkular-theoretischen Forschungsansätzen ausgerichteten Schule mit einer sich eher an religiös-traditionellen Deutungsmustern orientierenden Historikerzunft, S. 54-55.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Lutz Raphaels Werk?
Es ist eine historiographische Überblicksdarstellung über die Theorien, Methoden und Tendenzen der Geschichtswissenschaft von 1900 bis zur Gegenwart.
Was kritisiert Raphael am Paradigmenmodell?
Er argumentiert, dass die Entwicklung der Geschichtswissenschaft nicht durch radikale Brüche, sondern durch ein friedliches Nebeneinander und den wetteifernden Austausch verschiedener Ansätze geprägt ist.
Welche Rolle spielt die "Annales-Schule"?
Die französische Annales-Schule wird als wegweisend für die Öffnung der Geschichte hin zu Sozialwissenschaften wie Soziologie, Ökonomie und Geographie hervorgehoben.
Wie hat die Globalisierung die Geschichtswissenschaft verändert?
Sie führte zu einer akademischen Internationalisierung und Pluralisierung, wodurch neue Disziplinen wie Global History oder Alltagsgeschichte an Bedeutung gewannen.
Was bedeutet "Professionalisierung" in diesem Kontext?
Es beschreibt den Prozess, durch den die Geschichtswissenschaft einen höheren Autonomiegrad von nationalstaatlichen Vorgaben erlangte und wissenschaftliche Mindeststandards etablierte.
- Arbeit zitieren
- Joe Majerus (Autor:in), 2012, Buchrezension zu Raphael Lutz "Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme: Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202285