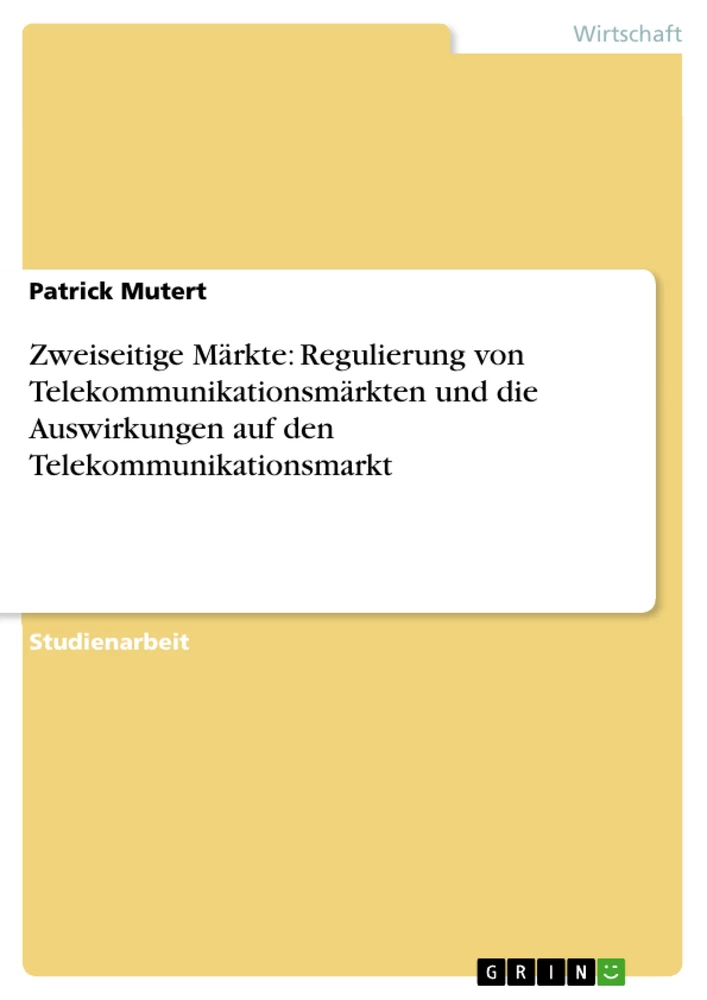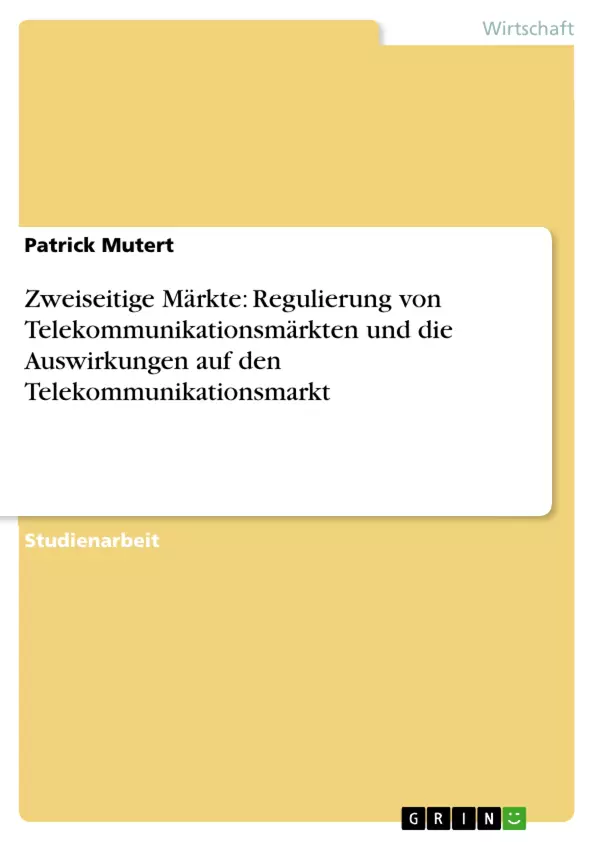Zwischen 2004 und 2011 stieg die Zahl der Teilnehmer in deutschen Mobilfunknetzen von 76,1 Mio. auf 114,13 Mio. Im gleichen Zeitraum verbuchte Facebook einen 900-fachen Nutzerzuwachs. Diese Zahlen sind beeindruckend, aber einfach zu erklären. Sowohl die Mobilfunknetze als auch Facebook sind Anbieter, die Plattformen für die Kommunikation zwischen Menschen bereitstellen. Je mehr Teilnehmer auf einer Plattform interagieren, desto größer ist der Nutzen für jeden einzelnen Teilnehmer. Kommt auf der einen Seite also ein Nutzer hinzu, profitieren auf der anderen Seite alle bereits existierenden Nutzer.
Diese junge Disziplin der zweiseitigen Märkte beschreibt und untersucht seit einer Dekade die Theorie von der optimalen Preissetzung der Plattformen über die ideale Regulierung bis hin zur Effizienz. Um das Konzept der zweiseitigen Märkte zu erklären, haben Evans und Schmalensee ein einfaches Beispiel gewählt, welches ich hier einleitend aufgreifen werde. Eine Diskothek bietet heterosexuellen Frauen und Männern eine Plattform an, um sich kennen zu lernen. Da Frauen einerseits von der Anwesenheit von Männern und Männer von der Anwesenheit von Frauen profitieren, muss die Diskothek also sowohl Frauen als auch Männer auf die Tanzfläche locken. Die Preissetzung der Diskothek ist eine Möglichkeit zur Kontrolle der Anzahl teilnehmender Personen. Stellt der Diskothekenbetreiber eine nicht ausreichende Anzahl von Frauen im Club fest, so werden aus der wartenden Menge die Damen herausgepickt und bevorzugt in die Diskothek gelassen. Aber auch Freigetränke oder niedrigere Preise für die potentielle weibliche Kundschaft sind beliebte Anreize. Anhand dieses Beispiels lassen sich alle relevanten Themenbereiche von zweiseitigen Märkten zusammenfassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zweiseitige Märkte — Anwendung der Theorie auf den Telekommunikationsmarkt
- Regulierung von Telekommunikationsmärkten
- Notwendigkeit von Regulierung in monopolistischen Telekommunikationsmärkten
- Der Wasserbetteffekt — Ergebnis exogener Terminierungsentgelte
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Auswirkungen der Regulierung von Terminierungsentgelten in Telekommunikationsmärkten auf den Verbraucherpreis. Der Fokus liegt dabei auf zweiseitigen Märkten, insbesondere im Mobilfunkbereich, und analysiert den Einfluss der Regulierung auf die Wohlfahrt der Konsumenten.
- Zweiseitige Märkte und ihre Bedeutung für den Telekommunikationsmarkt
- Die Rolle von Netzwerkeffekten und der kritischen Masse im Telekommunikationsmarkt
- Die Notwendigkeit von Regulierung in monopolistischen Telekommunikationsmärkten
- Der Wasserbetteffekt und seine Auswirkungen auf den Verbraucherpreis
- Die Auswirkungen der Regulierung auf die Wohlfahrt der Konsumenten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der zweiseitigen Märkte ein und beleuchtet die Bedeutung von Netzwerkeffekten und der kritischen Masse im Telekommunikationsmarkt. Dabei wird der Fokus auf die Besonderheiten des Mobilfunkmarktes gelegt, insbesondere auf die Entstehung von natürlichen Monopolen aufgrund der hohen Investitionskosten für den Netzaufbau.
Das zweite Kapitel vertieft die Theorie der zweiseitigen Märkte und ihre Anwendung auf den Telekommunikationsmarkt. Es werden die beiden Formen von Netzwerkeffekten, direkte und indirekte, erläutert und die Bedeutung der kritischen Masse für den Markteintritt von neuen Telekommunikationsanbietern hervorgehoben. Die Bedeutung der Terminierungsentgelte und ihre Rolle im Marktgeschehen werden ebenfalls beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Regulierung von Telekommunikationsmärkten und untersucht die Notwendigkeit und die Auswirkungen der Regulierung von Terminierungsentgelten. Es werden die verschiedenen regulatorischen Ansätze und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Preise im Telekommunikationsmarkt analysiert. Der Abschnitt "Der Wasserbetteffekt" beleuchtet die potenziellen negativen Auswirkungen der Regulierung auf den Verbraucherpreis, die durch die komplexe Interaktion zwischen Terminierungsentgelten und Verbraucherpreisen entstehen können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen zweiseitige Märkte, Telekommunikationsmärkte, Regulierung, Terminierungsentgelte, Verbraucherpreis, Wasserbetteffekt, Netzwerkeffekte, kritische Masse, Wohlfahrt, Monopol, Wettbewerb.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein zweiseitiger Markt?
Ein Markt, auf dem eine Plattform (z.B. Mobilfunknetz, Facebook) zwei verschiedene Nutzergruppen zusammenbringt, die durch Netzwerkeffekte voneinander profitieren.
Was versteht man unter dem "Wasserbetteffekt"?
Wenn die Regulierung die Preise auf einer Seite des Marktes (z.B. Terminierungsentgelte) senkt, steigen oft die Preise auf der anderen Seite (z.B. Grundgebühren für Endkunden), ähnlich wie bei einer Wassermatratze.
Warum müssen Terminierungsentgelte reguliert werden?
Da jedes Netz ein Monopol für die Anrufe zu seinen eigenen Teilnehmern besitzt, könnten Anbieter ohne Regulierung überhöhte Preise verlangen, was den Wettbewerb behindert.
Welche Rolle spielen Netzwerkeffekte im Mobilfunk?
Je mehr Teilnehmer ein Netz hat, desto wertvoller ist es für jeden Einzelnen. Dies führt dazu, dass eine "kritische Masse" erreicht werden muss, damit der Markt effizient funktioniert.
Wie beeinflusst die Regulierung die Wohlfahrt der Konsumenten?
Die Arbeit analysiert, ob sinkende Terminierungskosten tatsächlich zu niedrigeren Endkundenpreisen führen oder ob der Wasserbetteffekt die Vorteile für die Verbraucher zunichtemacht.
Warum wird das Beispiel einer Diskothek zur Erklärung genutzt?
Es veranschaulicht einfach, wie eine Plattform (Diskothek) durch unterschiedliche Preissetzung (z.B. freier Eintritt für Frauen) versucht, beide Seiten des Marktes für gegenseitigen Nutzen zusammenzubringen.
- Arbeit zitieren
- Patrick Mutert (Autor:in), 2012, Zweiseitige Märkte: Regulierung von Telekommunikationsmärkten und die Auswirkungen auf den Telekommunikationsmarkt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202394