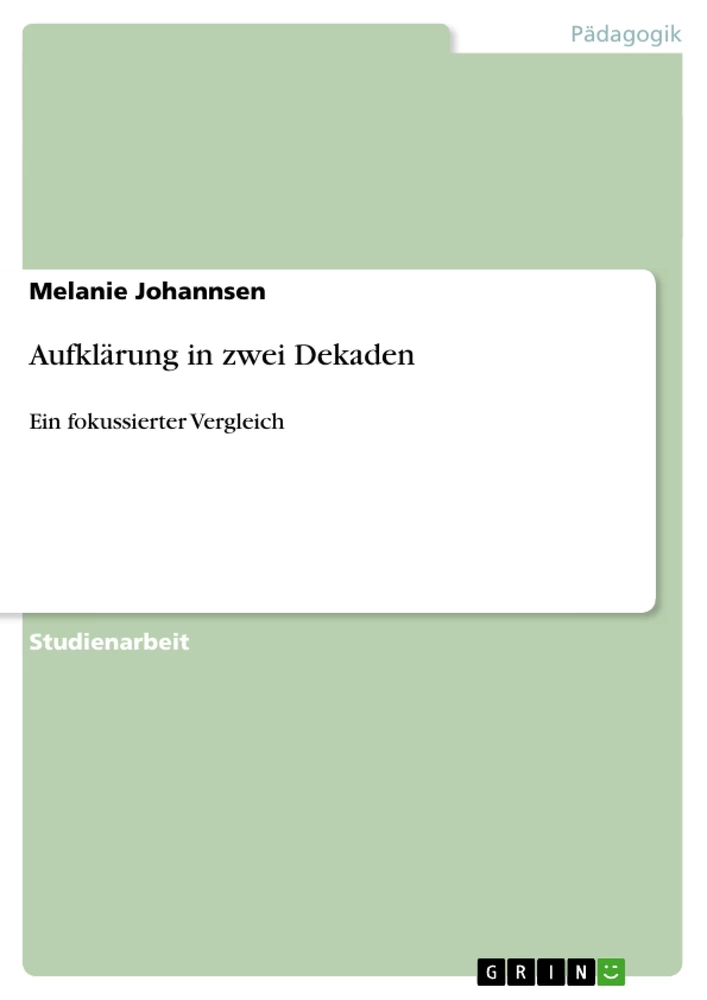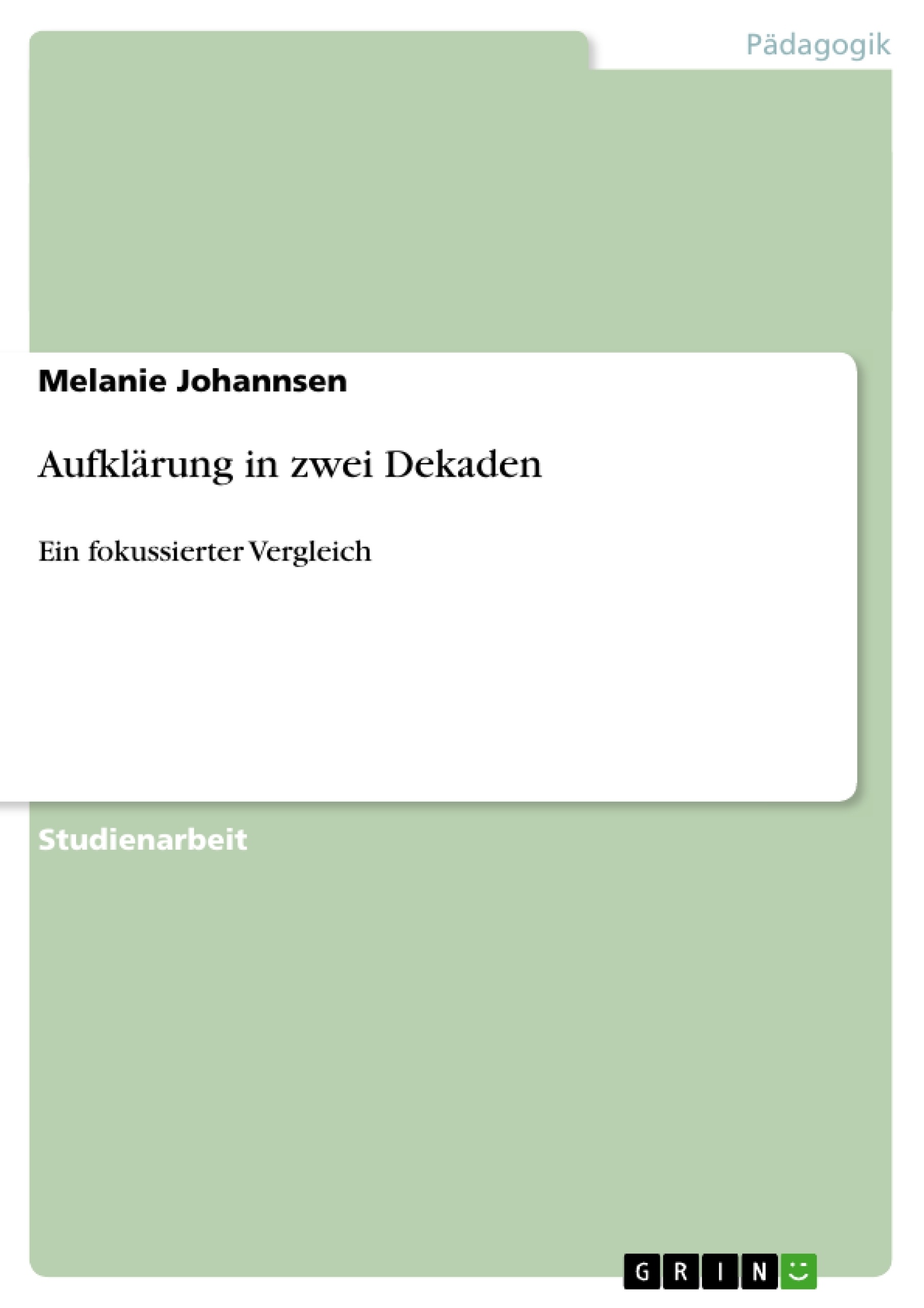Wie wurde Sexualaufklärung in zwei verschiedenen Dekaden durchgeführt? Wie ist der Weg in den zeitgenössischen Aufklärungsbüchern von 1961 und 1983 auf dem ein Mädchen zur Frau wird und welche Veränderungen ergeben sich im Vergleich? Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Sozialisation der Mädchen. Die Überschneidungen mit der aktuellen Aufklärungsstrategie bleiben dennoch in beiden Dekaden teilweise erschreckend aktuell.
1 Einleitung
In unserer Arbeit beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Sexualaufklärung in zwei verschiedenen Dekaden durchgeführt wurde. Wir untersuchen, wie in den zeitgenössischen Aufklärungsbüchern von 1961 und 1983 ein Mädchen zur Frau wird und welche Veränderungen sich im Vergleich ergeben haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Sozialisation[1] der Mädchen, so dass weitere Inhalte, wie z.B. die biologische Grundlage, nicht Teil des Vergleichs werden. Wir werden zunächst darstellen, wie Menschen in verschiedenen Phasen erwachsen werden, bevor wir die Aufklärungsstrategien der Dekaden darstellen und diese in einem Vergleich gegenüber stellen.
Zu Beginn unserer Auseinandersetzung mit dem Thema haben wir uns die Frage gestellt welches Menschenbild hinter einem Aufklärungsansatz stehen könnte und wie der Weg seiner Entwicklung aussieht. Unser erster Gedanke war: Ist doch ganz klar! Jeder Mensch ist einmalig, mit seinen Eigenarten und Besonderheiten, jeder sieht anders aus und es gibt keinen doppelt, jeder ist ein Unikat und keine Massenware. Das Erste und Offensichtlichste ist sicher das Aussehen, jeder hat einen bestimmten Charakter, jeder fühlt anders, hat andere Meinungen, einen anderen Geschmack, Vorlieben, usw. Jeder Mensch hat andere Begabungen und Fähigkeiten. Wir können sie entdecken und benutzen, aber auch einfach unbeachtet lassen. Durch sie werden wir auch zum unverwechselbaren Exemplar.
Es heißt auch bei Goffman und Hagemann-White[2] , dass alle Menschen unterschiedlich sind und der erste Unterschied direkt nach der Geburt erkennbar wird: Die Babys werden in männlich und weiblich eingeteilt. Von Anfang an werden die der männlichen und weiblichen Klasse zugeordneten Personen unterschiedlich behandelt, sie machen verschiedene Erfahrungen, dürfen andere Erwartungen stellen und müssen andere erfüllen. Als Folge davon lagert sich eine geschlechtsklassenspezifische Weise der äußeren Erscheinung, des Handelns und Fühlens über das biologische Muster, die dieses. ausbaut, missachtet oder durchkreuzt. Frauen sind im allgemeinen Verständnis emotionaler und Männer rationaler, so dass Frauen in kritischen Situationen Schutz suchen dürfen und der Mann sich der Situation zu stellen hat. Die Unterschiede werden jedoch noch deutlicher, wenn Männer und Frauen nach Erfolgen und Misserfolgen gefragt werden.
„Männer schreiben ihre Erfolge, ihre Fähigkeiten/Begabungen zu, ihre Misserfolge erklären sie durch Pech oder mangelnde Anstrengung. Frauen sehen ihre Erfolge eher als Sache von Glück an, ihre Misserfolge als mangelnde Begabung.“[3]
Diese Situation entsteht aus Zuschreibungen und Vorannahmen, wie Geschlecht innerhalb der Gesellschaft deutlich wird und über das biologische Muster hinaus etabliert wird.
Stefan Hirschauer[4] verfolgt in diesem Zusammenhang die These, dass die Geschlechtszugehörigkeit von Gesellschaftsmitgliedern eine durch und durch soziale Konstruktion sei. Die Genitalien seien schamhaft zu bedecken - dies sei das subtilste Mittel der Konstruktion genitaler Signifikanz. Im alltäglichen Umgang bedeutet dies, dass die biologisch gegebene Ausprägung der Genitalien zu sozialen Vorannahmen führt, die den Einzelnen u.a. auf ein bestimmtes soziales Verhalten schließen lassen. Da sie jedoch selten direkt sichtbar sind, werden sie mystifiziert und durch z.B. Kleidungsstücke, Frisuren, Gesten, Namen und Tätigkeiten in das sozial konstruierte Bild der Geschlechter eingepasst.
Gleichzeitig wird von den Gesellschaftsmitgliedern die korrekte Erkennung des Geschlechts und damit die Repräsentation von Geschlecht erwartet: Das Verhalten soll dem Geschlecht angemessen sein. Es gibt allgemein anerkannte männliche und weibliche Verhaltensweisen, wie z.B.: Beim Freunde treffen, reden die Frauen eher von Familie, Kindern und Einkaufen und Männer unterhalten sich eher über Sport, Autos, Frauen.
2 Klärung der Grundbegriffe
Heranwachsende lernen die Geschlechtsdarstellung in ihrer Entwicklung kennen und umzusetzen. Viele Jugendliche müssen bei der Geschlechtsdarstellung auch gegen ihren eigenen Körper arbeiten. Geschlechtsdarstellungen könnten defensiv oder offensiv sein.[5] Offensiv bedeutet: Ich bleibe so wie ich bin, weil ich mich so wohl fühle. Defensiv hingegen: Ich tue alles, um den gesellschaftlichen Normen (als Mann oder Frau) zu entsprechen. Dies geschieht z.B. durch Make-Up, Epilationen, Hormonbehandlungen, kosmetische Operationen, Diäten oder Bodybuilding. Eine gelungene Darstellung weist Einzelne als kompetente Gesellschaftsmitglieder aus.
Um die Stabilität der Geschlechtszugehörigkeit zu erläutern, entwickelt Hirschauer[6] den Begriff der Geschlechtszuständigkeit. Sie umfasst einerseits Kompetenzen und andererseits Rechte und Verantwortungen gegenüber der Gesellschaft und wird während der Kindheit und der Jugend entwickelt. Die Rechte umfassen z.B. ein Recht auf einen Geschlechtstitel, sowie ein Recht auf einen geschlechtsangemessenen Umgang. Die Verantwortung besteht in einer angemessenen und kompetenten Geschlechtsdarstellung.
Peter Zimmermann[7] beschreibt die Jugendphase als turbulent und ereignisreich. In diesem Lebensabschnitt geschieht eine erhebliche körperliche, emotional geistige und soziale Entwicklung.
Die Jugendphase
- führe zum biologischen Erwachsenenstatus
- sei ein sozialer Reifeprozess
- biete einen Schonraum, um die Erwachsenenrolle zu erproben
- biete dem Jugendlichen eher Initiative und Freiheit, seine Impulse auszudrücken, als es in der Kindheit möglichst ist
- sei die Befreiung/Ablösung von den primären Eltern- Kind- Beziehung.
Diese Übergangsphase von der Kindheit bis Eintritt in das Erwachsenenalter, vollzieht sich nach Zimmermann[8] im Alter von ca. 13-25 Jahren. Mit dieser Einschätzung stimmen nicht alle Jugend- und Sozialforscher überein. Übereinstimmung herrsche in dem Umstand, dass die Ränder dieser Spanne unscharf seien; z.B. könne ein 25- jähriger schon ein bereits berufstätiger selbstständiger Jugendunternehmer sein. Ein anderer 25-jähriger könne aber immer noch bei den Eltern wohnen und so noch nicht, den für das Erwachsenenalter notwendigen eigenen Haushalt realisiert haben; somit in der Jugendphase verbleiben.
Die wesentlichen Begriffe in diesem Forschungszusammenhang sind Pubertät und Adoleszenz. Pubertät bezeichnet in erste Linie ein biologisches Geschehen, wie z.B. Veränderungen der Körperproportion. Weitere biologische Zeichen sind, wie z.B. die Geschlechtsreife (beim Mädchen die erste Monatsblutung und beim Jungen die erste Pollution). Neben diesen biologischen und körperlichen Veränderungen beginnt ein großer seelischer Umbau, der sich oftmals in unverständlichen und unkontrollierten Verhaltensweisen ausdrückt.
Der Begriff Adoleszenz stammt aus der Psychologie und bezeichnet die Entwicklungsphase, die über die Pubertät hinausgeht. Kasten[9] stellt die einzelnen Phasen dieser Entwicklung, detaillierter als Zimmermann und Hurrelmann, in einer Graphik dar. Hierbei zählen nicht die Unterteilungen nach diesem Modell, sondern die Verfügbarkeit eines Überblickes.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1: aus Zimmermann, 2006, S.156
Mit Hurrelmann[10] beginnt die Jugendphase mit Eintritt der Geschlechtsreife mit ca. 10 Jahren und endet, analog zu Zimmermann mit Mitte/Ende zwanzig. Übereinstimmend drücken beide eine Teilung der Jugendphase in zwei große Abschnitte aus: Zum einen die Frühadoleszenz (bis ca. 18 Jahre) und zum anderen die Spätadoleszenz (bis ca. Mitte/Ende 20). Beide weisen, wie im Folgenden deutlich werden wird, auf eine Verschiebung der Altersgrenzen hin. Allgemein stellt sich diese Veränderung in der folgenden Abbildung dar:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2: aus Hurrelmann, 2005, S.17
Durch die Vielseitigkeit von Lebensstilen und Lebensentwürfen in der heutigen Gesellschaft können sich die Jugendlichen, z.B. durch verschiedene Schulformen, Straßengangs oder frühe Schwangerschaften, eine eigene Biographie „basteln“. Zimmermann und Hurrelmann[11] stellen fest, dass Heranwachsende ihre Identität selbst zu entwerfen haben und dies ein zentraler Punkt dieser Lebensphase sei. Die individualistischen Formen der Gestaltung der Jugendphase unterscheiden sich immer wesentlicher, so dass von einem Strukturwandel oder einer Destandardisierung innerhalb der Jugendphase gesprochen wird.
Empirische Studien belegen[12] , dass der Schulabschluss und Anfang des beruflichen Lebens immer später erfolgt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Adoleszenz der 50er Jahre, welche mit 22 Jahren von dem Eintritt in das Erwachsenenalter ausging, sich aufgelöst hat. Die heutige Sozialisation in der Jugendphase bedeutet nichts anderes als eine eigene Lebensführung. Die selbstständige Überlegung und Umsetzung werden mit dem Begriff „Biographisierung“ bezeichnet, da die eigene Gestaltung der Biographie charakteristisch ist. Dafür haben Jugendliche einen großen Entscheidungsspielraum von bestimmten Jugendkulturen bis hin zu bestimmten Konsumartikeln.
Jugend ist demzufolge nicht nur eine Übergangsphase, sondern ein Lebensabschnitt. Jugend stellt eine Lebensphase dar, die die Pubertät mit der Entwicklungsphase bis zum Eintritt in das Erwachsenenalter verknüpft.
Am Ende der Adoleszenz steht der Eintritt in das Erwachsenenalter. Dieser erfolgt, wenn die verschiedenen Aufgaben der Jugendphase in einem individuellen Tempo bewältigt worden sind. Mit Zimmermann[13] ergeben sich die folgenden Aufgaben:
Persönliche Aufgaben:
- Selbstständigkeit und Eigenständigkeit (Treffen wichtiger Entscheidungen)
- mit Alltagssituationen zurecht kommen
- Veränderung des eigenen Körpers akzeptieren
- eigene Stärken und Schwächen bewusster kennen
- eigene Lebenseinstellung wählen, eigene Meinung zu sozialen und politischen Fragen haben
Beziehungsaufgabe:
- stabile Freundschaftsbeziehungen aufbauen
- eine intime Beziehung aufbauen
Sozioinstitutionale Aufgaben:
- Verantwortung für die (Schul-) Karriere unternehmen
- sich auf Berufsleben vorbereiten
- finanziell unabhängig werden
- Vorbereitung auf Verantwortung für eine eigene Familie
Die Jugendphase kann folglich, bezogen auf eine geschlechtsspezifische Aufklärung, als eine Lebensphase angesehen werden, in der das Geschlecht und die Geschlechtsidentität und auch die Beziehungen sich auf eine neue Weise geschlechtlich strukturieren. Die Anforderungen der Selbststeuerung bringen für Jugendliche viele Konflikte und Enttäuschungen mit sich. Einige der Herausforderungen und Konflikte werden in dem folgenden Vergleich deutlich werden.
3 Sozialisation im Vergleich
3.1 Zur Aufklärung im Jahr 1961
Als Beispiel für die Aufklärung in den 60er Jahren soll ein Buch dienen, dass Kurt Seelmann (1900 - 1987), seines Zeichens Erziehungsberater und Psychotherapeut in München, 1961 in der Erstausgabe veröffentlicht hat. „Woher kommen die kleinen Buben und Mädchen - Ein kleines Buch zum Vor - und Selberlesen für 9 bis 14-jährige Mädchen und Buben“ erschien im Ernst Reinhardt Verlag in München-Basel und erhebt auf insgesamt 104 Seiten den Anspruch neun bis vierzehenjährigen Mädchen und Jungen eine zeitgemäße Aufklärung zu ermöglichen. Neben biologischen Erklärungen, die u.a. die Geschlechtsorgane, die Entwicklungszeit und den Akt selbst betreffen, erfahren die LeserInnen etwas zu dem gesellschaftlichen Werdegang und den Rollenverteilungen in der Familie. Alle Informationen erhalten sie mit dem Ziel den folgenden Zukunftsplan zu erfassen und umsetzen zu können:
[...]
[1] Sozialisation wird als ein Prozess verstanden, in dem, in diesem Fall, die Jugendlichen sich produktiv mit den äußeren, sozialen und psychischen Umweltbedingungen auseinandersetzen und diese aktiv und identitätsstiftend miteinander vereinbaren. Dieser Prozess wird durch eine gegenseitige Beeinflussung der individuellen Perspektive und der Einflüsse der Umwelt katalysiert und bestimmt (Vgl. Hurrelmann, 2005).
[2] Vgl. Breitenbach, 2000
[3] Rüstermeyer, 1988, S.120: in Bilden, aus: Hurrelmann/Ulich, 1991, S.281
[4] Vgl. Breitenbach, 2000, S.30
[5] Vgl. Breitenbach, 2000, S.32
[6] Vgl. Breitenbach, 2000, S.30-34
[7] Vgl. Zimmermann, 2006
[8] Vgl. Zimmermann, 2006
[9] Kasten, 1999, S.15; in: Zimmermann, 2006, S.156
[10] Vgl. Hurrelmann, 2005
[11] Vgl. Zimmermann 2006 und Hurrelmann, 2005
[12] Zimmermann, 2006, S.155ff.
[13] Vgl. Zimmermann, 2006
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich die Sexualaufklärung 1961 von 1983?
Die Arbeit vergleicht zeitgenössische Aufklärungsbücher und zeigt den Wandel von eher biologisch-moralischen Ansätzen hin zu einer stärkeren Berücksichtigung der sozialen Identität und Selbstbestimmung.
Was bedeutet "Geschlecht als soziale Konstruktion" in diesem Kontext?
Nach Stefan Hirschauer wird Geschlechtszugehörigkeit durch soziales Verhalten, Kleidung und Erwartungen im Alltag hergestellt, die über die rein biologischen Merkmale hinausgehen.
Was versteht man unter Adoleszenz?
Adoleszenz bezeichnet die psychologische Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, die über die rein biologische Pubertät hinausgeht und die Identitätsfindung umfasst.
Wie hat sich die Jugendphase zeitlich verschoben?
Studien zeigen, dass der Eintritt in das Erwachsenenalter (Beruf, eigener Haushalt) heute wesentlich später erfolgt als in den 1950er Jahren, was zu einer verlängerten Jugendphase führt.
Was ist der Unterschied zwischen defensiver und offensiver Geschlechtsdarstellung?
Defensiv bedeutet, sich strikt an gesellschaftliche Normen anzupassen (z.B. durch kosmetische Eingriffe), während offensiv bedeutet, die eigene Identität so zu zeigen, wie man sich wohlfühlt.
- Arbeit zitieren
- Melanie Johannsen (Autor:in), 2008, Aufklärung in zwei Dekaden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202422