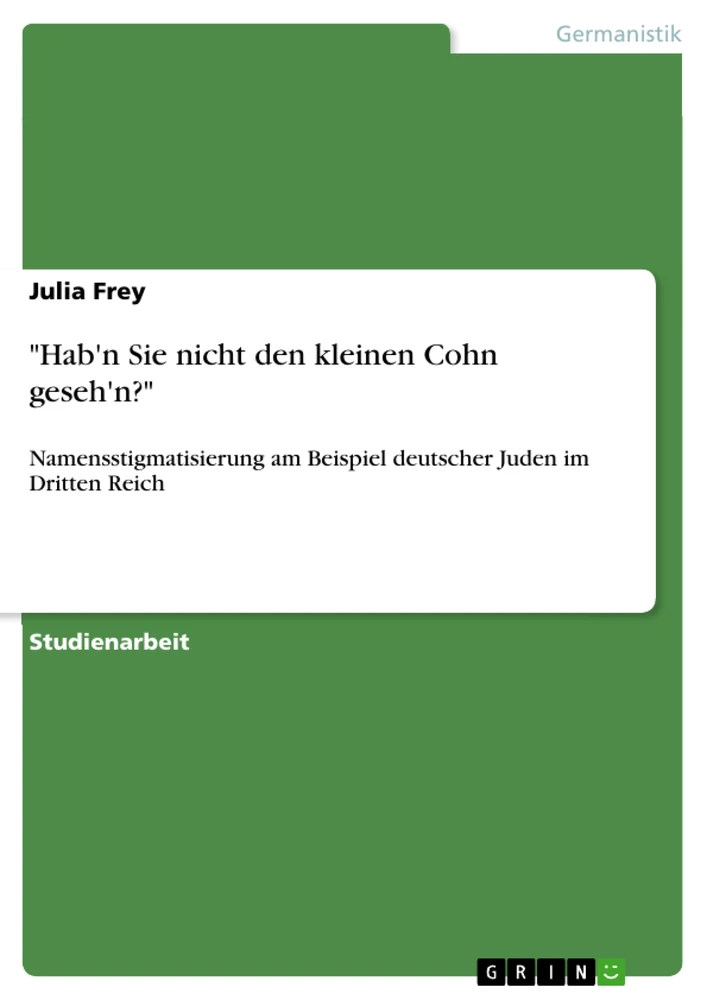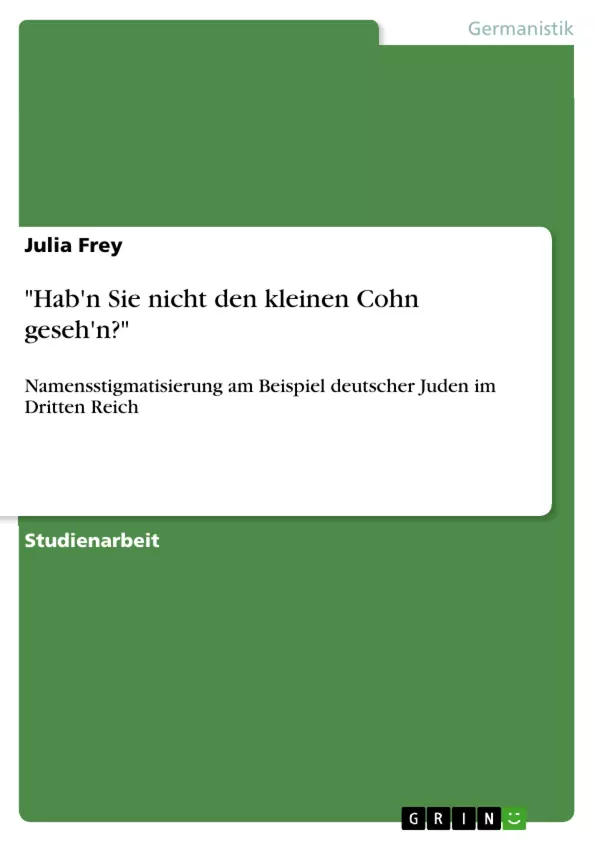Antisemitische Namenpolemik hat in Deutschland eine lange Tradition. Seit dem frühen 19. Jahrhundert sorgten mündlich überlieferte, in antisemitischen Propagandazeitschriften, oder auf Postkarten bzw. Plakaten verbreitete Witze, Karikaturen und Spottlieder, wie das Lied vom „kleine(n) Cohn“, für Diffamierung und somit oft zur Ausgrenzung jüdischer Namensträger. Hierin, dann in der Entfernung aus dem Hotel, der Straße, dem Dorf, aus dem Land und schließlich in ihrer physischen Auslöschung, lag die Lösung für alle – natürlich von den Juden verursachten - Probleme in Deutschland. Diese Ausgrenzung versuchte man, ab dem frühen 19. Jahrhundert zaghaft und seit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten dann konsequenter, auch auf ihre Namen anzuwenden, um eine Vermischung mit „deutschem Namensgut“ zukünftig zu vermeiden.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Phänomen „Name“
- 2.1. Zum Begriff
- 2.2. Die linguistische Struktur von Namen
- 2.3. „Guten Tag, Cohn mein Name“
- 3. Ein Vergleich...
- 3.1. Die Namen der Deutschen
- 3.1.1. Rufnamen
- 3.1.2. Familiennamen
- 3.2. Die Namen der Juden
- 3.2.1. Rufnamen
- 3.2.2. Familiennamen
- 4. Stigmatisierung und Namenpolemik.......
- 4.1. Begriffsklärung
- 4.2. Wie Stigmatisierung funktioniert
- 4.3. Folgen der Namenpolemik
- 4.4. Namenpolitik im 3. Reich
- 5. Resümee.....
- Die Entwicklung und Struktur von deutschen und jüdischen Namen
- Die Rolle der Namenpolemik in der antisemitischen Propaganda
- Die Auswirkungen der Stigmatisierung auf das Selbstbild jüdischer Menschen
- Die Bedeutung der Namensgebung im Kontext der NS-Ideologie
- Die linguistischen und gesellschaftlichen Aspekte der Namensgebung und deren Manipulation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stigmatisierung jüdischer Namen im Dritten Reich und analysiert, wie die Benennung zur Ausgrenzung und Herabsetzung von Juden eingesetzt wurde. Sie setzt sich zum Ziel, die Funktionsweise der Namenpolemik zu beleuchten und deren Auswirkungen auf die jüdische Identität im Kontext der NS-Ideologie zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die historische Entwicklung der antisemitischen Namenpolemik in Deutschland dar und führt in das Thema der Stigmatisierung jüdischer Namen ein. Im zweiten Kapitel wird das Phänomen „Name“ aus linguistischer und gesellschaftlicher Sicht beleuchtet und seine Verbindung zur Identität des Trägers untersucht. Kapitel drei bietet einen Vergleich zwischen deutschen und jüdischen Namen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und die Konstruktion von „jüdischen Namen“ im Rahmen der antisemitischen Ideologie zu analysieren. Das vierte Kapitel definiert den Begriff „Stigmatisierung“ und untersucht die Mechanismen der Namenpolemik, ihre Auswirkungen und die Rolle der NS-Namenpolitik.
Schlüsselwörter
Antisemitische Namenpolemik, Stigmatisierung, Namenpolitik, Identität, Namensgebung, jüdische Namen, deutsche Namen, Rassenideologie, Dritte Reich, Propaganda, Ausgrenzung, Herabsetzung, Sprachwandel, Linguistik, Sozialpsychologie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter antisemitischer Namenpolemik?
Es ist die gezielte Diffamierung und Stigmatisierung jüdischer Menschen durch Witze, Spottlieder (wie "Der kleine Cohn") oder Karikaturen, die ihre Namen ins Lächerliche ziehen.
Wie funktionierte die Namenpolitik im Dritten Reich?
Die Nationalsozialisten zwangen Juden ab 1938, zusätzliche Vornamen wie "Israel" oder "Sara" anzunehmen, um sie eindeutig zu kennzeichnen und auszugrenzen.
Warum wurden jüdische Namen stigmatisiert?
Ziel war es, eine Vermischung mit "deutschem Namensgut" zu verhindern und die Betroffenen durch sprachliche Markierung gesellschaftlich zu isolieren.
Welche linguistischen Unterschiede gibt es zwischen jüdischen und deutschen Namen?
Die Arbeit vergleicht die Struktur von Ruf- und Familiennamen und zeigt auf, wie bestimmte Namen erst durch antisemitische Propaganda als "typisch jüdisch" konstruiert wurden.
Was waren die Folgen dieser Stigmatisierung für die Betroffenen?
Die Namenpolemik führte zur psychischen Belastung, zum Identitätsverlust und war oft der erste Schritt zur physischen Auslöschung während des Holocausts.
- Quote paper
- Julia Frey (Author), 2012, "Hab'n Sie nicht den kleinen Cohn geseh'n?", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202455