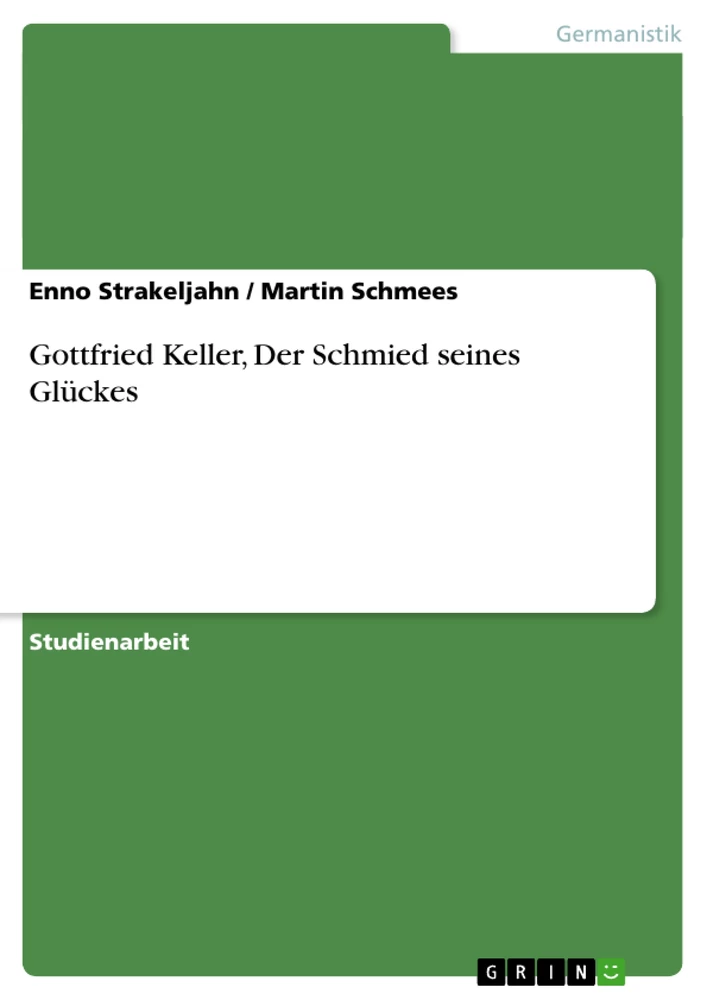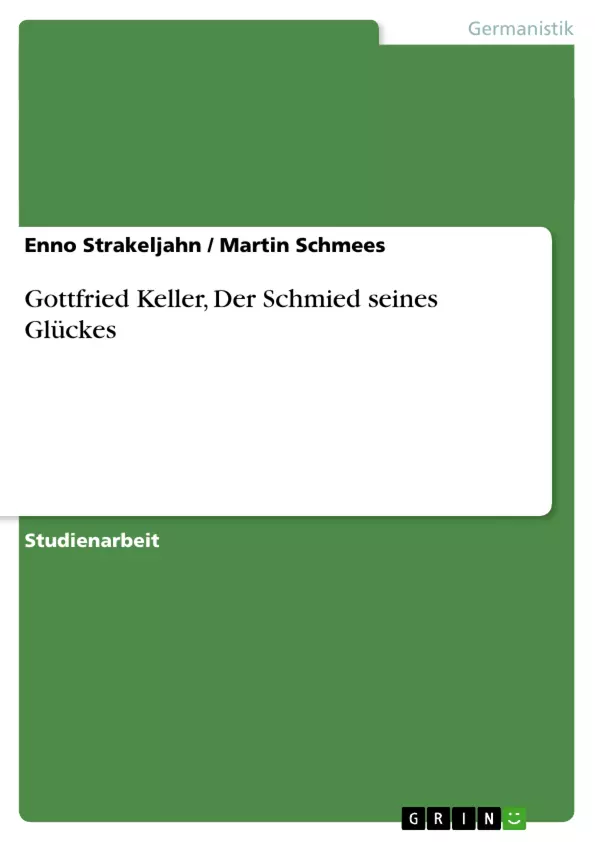Unmittelbar nach Fertigstellung (1856) der ersten fünf Seldwyler Geschichten schließt Keller einen Vertrag mit dem Braunschweiger Verleger Eduard Vieweg, um die "Leute von Seldwyla" fortzusetzen. Aufgrund von Kellers Tätigkeit als Staatsschreiber vergehen mehrere Jahre bis zur Vollendung seines Werkes. Der Schmied seines Glückes entsteht 1865 in erster Fassung. 1873 veröffentlicht Keller eine überarbeitete Version bei seinem neuen Verleger Weibert in Stuttgart. Das Originalmanuskript war bei seinem alten Verleger nach Vertragsauflösung nicht mehr auffindbar, als Basis für die Überarbeitung diente Keller eine Urfassung, welche er seinem Freund Adolf Exner geschenkt hatte.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung und zeitliche Einordnung
- Herkunft des Sprichwortes „Jeder ist seines Glückes Schmied“
- Textreproduktion
- Analyse
- Die Charaktere Kabis und Litumlei
- Frauenbild und Frauengestalten in der Schmied seines Glückes: Johanna Häuptle, Frau Olivia, Dame Litumlei
- Das Groteske in Gottfried Kellers „Der Schmied Seines Glückes“
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Novelle „Der Schmied Seines Glückes“ von Gottfried Keller erzählt die Geschichte von John Kabys, einem Seldwyler Bürger, der durch seine Fixierung auf den eigenen Erfolg und seine naive Interpretation des Sprichworts „Jeder ist seines Glückes Schmied“ in eine Reihe grotesker und absurder Situationen gerät. Kellers Werk zeichnet ein humorvolles Bild des menschlichen Strebens nach Glück und Erfolg und hinterfragt die Mechanismen der sozialen und kulturellen Ordnung in der Seldwylaer Gesellschaft.
- Die Ironie des Sprichworts „Jeder ist seines Glückes Schmied“
- Das Streben nach sozialem Aufstieg und die Rolle des Namens
- Die grotesken und absurden Charaktere und ihre Motivationen
- Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft
- Die Rolle des Zufalls und der Lebenslügen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Novelle beginnt mit der Einführung von John Kabys, der durch seinen ungewöhnlichen Namen und seinen Hang zu „Meisterstreichen“ versucht, sich von seinen Mitmenschen abzuheben. Kellers ironische Darstellung von Johns naiver Selbstüberschätzung und seinem Streben nach sozialem Aufstieg ist prägnant und humorvoll.
John begegnet Fräulein Olivia, deren Name ihm zu einem „wohlklingenden“ Doppelnamen verhelfen soll. Diese Begegnung führt jedoch zu einer Reihe von Missverständnissen, die Johns vermeintliches Glück schnell in ein Chaos verwandeln.
Nachdem Johns naive Pläne gescheitert sind, sucht er in Augsburg nach einem reichen Verwandten, der ihm zu Reichtum und Ruhm verhelfen soll. Er begegnet Adam Litumlei, einem alten, exzentrischen Mann, der John mit seinen Lebenslügen und Manipulationen in ein kompliziertes Spiel verwickelt.
John versucht, sich in Litumleis Welt einzupassen und seinen Namen anzunehmen, um an dessen Reichtum und Einfluss teilzuhaben. Dieser Schritt führt zu neuen Konflikten und stellt Johns bisherige Lebenslügen in Frage.
Die Geschichte von John Kabys führt den Leser durch eine Reihe von grotesken und absurden Situationen, die jedoch immer wieder den Kern der menschlichen Schwächen und Sehnsüchte aufzeigen. Kellers humorvoller Schreibstil und die ironische Darstellung des Strebens nach Glück und Erfolg machen „Der Schmied Seines Glückes“ zu einer vielschichtigen und bis heute relevanten Lektüre.
Schlüsselwörter
Die Novelle „Der Schmied Seines Glückes“ thematisiert wichtige Schlüsselbegriffe wie soziale Ordnung, Name und Identität, Streben nach Glück, Lebenslügen und Manipulation, Ironie und Groteske. Keller beleuchtet die Ambivalenz des Sprichworts „Jeder ist seines Glückes Schmied“ und zeigt die Grenzen und Widersprüche der sozialen und kulturellen Ordnung auf.
- Arbeit zitieren
- Enno Strakeljahn (Autor:in), Martin Schmees (Autor:in), 2003, Gottfried Keller, Der Schmied seines Glückes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20253