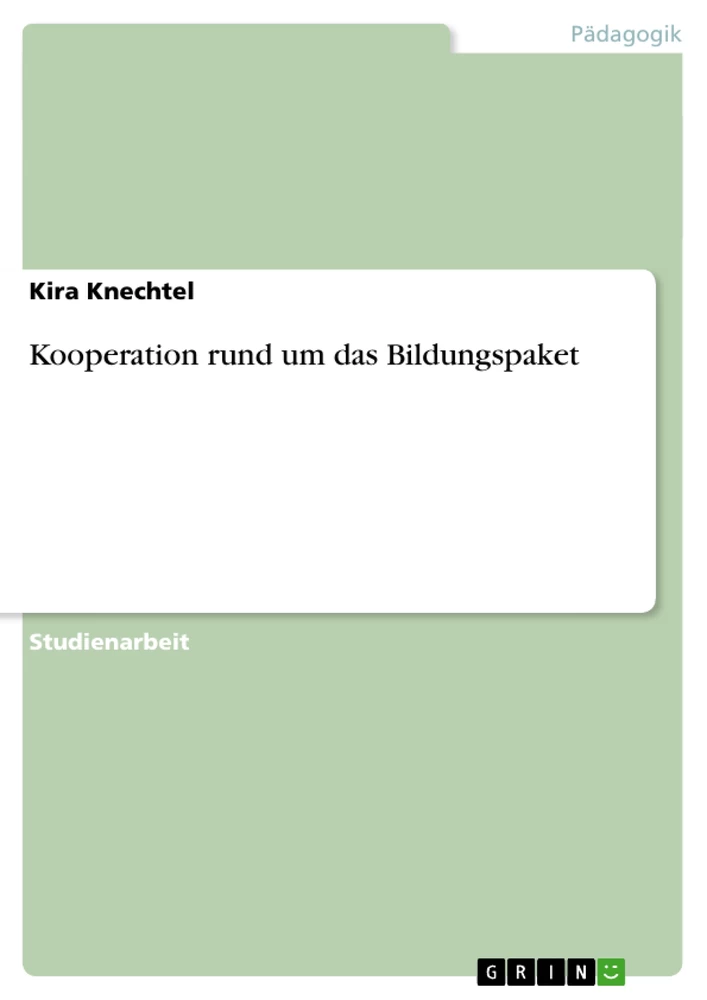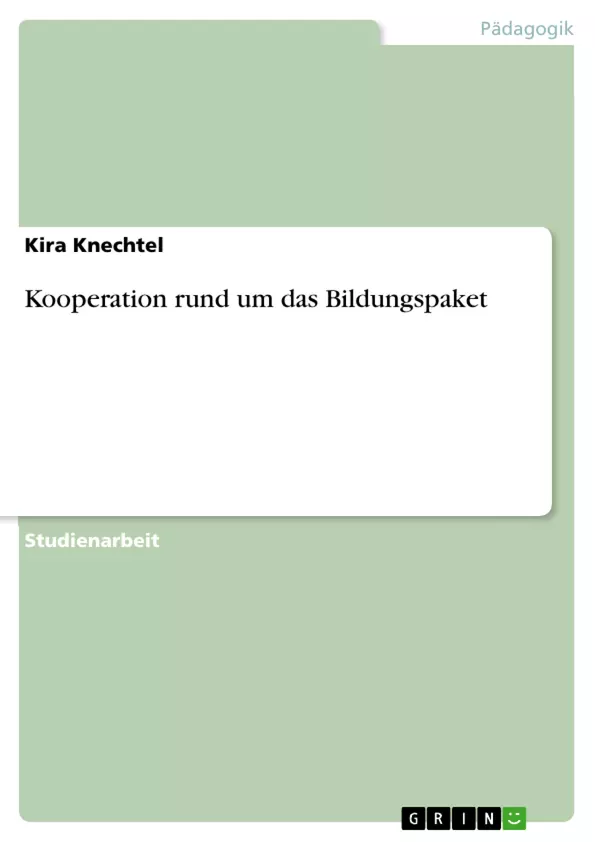Die Arbeitslosenquote in der Bundesrepublik Deutschland betrug im letzten Jahre 8,6 % (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2011). Zwar ist die Arbeitslosigkeit in den Jahren von 2009 auf 2010 nicht gestiegen, doch ist die Problematik und Struktur der Arbeitslosigkeit komplex und hat sich verändert.
Häufig haben die Betroffenen mit multiplen Problemen, wie z.B. Verlust sozialer Kompetenzen und Verschuldung sowie mit psychosozialen Problemen zu kämpfen (vgl. Evers, Schulz 2003, S.23). Ein wichtiges Mittel gegen Armut ist primär die Erwerbstätigkeit, jedoch reicht es nicht aus, dem Arbeitslosen lediglich eine Stelle anzubieten. Auch schützt nicht jede Arbeit vor Armut, wie bspw. das Einkommen aus Minijobs.
Sowohl Erwerbstätige, als auch Arbeitslose müssen sich oft weiterqualifizieren, um eine bessere Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Eine Weiterbildung erfordert für Familien allerdings eine Betreuungsstelle für ihre Kinder. Diese ist für Arbeitslose häufig finanziell nicht möglich. Daher erweist sich eine Wiedereingliederung für Arbeitslose und besonders für Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft als äußerst schwierig.
Allerdings sind von Arbeitslosigkeit nicht nur Erwachsene betroffen. Vor allem sind Kinder die Leidtragenden, die in Armut aufwachsen und durch den sozialen Ausschluss, wie bspw. aus der Klassengemeinschaft leiden. Die finanzielle Situation wird meist als Grund für die Nichtteilnahme an Ausflügen, schulischen und außerschulischen Aktivitäten oder die Nichtmitgliedschaft in Vereinen angegeben. Den Kindern fehlen gefestigte Verhältnisse und eine gesellschaftliche Anerkennung sowie ein geregelter Ablauf im Alltag.
Die geschilderte Problematik wird in der vorliegenden Ausarbeitung aufgegriffen und im Zusammenhang mit dem Bildungspaket thematisiert. Im ersten Schritt wird der Begriff Armut definiert. Hierzu wird ein Überblick gegeben, welche Lebensbereiche von Armut betroffen sind und wie die Alltagsversorgung dadurch eingeschränkt ist. Speziell für Kinder und Jugendlichen in prekären Lebenslagen wurde das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) konzipiert. Dazu werden unter Punkt 3 das Bildungspaket näher erläutert und die beispielhafte Umsetzung der Kommune Fürth dargestellt. Im nächsten Abschnitt wird eine kritische Auseinandersetzung des Billdungspaketes bezüglich der Konzeption und der Realisierung vorgenommen. Im Fazit erfolgt eine zusammenfassende Schlussbetrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Problemstellung
- Theoretische Grundlagen
- Definition Armut nach dem Einkommensansatz
- Definition Armut nach dem Lebenslagenansatz
- Das Bildungspaket
- Beispielhafte Umsetzung der Stadt Fürth
- Kritische Betrachtung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Referatsausarbeitung analysiert die Problematik der Armut und die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche in Deutschland. Dabei wird das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) als ein Instrument zur Bekämpfung der Armut und zur Förderung von Teilhabe vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Armut, die Herausforderungen der Umsetzung des Bildungspaketes und die Bedeutung von Kooperation und Fallmanagement in der Praxis.
- Definition von Armut und deren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche
- Das Bildungs- und Teilhabepaket des BMAS
- Kooperation und Fallmanagement als wichtige Instrumente der Armutsbekämpfung
- Kritische Betrachtung der Umsetzung des Bildungspaketes
- Zukünftige Herausforderungen und Handlungsbedarf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Ausarbeitung beginnt mit einer Definition von Armut, wobei sowohl der Einkommensansatz als auch der Lebenslagenansatz berücksichtigt werden. Es wird deutlich, dass Armut nicht nur materielle, sondern auch soziale, kulturelle und psychische Folgen für Betroffene hat. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen von Armut auf Kinder und Jugendliche.
Im nächsten Kapitel wird das Bildungs- und Teilhabepaket des BMAS vorgestellt. Es soll Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien die Teilhabe an Bildung, Kultur, Sport und Freizeit ermöglichen. Das Beispiel der Stadt Fürth zeigt, dass eine erfolgreiche Umsetzung des Bildungspaketes auf einer engen Zusammenarbeit verschiedener Institutionen und Akteure beruht.
Im dritten Kapitel wird eine kritische Betrachtung des Bildungspaketes vorgenommen. Es werden die Herausforderungen der Umsetzung, die Bedeutung von Kooperation und Fallmanagement sowie die Notwendigkeit eines bedarfsgerechten Ausbaus von Kinderbetreuungseinrichtungen hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Armut, Bildungspaket, Kooperation, Fallmanagement, Kinder und Jugendliche, Teilhabe, soziale Benachteiligung, Arbeitslosigkeit, Bildungsarmut, Lebenslagenansatz, Einkommensarmut, Integration, Sozialpolitik, Kommune, Hartz-IV, Sozialgesetzbuch XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Kinderzuschlag, Wohngeld, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Jugendhilfe, Familienförderung, Wiedereingliederung, Arbeitsmarkt, Bildung, Kultur, Sport, Freizeit, Ganztagsschule, Nachhilfe, Transferleistungen, Stigmatisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT)?
Das Paket soll Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme an Bildung, Kultur, Sport und Freizeit ermöglichen, um soziale Ausgrenzung zu verhindern.
Was unterscheidet den Einkommensansatz vom Lebenslagenansatz bei Armut?
Der Einkommensansatz definiert Armut rein über finanzielle Mittel, während der Lebenslagenansatz auch soziale, kulturelle und psychische Faktoren sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einbezieht.
Warum ist Kooperation bei der Umsetzung des Bildungspakets wichtig?
Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert die Zusammenarbeit von Kommunen, Schulen, Vereinen und Jobcentern, um die Leistungen effektiv bei den Kindern ankommen zu lassen.
Welche Kritik gibt es am Bildungspaket?
Kritisiert werden oft die bürokratischen Hürden bei der Beantragung, die mögliche Stigmatisierung der Empfänger sowie eine unzureichende Bekanntheit der Angebote.
Wer hat Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungspaket?
Anspruchsberechtigt sind in der Regel Familien, die Arbeitslosengeld II (Hartz IV), Sozialhilfe, Wohngeld, den Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.
- Arbeit zitieren
- B.sc Kira Knechtel (Autor:in), 2012, Kooperation rund um das Bildungspaket, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202673