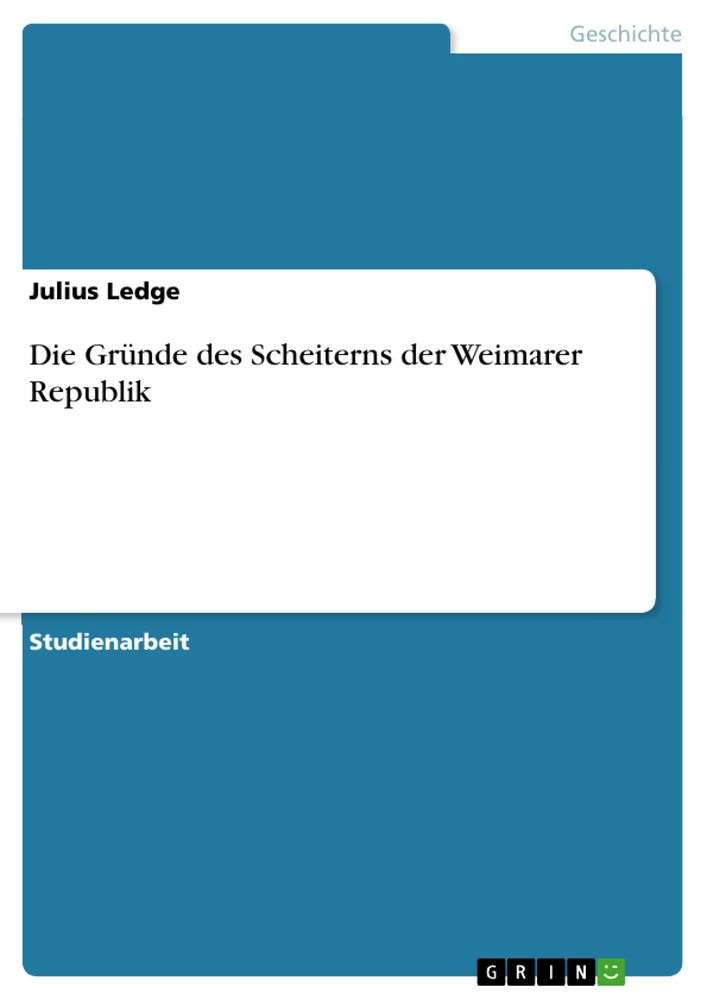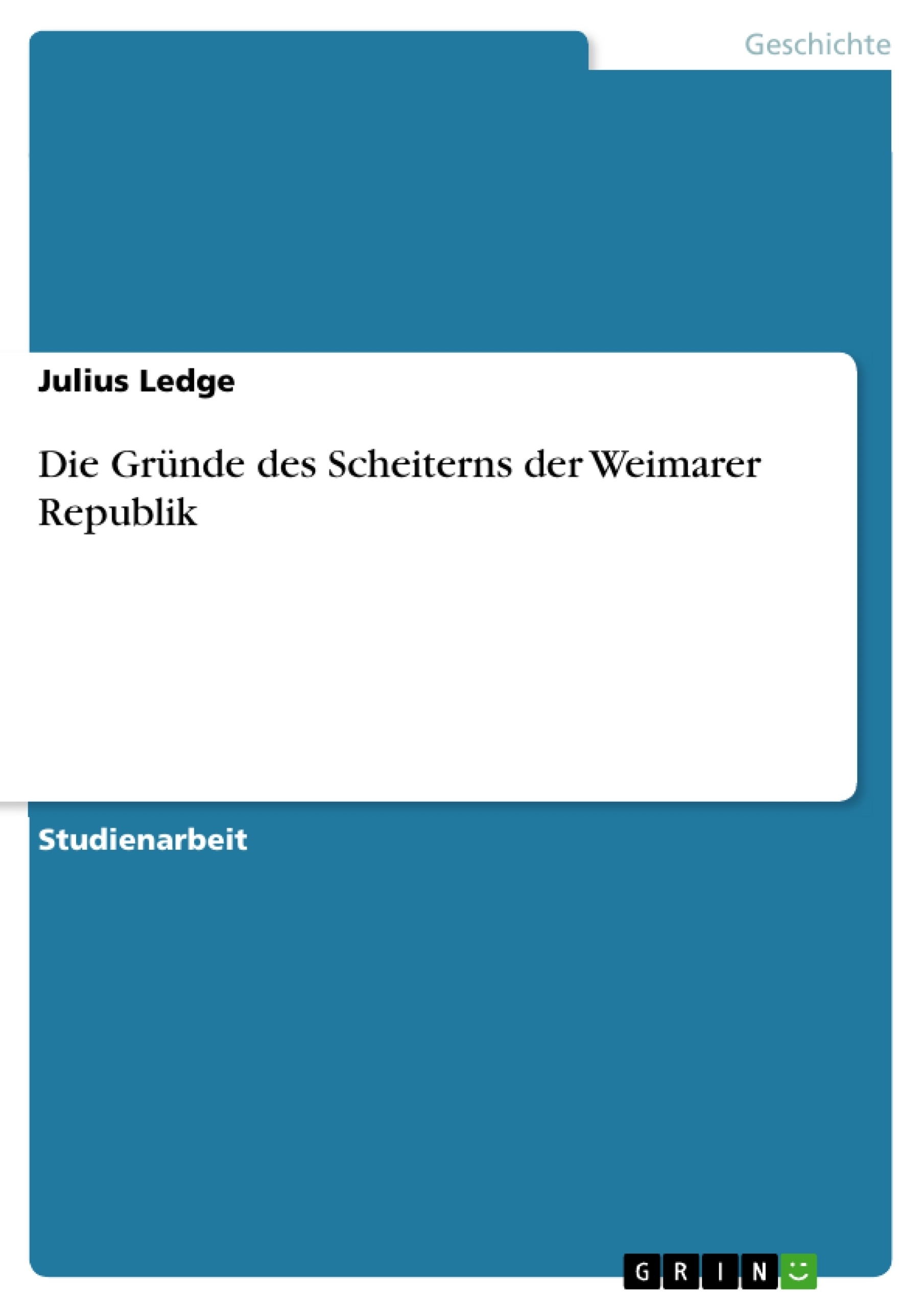Am Ende des Ersten Weltkrieges wandelte sich Deutschland zur Republik. Der Kaiser, als Symbol des alten Reiches war zurückgetreten, die politische Führung übernahm nun eine parlamentarische Regierung. Wer aber in Deutschland auf eine Stabilisierung durch die neue Demokratie gehofft hatte, sah sich getäuscht.
Auch weiterhin übten die alten Eliten des Kaiserreiches einen großen Einfluss aus, sodass in den Mentalitäten, den Strukturen und den Institutionen der Weimarer Republik ein bemerkenswertes Beharrungsvermögen zu erkennen war. So hatten die meisten Parteien ihre Ideologie von ihren unmittelbaren Vorgängern der Monarchie übernommen. Aber auch Vertreter der Wirtschaft, des Militärs, der Justiz und der Verwaltung blieben nach der Staatserneuerung in ihren Ämtern. Damit kommt leicht die Frage auf, wo denn in der Republik die Republikaner waren? Noch deutlicher kann diese Frage mit der Wahl Paul von Hindenburgs zum Reichspräsidenten unterstrichen werden. Denn damit war der oberste Mann im Staat ein Repräsentant der Kaiserzeit, welcher ein erklärter Republikfeind war.
Durch die materiellen und sozialen Belastungen, die durch zahlreiche ökonomische Krisen gefördert wurden, kam es zu einer Polarisierung der Gesellschaft. Das Freund-Feind Denken spaltete die politischen Lager so weit auf, dass Kompromisse oftmals unmöglich wurden. Die Konflikte zwischen den politischen Richtungen entluden sich immer wieder in Gewaltausbrüchen, bis hin zu Umsturzversuchen. Die junge Republik wurde so zu jedermanns „Vorbehaltsrepublik“. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das antidemokratische Denken
2.1. Sichtweise der Bevölkerung
2.2. In der Politik
3. Der Versailler Vertrag
3.1. Interessenslage der Hauptsiegermächte
3.2. Kernpunkte und Folgen des Versailler Vertrages
4. Die ökonomische Krise
4.1. Hyperinflation
4.2. Weltwirtschaftskrise
4.3. Massenarbeitslosigkeit
5. Die innenpolitischen Unruhen
5.1. Strukturschwäche der politischen Ordnung
5.2. Die Spaltung der Arbeiterbewegung
6. Der Aufstieg der NSDAP
7. Fazit
8. Auswahlbibliographie
9. Anhang
- Arbeit zitieren
- Julius Ledge (Autor:in), 2010, Die Gründe des Scheiterns der Weimarer Republik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202694