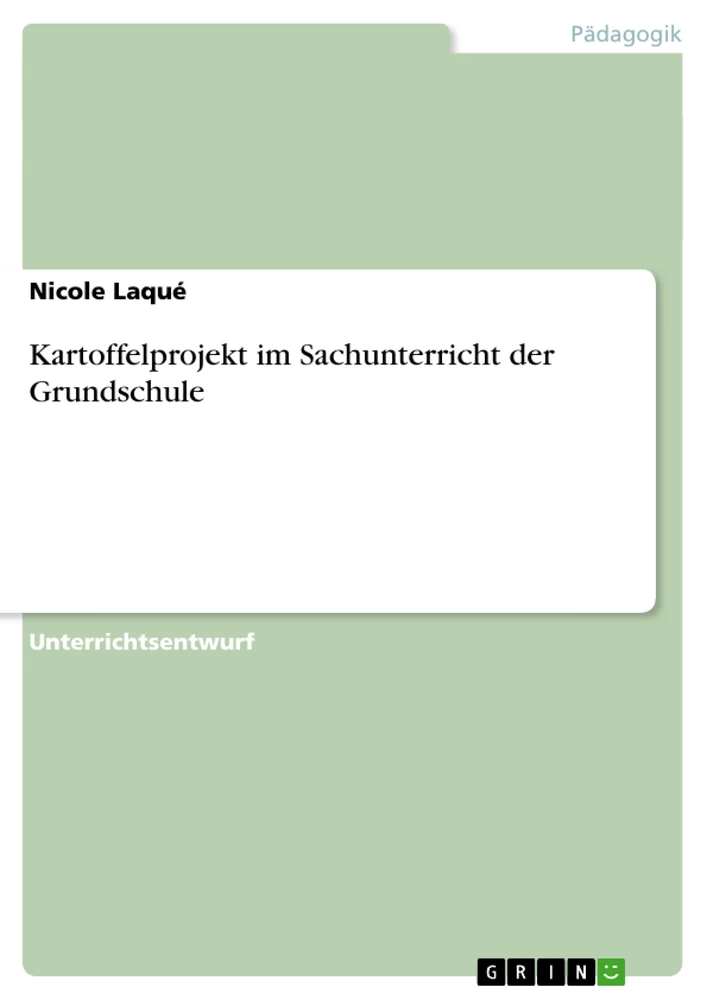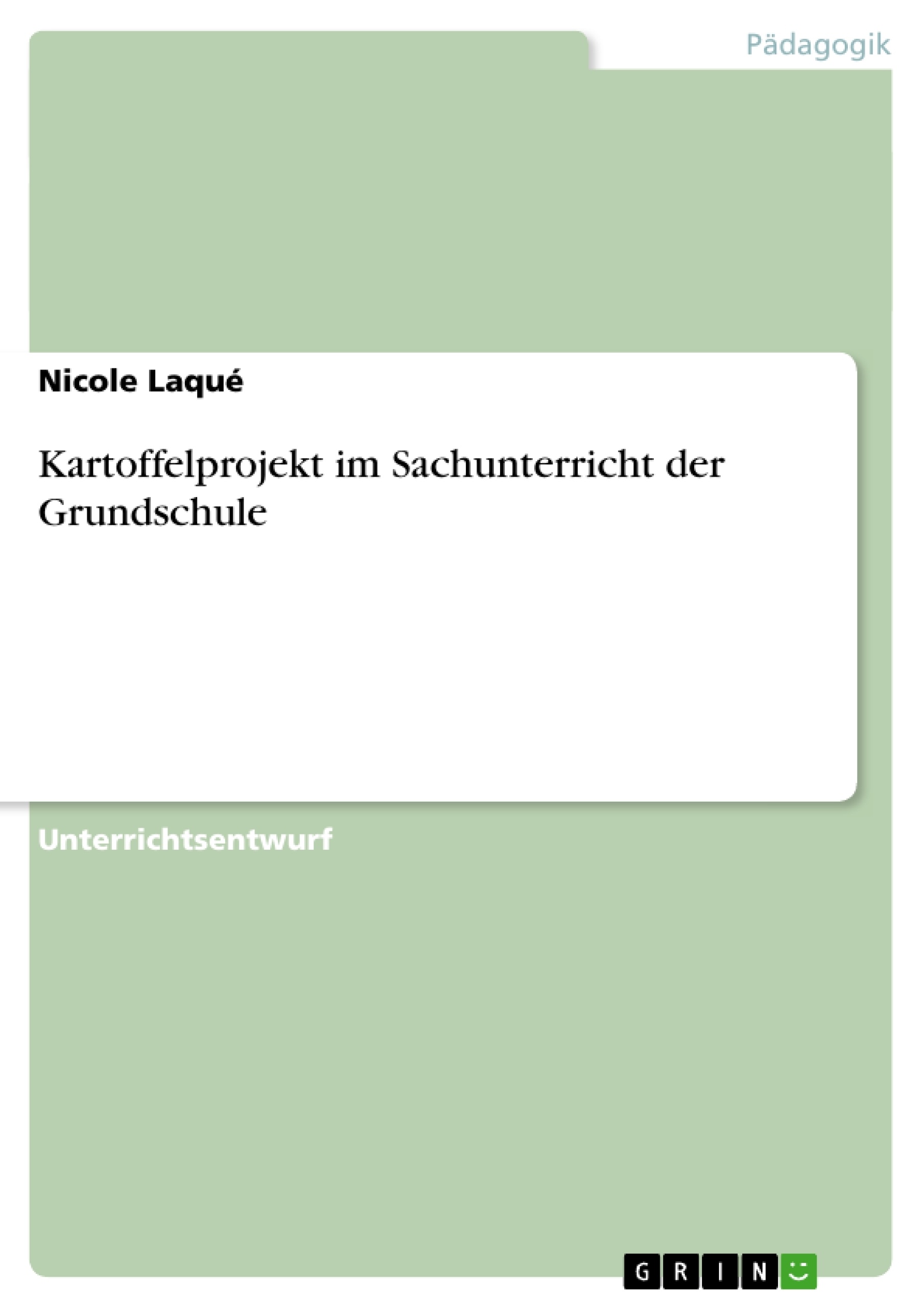Allgemeines:
,,Die Kartoffel (Solanum tuberosum L.) gehört, wie die Tomate, Tollkirsche, Tabak
u.a. zur Familie der Nachtschatte ngewächse.“ (Springer, S.17),, Der
wissenschaftliche Name Solanum für Nachtschatten stammt aus dem Lateinischen
und bedeutet Trost oder Beruhigung. Alle Nachtschattengewächse enthalten in
unterschiedlicher Menge das Gift Solanin oder Atropin, das bei uns zu
Schweißausbrüchen, Durchfall und Krämpfen, ja sogar zum Tod durch Atemlähmung
führen kann.“( Fischer-Nagel, S.14) Bei der Kartoffel sind, die grünen Beeren
(Kartoffeläpfel) und die vom Sonnenlicht getroffenen ergrünten Knollen, die giftigen
Teile.
Die Kartoffel ist ein besonders wertvolles Grundnahrungsmittel, da sie alle
Bestandteile enthält, die wir für unsere Ernährung brauchen. Sie enthält unter
anderem hochwertiges Eiweiß, Vitamine, Stärke, Mineralien und Spurenelemente.
,,Schon zwei Kartoffeln entha lten so viele Vitamine, wie ein Erwachsener pro Tag
braucht“ ( Fischer-Nagel, S.22)
Geschichte:
Die Geschichte der Kartoffel beginnt nicht, wie oft erwartet, in Europa, sondern in
Peru, dem Land der Inkas. Dort wachsen viele verschiedene Wildkartoffelarte n. Als
vor etwa 500 Jahren spanische Eroberer in das Land kamen, lernten sie diese
fremdartige Frucht kennen und brachten sie nach Europa. Von Spanien aus kam die
neu entdeckte Knolle ca. Ende des 16. Jahrhunderts nach Deutschland. Sie wurde
damals wegen ihrer schönen Blüten hauptsächlich als Zierpflanze in den Gärten der
Adligen angebaut. ,,Es waren die Reichen, die Könige und Kaiser, die den Wert der
Kartoffel als Nahrungsmittel zuerst erkannten und viel Mühe darauf verwendeten, die
oft hungernde Bevölkerung vom Nutzen der Pflanze zu überzeugen.“ (Fischer-Nagel,
S.11) Für die Menschen war diese Knolle fremd und eigenartig. Sie merkten schnell,
dass die Kartoffel im rohen Zustand ungenießbar war und konnten sich so nicht mit
ihr anfreunden. Erst König Friedrich II, auch bekannt als der, Alte Fritz“, gelang es mit
einer List die Bauern für die Kartoffel zu interessieren: Er ließ Kartoffelfelder zum
Schein streng bewachen. Die neugierigen Bauern schlichen nachts auf die Felder und wollten wissen, was es dort wertvolles gäbe. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Sachanalyse
- Methodische Analyse
- Didaktische Analyse
- Begründung der Lernaufgabe
- Bedeutsamkeit der Unterrichtinhalte für die Schüler
- Stellung des Unterrichts im größeren Zusammenhang
- Voraussetzungen für den Unterricht
- Innere Voraussetzungen (Voraussetzungen bei den Schülern)
- Äußere Voraussetzungen
- Lernziele
- Grobziele
- Feinziele
- Überlegungen zur Unterrichtsmethodik
- Einstiegsmöglichkeiten
- Artikulation
- Sozial- und Aktionsformen
- Medien
- Unterrichtsprinzipien
- Geplanter Unterrichtsverlauf
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text dient als Planungshilfe für ein Projekt im Sachunterricht zum Thema „Die Kartoffel“. Es soll den Schülern ein umfassendes Verständnis der Kartoffel als Nahrungsmittel und Kulturpflanze vermitteln. Das Projekt zielt darauf ab, die Schüler aktiv in den Lernprozess einzubeziehen und sie zu befähigen, selbstständig zu forschen, zu lernen und zu präsentieren.
- Die Kartoffel als Kulturpflanze und ihre Bedeutung für die Ernährung
- Die Geschichte der Kartoffel und ihre Verbreitung
- Wachstum und Vermehrung der Kartoffelpflanze
- Die Bedeutung des Projektarbeitens im Unterricht
- Die Integration verschiedener Fächer und Lernformen im Projekt
Zusammenfassung der Kapitel
Sachanalyse
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Kartoffel als Pflanze. Es werden wichtige botanische Informationen sowie die Geschichte und Bedeutung der Kartoffel als Nahrungsmittel und Kulturpflanze erläutert. Dabei werden auch die giftigen Bestandteile der Kartoffel und die Bedrohung durch den Kartoffelkäfer beleuchtet.
Methodische Analyse
Dieses Kapitel analysiert die Vorteile des Projektarbeitens im Unterricht. Es werden Gründe für die steigende Bedeutung des projektorientierten Lernens erläutert, die sich aus den veränderten Bedürfnissen der Schüler und der Schule ergeben. Zudem werden die Vorteile für Schüler und Lehrer sowie die Möglichkeiten der fächerübergreifenden Arbeit hervorgehoben.
Didaktische Analyse
Das Kapitel konzentriert sich auf die Begründung der Lernaufgabe, die Bedeutung der Unterrichtinhalte für die Schüler und die Stellung des Unterrichts im größeren Zusammenhang. Hier werden die Lernziele des Projekts definiert und die didaktischen Überlegungen zur Gestaltung des Unterrichts dargelegt.
Voraussetzungen für den Unterricht
Dieses Kapitel behandelt sowohl die inneren als auch die äußeren Voraussetzungen für den Unterricht. Es werden die notwendigen Kompetenzen der Schüler und die verfügbaren Ressourcen und Materialien für das Projekt betrachtet.
Lernziele
Hier werden die Grob- und Feinziele des Projekts definiert. Es wird dargelegt, welche Kompetenzen die Schüler durch das Projekt erwerben sollen.
Überlegungen zur Unterrichtsmethodik
Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen methodischen Aspekten des Projekts, wie z.B. Einstiegsmöglichkeiten, Artikulation, Sozial- und Aktionsformen, Medien und Unterrichtsprinzipien. Es werden Vorschläge zur Gestaltung des Unterrichts und zur Einbeziehung der Schüler in den Lernprozess gemacht.
Geplanter Unterrichtsverlauf
Das Kapitel beschreibt den geplanten Unterrichtsverlauf des Projekts in detaillierter Form. Es werden die einzelnen Phasen des Projekts von der Planung bis zur Präsentation der Ergebnisse dargestellt.
Reflexion
Dieses Kapitel reflektiert die Ergebnisse und den Verlauf des Projekts. Es werden sowohl die Stärken als auch die Schwächen des Projekts analysiert und gegebenenfalls Vorschläge für die zukünftige Umsetzung gemacht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Kartoffel, Sachunterricht, Projekt, Kulturpflanze, Nahrungsmittel, Geschichte, Wachstum, Vermehrung, Kartoffelkäfer, didaktische Analyse, methodische Analyse, Unterrichtsmethodik, Lernziele, Unterrichtsprinzipien, Reflexion.
- Quote paper
- Nicole Laqué (Author), 2002, Kartoffelprojekt im Sachunterricht der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20282