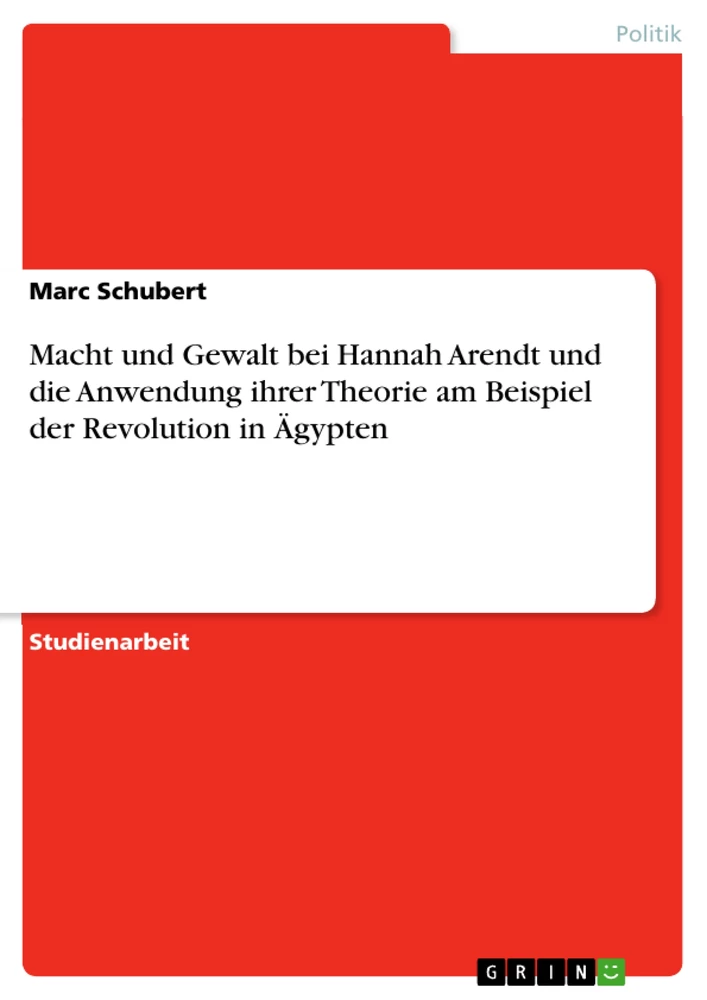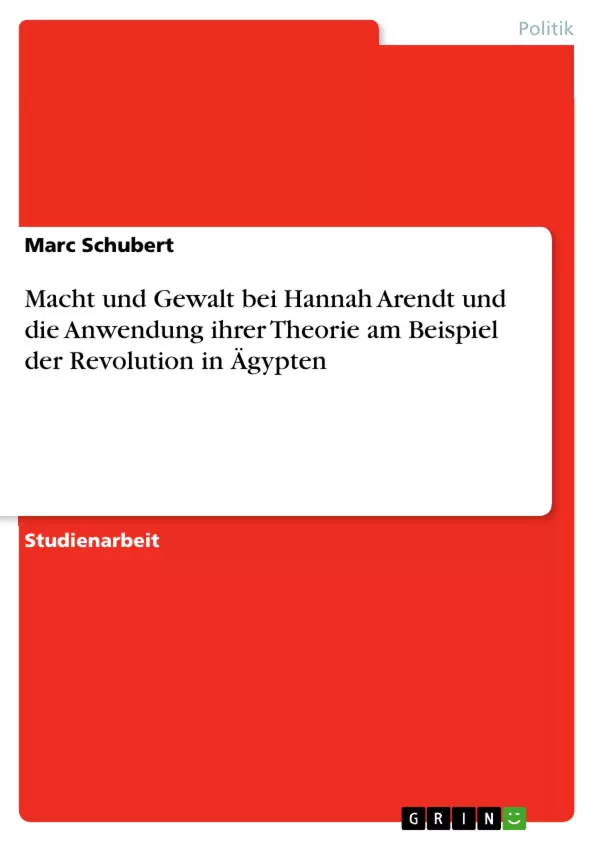„Macht gehört in der Tat zum Wesen aller staatlichen Gemeinwesen, ja aller irgendwie organisierten Gruppen, Gewalt jedoch nicht“ (Arendt 1970: 52).
Hannah Arendt, eine zentrale Denkerin des 20. Jahrhunderts, die selbst durch den Zweiten Weltkrieg und die Studentenbewegung geprägt wurde, differenziert folglich zwischen den Begriffen Macht und Gewalt. Diese Unterscheidung und ihre Definition von Macht sind in der Politischen Theorie jedoch nicht unumstritten:
Unter den Begriffen, mit denen Basisphänomene unserer Gesellschaft bezeichnet werden, ist der Begriff der Macht besonders unklar und kontrovers. Die Vielzahl von Versuchen, Macht genauer und möglichst ultimativ zu bestimmen, hat zu immer neuen Anläufen geführt und bleibt im Ergebnis so unabgeschlossen wie eh und je. (Göhler 2011: 224)
In dieser Hausarbeit soll versucht werden, das theoretische Machtkonzept von Hannah Arendt zu beschreiben und zu analysieren. Diese normative Theorie ist besonders interessant, weil Arendt von einem produktiven und kommunikativen Machtbegriff ausgeht sowie Macht und Gewalt unterscheidet und sie sich damit gegen bereits existierende, repressive Machtbegriffe beispielsweise von Max Weber stellt. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, was passiert, wenn Macht und Gewalt im Rahmen von Revolutionen direkt aufeinandertreffen, wenn Herrscher Macht um jeden Preis, mit aller Gewalt, erhalten wollen – ist die Arendt’sche Theorie in diesem Fall noch anwendbar? Reichen ihre Überlegungen für die Erklärung von zwei praktischen Beispielen aus diesem Kontext aus?
Um diese Fragen zu beantworten, werden in dieser Hausarbeit zunächst die theoretischen Ideen von Hannah Arendt zu den zentralen Begriffen Macht und Gewalt untersucht sowie mit den Auffassungen von anderen bedeutenden Denkern wie Voltaire und Weber verglichen. Anschließend werden diese theoretischen Erkenntnisse auf zwei reelle Beispiele aus dem aktuellen Konflikt in Ägypten, der Teil des Arabischen Frühlings ist und es mittlerweile ausreichend zuverlässige Dokumentationen der Geschehnisse vor Ort gibt, anzuwenden. Anhand dieser Analyse kann kritisch geprüft werden, inwiefern Arendts Überlegungen zutreffen und in welchen Fällen Lücken oder Widersprüche in ihrer Argumentation auftreten. Schließlich werden alle zentralen Erkenntnisse in einem Fazit zusammengefasst, eine abschließende Bewertung des Arendtschen Machtbegriffs vorgenommen und ein Ausblick über offen gebliebene Fragen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
0 Einleitung
1 Theoretische Begrifflichkeiten ihrer Theorie
1.1 Macht und Gewalt im Allgemeinen
1.2 Macht und Gewalt in Bezug auf Revolutionen
2 Anwendung auf zwei praktische Beispiele: Revolution in Ägypten
2.1 Räumung des Tahrir-Platzes in Kairo
2.2 Die Rolle der Anhänger und Unterstützer des Staates und der Herrschenden
3 Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet Hannah Arendt zwischen Macht und Gewalt?
Für Arendt entsteht Macht durch gemeinsames Handeln und Kommunikation, während Gewalt instrumentell ist und oft eingesetzt wird, um schwindende Macht zu ersetzen.
Warum gilt Arendts Machtbegriff als produktiv?
Im Gegensatz zu Max Weber, der Macht als Durchsetzung des eigenen Willens (repressiv) sieht, definiert Arendt Macht als die Fähigkeit, sich mit anderen zusammenzuschließen und gemeinsam etwas Neues zu beginnen.
Wie lässt sich Arendts Theorie auf die Revolution in Ägypten anwenden?
Die Besetzung des Tahrir-Platzes zeigt die Entstehung von Macht durch den Zusammenschluss der Bürger, während die staatliche Reaktion (Räumung) den Einsatz von Gewalt demonstriert.
Kann Gewalt Macht erzeugen?
Nach Arendt kann Gewalt Macht zwar zerstören, aber niemals selbst erzeugen. Wo Gewalt absolut herrscht, verschwindet die Macht.
Welche Rolle spielen Unterstützer des Staates in Arendts Theorie?
Auch ein Herrscher benötigt Macht, die auf dem Rückhalt und der Zustimmung seiner Anhänger basiert; schwindet diese Zustimmung, bleibt nur noch nackte Gewalt übrig.
- Quote paper
- Marc Schubert (Author), 2012, Macht und Gewalt bei Hannah Arendt und die Anwendung ihrer Theorie am Beispiel der Revolution in Ägypten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202830