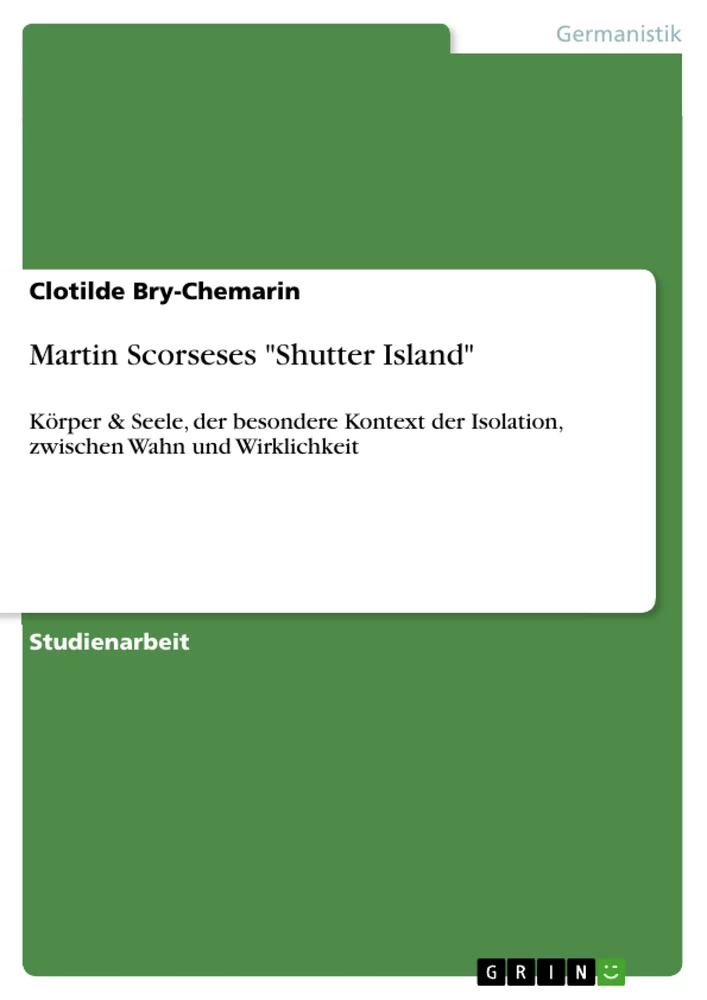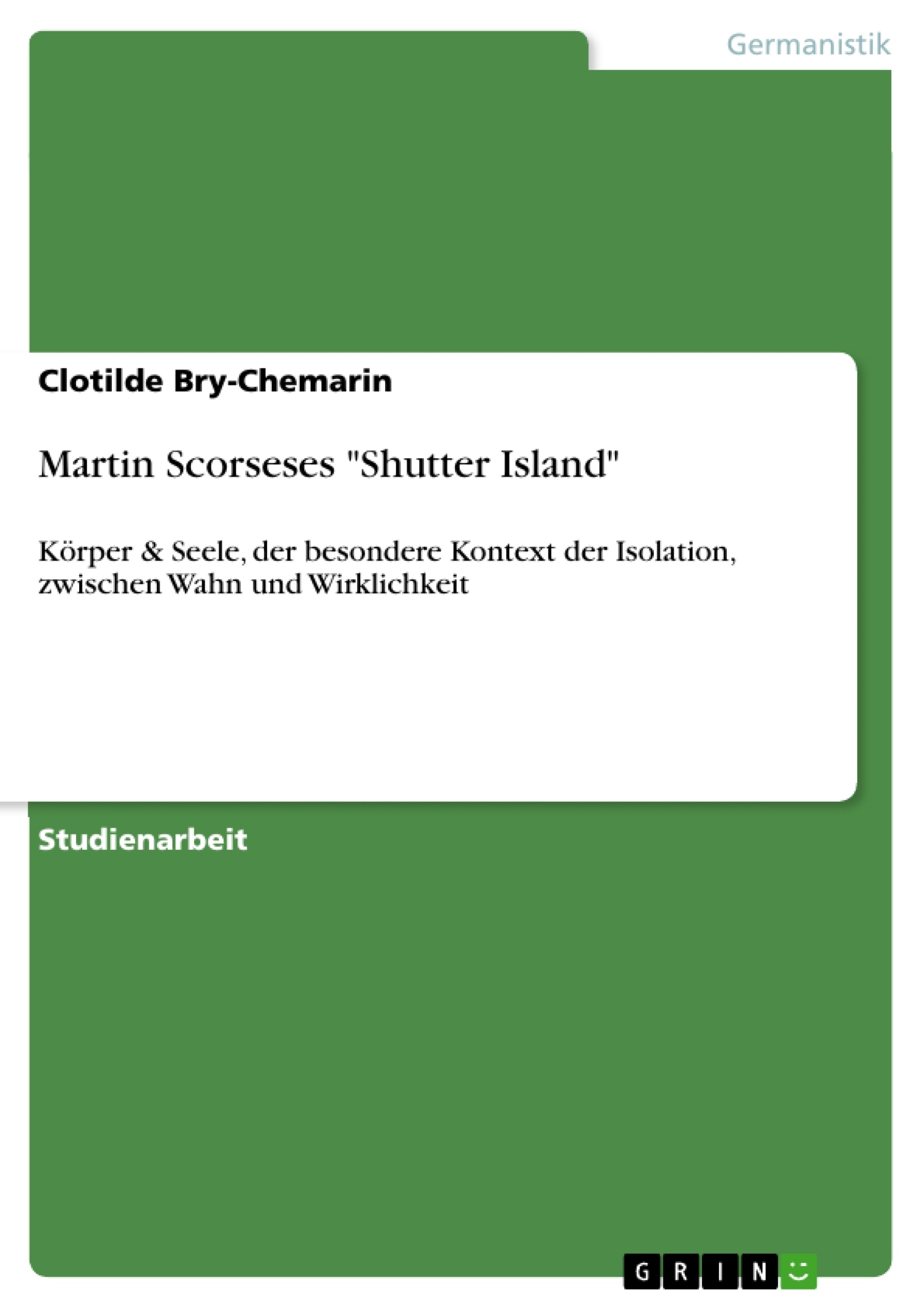Realität, Fiktion und Wahn - Wahrheit oder Lüge. Der schmale Grat zwischen diesen Aspekten wird in Martin Scorseses Film Shutter Island in einer überaus komplexen und vielschichtigen Handlung realisiert.
Wie kann man eine fingierte Realität von einer realen Fiktion unterscheiden? Der schmale Grat zwischen diesen Themen liegt darin, dass in Shutter Island die Grenzen zwischen Realität, Fiktion, Wahn, Wahrheit oder gar Lüge gänzlich verschwimmen.
Komplettiert wird diese Handlung durch den besonderen Kontext der Isolation, der sowohl in dem Kontext des Schauplatzes einer abgelegenen Insel als auch im Zusammenhang mit dem Seelenleben des Protagonisten verwirklicht wird.
In der Romanverfilmung Shutter Island erhält der Zuschauer einen Einblick in das durch Traumata bestimmte Leben des alkoholkranken Protagonisten Teddy Daniels. Die Traumata des Protagonisten haben zweierlei Ursachen: die Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg und der Tod seiner Ehefrau Dolores.
Der Film selbst lässt ich mehrere narrative Fragmente unterteilen, die erst am Ende puzzleartig zur Biografie des Protagonisten zusammengefügt werden und somit ein Gesamtkonstrukt ergeben. So gibt es einerseits das erlebte Jetzt des Protagonisten, dessen Vergangenheit sowie andererseits die Geschichte der Nebenfiguren, u.a. die der flüchtigen Patientin Rachel Solando aus der Klinik.
In den folgenden Ausführungen soll die narrative Komplexität des Films durch die Analyse nachstehender Themen behandelt werden: die Verbindung von Erzählen durch den Körper im Film, der Wahn als ein körperliches und seelisches Phänomen sowie das Wiedererleben von Vergangenem in umgestalteter Form.
Zu diesem Zwecke werde ich auf bestimmte Sequenzen eingehen, die eine Fokussierung auf den Körper aufweisen, um ferner ausgesuchte Aspekte der filmischen Ich-Perspektive zu analysieren. Im weiteren Verlauf werden für eine möglichst differenzierte Untersuchung des Films auf die Fragmentierung der Geschichte, die wechselnde Erzählperspektive und die Irreführung des Zuschauers eingegangen. Hierbei werde ich mich auf bestimmte Elemente beschränken müssen, da eine Untersuchung eines jeden einzelnen Fragments den Rahmen dieser Arbeit bei Weitem sprengen würde. Abschließend werde ich mich intensiver mit ausgewählten psychologischen und medizinischen Gesichtspunkten der psychotischen Symptomatik, und die Frage, wie diese im Film wiedergegeben wird, auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung – Körper und Seele
- Die Darstellung der Körperlichkeit
- Die Fokussierung auf den Körper
- Die Realisierung der filmischen Ich-Perspektive
- Die Seele des Protagonisten im Spiegel des Films
- Fragmentierung als Verwirrungstaktik
- Die Unzuverlässigkeit des Erzählers und die Irreführung des Zuschauers
- Das Zusammenspiel von Körper, Seele und Isolation
- Die subjektive Wahrnehmung des Protagonisten
- Die Darstellung einer psychotischen Symptomatik und Schizophrenie im Film Shutter Island
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Martin Scorseses Film "Shutter Island" unter Berücksichtigung der komplexen Interaktion von Körper, Seele und Isolation. Der Fokus liegt auf der Darstellung der psychotischen Symptomatik des Protagonisten und der manipulativen Erzählstruktur des Films, die den Zuschauer aktiv in die Irre führt.
- Die Darstellung von Körperlichkeit und Psyche im Film
- Die filmische Inszenierung von Wahn und Wirklichkeit
- Die Rolle der Isolation als Verstärker der psychotischen Symptomatik
- Die Unzuverlässigkeit des Erzählers und die Irreführung des Zuschauers
- Die Analyse der narrativen Fragmentierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Films "Shutter Island" ein und beschreibt die komplexe Verschränkung von Realität, Fiktion und Wahn. Sie hebt die Bedeutung der Isolation als zentralen Kontext hervor und skizziert die methodische Vorgehensweise der Analyse, die sich auf die Verbindung von Körper, Seele und Isolation konzentriert, sowie die Analyse der narrativen Fragmentierung und der Irreführung des Zuschauers. Der Fokus liegt auf der Untersuchung spezifischer Sequenzen, die eine Fokussierung auf den Körper aufweisen und ausgewählte Aspekte der filmischen Ich-Perspektive analysieren. Die Arbeit konzentriert sich ausschließlich auf den Film und teilweise auf das Drehbuch, ohne den Roman von Dennis Lehane einzubeziehen.
Begriffserklärung - Körper und Seele: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Körper“ und „Seele“ im Kontext der Arbeit. Es wird der dualistische Ansatz von Descartes erläutert, der Körper und Seele als getrennte, aber interagierende Entitäten betrachtet. Die Arbeit betont, dass sie sich nicht mit theologischen Ansätzen beschäftigt, sondern den Fokus auf die filmische Darstellung der Interaktion zwischen Körper und Seele legt. Die gewählte Definition von Descartes wird als besonders geeignet erachtet, da der Film Körper und Seele als zwei getrennte Entitäten zeigt, die durch ihre Interaktion ein Monismus bilden.
Die Darstellung der Körperlichkeit: Dieses Kapitel analysiert die körperliche Darstellung des Protagonisten im Film, basierend auf der Beschreibung des Drehbuchs. Es wird die physische Erscheinung des Protagonisten im Film betrachtet und im Zusammenhang mit der Inszenierung der Handlung und der Herausstellung von körperlichen Aspekten im Film gesetzt. Die Analyse fokussiert auf die filmischen Mittel, die verwendet werden, um die Körperlichkeit des Protagonisten darzustellen und diese im Kontext der Handlung zu deuten.
Die Seele des Protagonisten im Spiegel des Films: Dieses Kapitel untersucht die seelische Verfassung des Protagonisten und wie sie im Film dargestellt wird. Es analysiert die Fragmentierung der Geschichte als Mittel der Irreführung des Zuschauers und befasst sich mit der Unzuverlässigkeit des Erzählers. Die Kapitel untersucht, wie die filmische Erzählweise die seelische Zerrissenheit des Protagonisten widerspiegelt und den Zuschauer in die Irre führt. Die Analyse beleuchtet wie die Fragmentierung der Geschichte zur Verwirrung des Zuschauers beiträgt und die psychologischen Aspekte der Figur im Zusammenhang mit den erzählerischen Mitteln im Film darstellt.
Das Zusammenspiel von Körper, Seele und Isolation: Dieses Kapitel untersucht das Zusammenspiel von Körper, Seele und Isolation in Bezug auf die psychotische Symptomatik des Protagonisten. Es analysiert die subjektive Wahrnehmung des Protagonisten und die filmische Darstellung der Schizophrenie. Der Fokus liegt auf der Interpretation der filmischen Darstellung der psychologischen Erkrankung und des Einflusses der Isolation auf die Wahrnehmung und das Verhalten des Protagonisten. Es wird analysiert, wie die Isolation die seelische Erkrankung verstärkt und welche filmischen Mittel verwendet werden, um die Erkrankung darzustellen und dem Zuschauer verständlich zu machen.
Schlüsselwörter
Shutter Island, Martin Scorsese, Körper, Seele, Isolation, Wahn, Wirklichkeit, Psychose, Schizophrenie, Erzählperspektive, Filmische Darstellung, Narrative Fragmentierung, Irreführung des Zuschauers, Traumata, Zweiter Weltkrieg.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von "Shutter Island"
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf Martin Scorseses Film "Shutter Island" und untersucht die komplexe Interaktion von Körper, Seele und Isolation im Kontext der psychotischen Symptomatik des Protagonisten. Ein besonderer Fokus liegt auf der manipulativen Erzählstruktur und der Irreführung des Zuschauers.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung von Körperlichkeit und Psyche im Film, die filmische Inszenierung von Wahn und Wirklichkeit, die Rolle der Isolation, die Unzuverlässigkeit des Erzählers, die narrative Fragmentierung und die Analyse spezifischer Sequenzen mit Fokus auf die Körperlichkeit und die filmische Ich-Perspektive.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffserklärung von Körper und Seele, Kapitel zur Darstellung der Körperlichkeit und der Seele des Protagonisten, ein Kapitel zum Zusammenspiel von Körper, Seele und Isolation und ein Fazit. Jedes Kapitel analysiert spezifische Aspekte des Films.
Welche Methode wird angewendet?
Die Analyse konzentriert sich auf den Film und teilweise das Drehbuch, ohne den Roman von Dennis Lehane einzubeziehen. Sie untersucht die filmischen Mittel, die zur Darstellung der Körperlichkeit, der Psyche und der Isolation verwendet werden, sowie die narrative Struktur und ihre Wirkung auf den Zuschauer.
Wie wird der Begriff "Körper und Seele" definiert?
Die Arbeit verwendet einen dualistischen Ansatz nach Descartes, der Körper und Seele als getrennte, aber interagierende Entitäten betrachtet. Es wird betont, dass es sich nicht um einen theologischen Ansatz handelt, sondern um die filmische Darstellung der Interaktion.
Welche Rolle spielt die Isolation?
Die Isolation wird als zentraler Kontext für die psychotische Symptomatik des Protagonisten betrachtet. Die Analyse untersucht, wie die Isolation die seelische Erkrankung verstärkt und filmisch dargestellt wird.
Wie wird die Irreführung des Zuschauers dargestellt?
Die Irreführung des Zuschauers wird durch die Analyse der narrativen Fragmentierung, der Unzuverlässigkeit des Erzählers und der manipulativen Erzählstruktur untersucht. Die Fragmentierung der Geschichte und die filmische Erzählweise spiegeln die seelische Zerrissenheit des Protagonisten wider.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Shutter Island, Martin Scorsese, Körper, Seele, Isolation, Wahn, Wirklichkeit, Psychose, Schizophrenie, Erzählperspektive, Filmische Darstellung, Narrative Fragmentierung, Irreführung des Zuschauers, Traumata, Zweiter Weltkrieg.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt detailliert den Inhalt jedes Kapitels, inklusive der methodischen Vorgehensweise, der Analysemethoden und der zentralen Fragestellungen jedes Abschnitts. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den methodischen Ansatz. Die folgenden Kapitel analysieren die Darstellung von Körperlichkeit, Seele, Isolation und deren Zusammenspiel, wobei jeweils spezifische filmische Mittel und narrative Strategien beleuchtet werden.
- Quote paper
- Clotilde Bry-Chemarin (Author), 2012, Martin Scorseses "Shutter Island", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202868