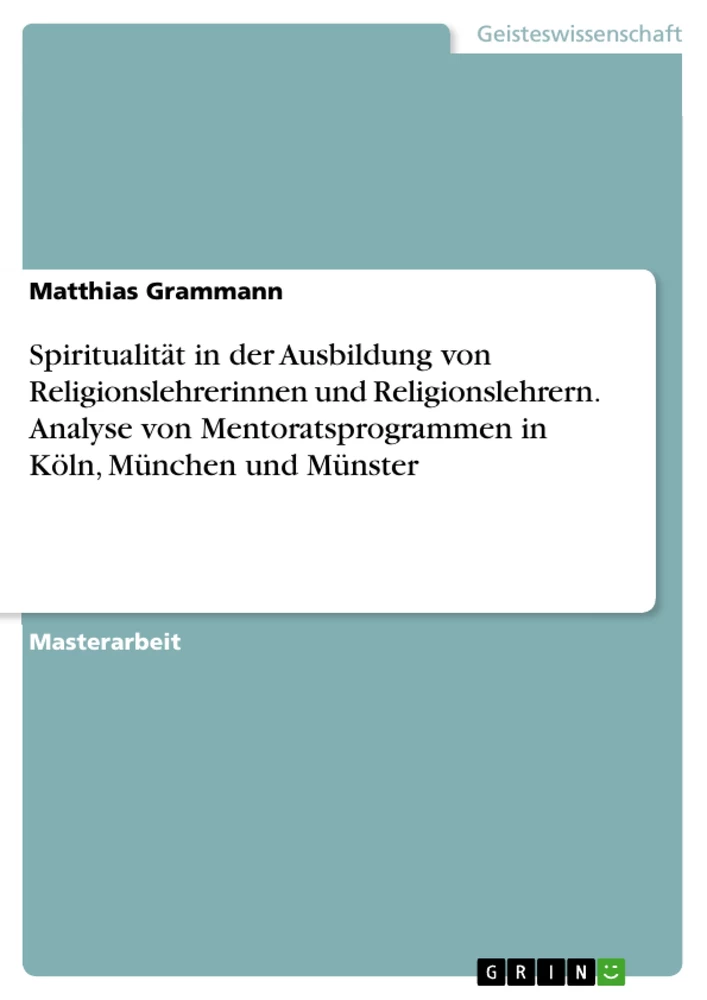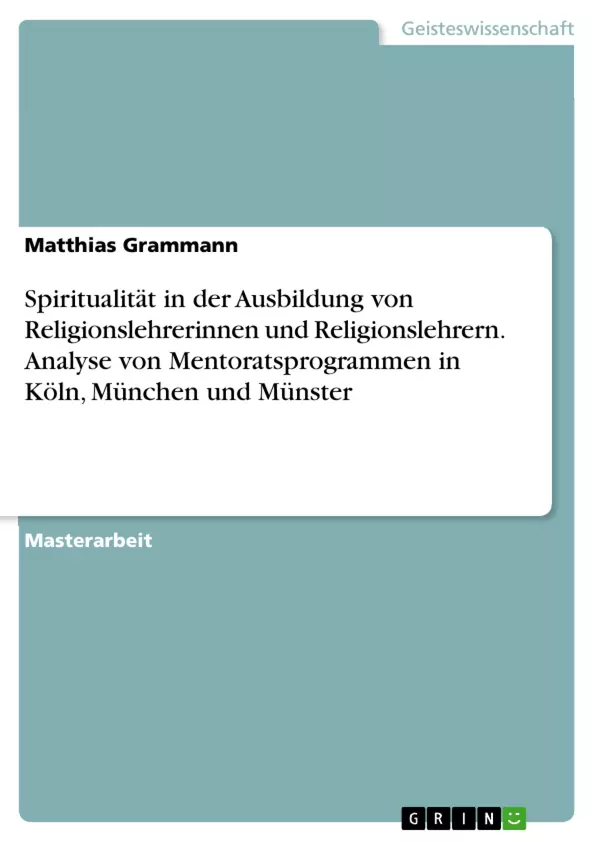In dieser Arbeit wird ein Modell zur Untersuchung von Spiritualität entwickelt und vorgestellt. Im Folgenden wird der Themenkomplex der Spiritualität in der Ausbildung katholischer Religionslehrerinnen und Religionslehrer in Deutschland bearbeitet. Dabei werden zunächst Texte der Deutschen Bischofskonferenz (sowie ein Text der Würzburger Synode) analysiert, anschließend zwei Studien ausgewertet und in einem dritten Schritt verschiedene Mentoratsprogramme analysiert.
Die Inhalte des Religionsunterrichtes werden in Deutschland von den Kirchen verantwortet. Die Religionslehrer benötigen eine kirchliche Lehrerlaubnis, mit der die Lehrer (in der katholischen Kirche) erklären, „den Religionsunterricht in Übereinstimmung mit der Lehre der Katholischen Kirche zu erteilen und in […][der] persönlichen Lebensführung die Grundsätze der Katholischen Kirche zu beachten“. Wenn Spiritualität zur Professionalität von Religionslehrern gehört, muss diese auch Teil der Ausbildung sein.
Die Konzentration dieser Arbeit auf (werdende) katholische Religionslehrer in Deutschland ist damit angezeigt. Ökumenische Fragestellungen werden nur am Rande verhandelt, ein internationaler Vergleich bleibt außen vor. Beides kann aufgrund der Rahmenbedingungen dieser Arbeit nicht geleistet werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Ein Modell zur Untersuchung von Spiritualität
2.1. Versuch einer Begriffsdefinition
2.2. Das Riemann-Thomann Modell
2.3. Kontinuität und Wandel
2.4. Aktion und Kontemplation
2.5. Gemeinschaft und Individuum?
2.6. Das Spiritualitätsfeld
3. Spiritualität des Religionslehrers in Veröffentlichungen der Deutschen Bischofskonferenz
3.1.DerReligionsunterrichtin derSchu/e (1974)
3.2.Zum Berufsbild und Selbstverständnis des Religionslehrers (1983)
3.3.Zur Spiritualität des Religionslehrers (1987)
3.4.Die bildende KraftdesReligionsunterrichts (1996)
3.5.DerRetigionsunterricht vor neuen Herausforderungen (2005)
3.6.KirchlicheAnforderungen an die Religionslehrerbildung (2010)
3.7. Zusammenfassung - Entwicklungen und Akzentverschiebungen in den analysierten Texten der deutschen Bischofskonferenz
4. Empirische Befunde über die tatsächliche S^wW-uaWfaX. (werdender) Religionslehrer
4.1.,,Religion' bei Religionslehrerinnen (2000)
4.2.Studienmotive fürs Lehramt Religion (2011)
4.3. Zusammenfassung
5. Analysevon Mentoratsprogrammen in Köln, München und Münster
5.1. Zur Auswahl und Struktur der untersuchten Mentorate
5.2. Die Programme im Überblick
5.3. Obligatorische Angebote als Voraussetzung für die Erlangung der vorläufigen Kirchlichen Unterrichtserlaubnis
5.3.1. Allgemeines
5.3.2. Auftaktveranstaltungen, Orientierungs- und Abschlussgespräch
5.3.3. Einführung in die christliche Spiritualität und Besinnungstage/Exerzitien
5.3.4. Kirchenpraktisches Engagement
5.3.5. Zusammenfassung
5.4. Fakultative Angebote im Bereich des geistlichen Mentorats
5.5. Fakultative Angebote im Bereich des Studienmentorats
5.6. Sonstige Angebote
5.7. Analyse und Kritik
6. Fazit und Ausblick
7. Anhang: Analyse der Mentoratsprogramme aus Köln, Münster und München
7.1. Übersicht der Analyse
7.2. Factsheet
7.3. Das Programm des Mentorats Köln
7.4. Das Programm des Mentorats Münster
7.5. Das Programm des Mentorats München
8. Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
9. Literaturverzeichnis
9.1. Quellen
9.2. Sekundärliteratur
9.3. Weitere Internet-Quellen
9.4. Persönliche Gespräche
1. Einleitung
„Als Lehrer und Erzieher verpflichte ich mich [...] [jedes Kind] Wahrhaftigkeit zu lehren, nicht die Wahrheit, denn die ist bei Gott allein."[1]
Dieses Verpflichtung, die Teil eines von Hartmut von Hentig verfassten Eides für Pädagogen[2] ist, hat weitreichende Konsequenzen für die Anforderungen an die Persönlichkeit des Lehrers[3]. Versteht man unter Wahrhaftigkeit die „sich dauerhaft durchhaltende, freiwillige und zuverlässige Übereinstimmung des Handelns und Sich-Äußerns eines menschlichen Individuums mit seiner Gesinnung, mit seinen Überzeugungen und Werten"[4], ist es eine logische Schlussfolgerung, dass derjenige, der Wahrhaftigkeit lehrt, selber wahrhaftig sein muss. Von Hentig leitet daraus eine weitere Verpflichtung für den Pädagogen ab:
„Damit verpflichte ich mich [...] meine Überzeugungen und Taten öffentlich zu begründen, mich der Kritik - insbesondere der Betroffenen und Sachkundigen - auszusetzen [,..][und] meine Urteile gewissenhaft zu prüfen [,..]."[5]
Gerade für Religionslehrer hat diese Lehrerpflicht eine besondere Brisanz - sie können und dürfen ihre eigenen Glaubensüberzeugungen nicht zur Privatsache erklären:
„Als [Religions-]Lehrer muss man sich befragen lassen über seine eigene Religion, welchen Stellenwert die biblischen Berichte, die christliche Tradition und die damit verbundenen Wert- und Normenvorstellungen für eine realitätsgerechte und reife Gestaltung des eigenen Lebens haben."[6]
Damit ist die Frage nach der Spiritualität des Religionslehrers gestellt. Notwendigerweise gehört die Verknüpfung der Religion, die er lehrt, mit seinem Leben zu seiner beruflichen Profession. Sein Sprechen über diese Religion steht sonst in der Gefahr, belanglos zu werden.[7] Wie könnte er wahrhaftige Antworten auf die Fragen seiner Schüler geben, wenn er sich selbst zu dem Gegenstand seines Unterrichtes in einer inneren, unüberbrückbaren Distanz befindet? Jurek Becker beschreibt dies in seinem Roman „Schlaflose Tage" so: „Gespielte Anteilnahme ist schlimmer als eingestandene Interesselosigkeit, denn sie verführt die Kinder zu Offenbarungen vor verschlossenen Ohren."[8]
Doch für die Lehrinhalte des Glaubens, welche der Religionslehrer in der Schule vertritt, ist dieser an Vorgaben gebunden: Die Inhalte des Religionsunterrichtes werden in Deutschland von den Kirchen verantwortet.[9] Die Religionslehrer benötigen eine kirchliche Lehrerlaubnis, mit der die Lehrer (in der katholischen Kirche)[10] erklären, „den Religionsunterricht in Übereinstimmung mit der Lehre der Katholischen Kirche zu erteilen und in [...][der] persönlichen Lebensführung die Grundsätze der Katholischen Kirche zu beachten"[11].
Damit rücken folgende Fragen und Themenkomplexe, denen in dieser Arbeit kapitelweise und mit unterschiedlichen Methoden nachgegangen werden soll, in den Fokus:
Im ersten Kapitel soll auf der Basis eines tragfähigen Begriffs ein Modell entwickelt werden, das geeignet ist, in den weiteren Kapiteln Schwerpunkte und inhaltliche Differenzen in den Auffassungen und Realisierungen von Spiritualität aufzudecken und darzustellen.
Im zweiten Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, welche konkreten Erwartungen die institutionalisierte Kirche, repräsentiert durch die Deutsche Bischofskonferenz, an die Spiritualität der Religionslehrer stellt. Dazu werden unterschiedliche Veröffentlichungen der deutschen Bischöfe analysiert und in das im ersten Kapitel entwickelten Modell eingeordnet.
Im dritten Kapitel schließt sich die Frage an, welche Rolle Spiritualität bei (werdenden) Religionslehrern in der heutigen Zeit spielt. Dazu werden zwei aktuelle Studien vorgestellt und zu Rate gezogen. Von diesen ausgehend soll erarbeitet werden, wie sich die tatsächliche Spiritualität vou Religionslehrern zu den konkreten Erwartungen der deutschen Bischöfe verhält.
Wenn Spiritualität zur Professionalität von Religionslehrern gehört, muss diese auch Teil der Ausbildung sein. Im vierten und letzten Kapitel wird daher versucht, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es im Bereich der spirituellen Begleitung von Studenten des katholischen Religionslehramtes durch die Mentorate in den vergangenen Jahren neue Entwicklungen und Reformen gab. Es soll der Frage nachgegangen werden, welchen Beitrag diese Mentorate zur Entwicklung von Spiritualität in der ersten Ausbildungsphase werdender Religionslehrer leisten und nach konkreten Vorschlägen für eine Weiterentwicklung in diesem Bereich gesucht werden. Methodisch soll dies aufder Basis einer Programmanalyse dreier deutscher Mentorate (Köln, Münster und München) geschehen.
Die Konzentration dieser Arbeit auf (werdende) katholische Religionslehrer in Deutschland ist damit angezeigt. Ökumenische Fragestellungen werden nur am Rande verhandelt,[12] ein internationaler Vergleich bleibt außen vor. Beides kann aufgrund der Rahmenbedingungen dieser Arbeit nicht geleistet werden.
2. Ein Modell zur Untersuchung von Spiritualität
In diesem Kapitel soll ein Modell entwickelt werden, das geeignet ist, die folgenden Untersuchungen zu strukturieren. Mithilfe dieses Modells soll es möglich sein, unterschiedliche Dimensionen von Spiritualität aufzuzeigen und damit mögliche Differenzen im Verständnis von Spiritualität und verschiedene Realisierungen dieser Spiritualität einordnen zu können. Dazu ist zunächst die Entwicklung eines tragfähigen Begriffs von Spiritualität notwendig.
2.1. Versuch einer Begriffsdefinition
Spiritualität ist ein in Mode gekommenes Wort, das konstatierten schon Theologen wie Hans Urs von Balthasar in den sechziger[13] und Klaus Hemmerle mit größerer Vehemenz in den achtziger Jahren[14]. Dieser Einschätzung ist eine fast prophetische Kraft zuzuschreiben: Die Erfolgsgeschichte dieses Begriffs hat sich fortgesetzt, bis dieser zum „Leitbegriff postmoderner Religiosität"[15] wurde - jedoch ohne dass die wissenschaftliche Theologie, so Josef Sudbrack, „für das damit Gemeinte (oder Ersehnte) den theologischen Ort' gefunden hat"[16]. Dabei ist Spiritualität ein Begriff, der sich im Christentum entwickelt hat: Er leitet sich vom biblischen πνευματικός (deutsch: „Dem Geist gemäß") ab. Spirituell zu sein meint also zunächst ein Leben in und aus dem Geist (Jesu Christi). Ein Blick in die Geschichte dieses Wortes[17] im christlichen Kontext zeigt aber bereits viele unterschiedliche Bedeutungstendenzen dieses Begriffes, die durchaus auch zu ,,Fehlverständisse[n]"[18] führten.
Hinzu kommt, dass heute das Christentum nur ein Akteur unter vielen ist, die sich dieses Begriffes bedienen. Außerhalb des Christentums wird damit oft eine Bedeutung verbunden, die sich von der ursprünglichen stark unterscheidet. Besonders im esoteri- sehen Bereich ist „die vagabundierende, weder institutionell noch dogmatisch festgelegte Religiosität"[19] Inhalt dieses Begriffs.
Es lassen sich sogar Begriffsdefinitionen von Spiritualität finden, die gänzlich ohne den Verweis auf eine transzendente Größe auskommen. Der Motivationspsychologe Rudolf Sponsel definiert Spiritualität beispielsweise als eine Beschäftigung „mit Sinn- und Wertfragen des Daseins, der Welt und der Menschen und besonders der eigenen Existenz und seiner Selbstverwirklichung im Leben"[20]. Zusammenfassend kann man sagen: Spiritualität ist ein „buntscheckiges Etwas, formenreich, interreligiös, interkulturell."[21] Fulbert Steffensky warnt: „Worte können Irrlichter sein, und ich habe den Eindruck, Spiritualität ist ein solches geworden"[22].
Dies legt nahe, für die folgenden Untersuchungen einen möglichst weiten Begriff von Spiritualität zu nutzen, auch um Zirkelschlüsse in den weiteren Untersuchungen zu vermeiden. Dennoch ist das spezifisch Christliche für eine Untersuchung, die sich mit (werdenden) katholischen Religionslehrern beschäftigt, eine notwendige Bedingung. Im Folgenden soll deswegen unter Spiritualität „Leben aus dem Geist Jesu Christi" verstanden werden.
Damit ist, wie Hans Urs von Balthasar sagt, Spiritualität die „subjektiven Seite der Dogmatik"[23] ; Gottfried Bitter umschreibt das mit der „heute in einer persönlichen, ganzheitlichen Lebensgestaltung vollzogene Ratifikation der christlichen Lebens- und Glaubensüberlieferung"[24]. Somit ist eine weite Definition dieses Begriffs, der biografische Unterschiede von Christen heute und in allen Zeiten zulassen muss, auch inhaltlich gerechtfertigt.
Der Begriff der Spiritualität steht dem der „Lebensform"[25] nahe. Dies bietet m. E. einen plausiblen Ansatzpunkt, um für eine weitere Analyse ein angepasstes Persönlichkeitsmodell zu Hilfe zu nehmen.
2.2. Das Riemann-Thomann Modell
Aus der Mediationsmethode „Klärungshilfe" stammt ein Persönlichkeitsmodell, das während des Mediationsprozesses von einem Klärungshelfer dazu genutzt werden soll, eine „Landkarte der Persönlichkeit des Klienten zu zeichnen"[26]. Dieses Modell geht auf den Begründer der Klärungshilfe, Christoph Thomann, zurück, der es auf der Basis einer Persönlichkeitstheorie von Fritz Riemann[27] im Jahr 1988 entwickelt hat.[28] Dementsprechend firmiert dieses Modell unter dem Namen „Riemann-Thomann Modell".[29]
Es unterscheidet vier Grundausrichtungen oder Grundstrebungen des Menschen, die als zwei Gegensatzpaare gelten können: Nähe und Distanz, sowie Dauer und Wechsel.
Nähe und Distanz beziehen sich dabei auf zwischenmenschlichen Kontakt: Suchen Menschen eher die Nähe oder eher die Abgrenzung zu anderen Menschen? Wird Bindung angestrebt oder Unabhängigkeit betont? Neben dieser räumlichen Ebene beziehen sich Dauer und Wechsel auf eine zeitliche Dimension. Sehnt sich und strebt der Mensch nach dem den Moment Überdauernden und nach langfristiger Sicherheit oder eher nach dem Augenblick, dem Zauber des Neuen, dem Reiz des Unbekannten?[30]
Dieses Modell lässt sich bildlich in ein Feld übertragen, in dem beide Begriffspaare die Achsen bilden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Thomann verdeutlicht, dass die meisten Menschen alle dieser vier Grundstrebungen mehr oder weniger in sich tragen, allerdings in einem unterschiedlichen Maß, einer unterschiedlichen Intensität und einer unterschiedlichen Reihenfolge. Jede Ausprägung hat dabei ihre Vorteile und Nachteile.[31] [32] Der nachteilige Charakter einzelner Ausprägungen wird vor allem im Blick auf die Extreme deutlich: Riemann sieht in den Übersteigerungen dieser Grundtendenzen des Menschen pathologische Geistes- und Gemütserkrankungen begründet. Nähe kann zur Depression entarten, Distanz zur Schizoidie oder Paranoia. Dauerhaftigkeit wird in ihrer extremen Form zur Zwanghaftigkeit und zur Zwangsneurose, eine extrem ausgeprägte Wechseltendenz zur Manie und Hysterie.[33]
Eine Untersuchung zur Spiritualität (oder Religiosität), die auf das Riemann-Thomann Modell zurückgreift oder es nur berücksichtigt, ist mir nicht bekannt. Allerdings sind für eine solche Analyse auch weitere Anpassungen nötig. Die Grundform des Modells soll dabei beibehalten werden: Ein Feld mit einer X- und einer Y-Achse. Die X-Achse repräsentiert eine räumliche, die Y-Achse eine zeitliche Dimension.
Beide Begriffspaare habe ich jedoch auf die spezifischen Anforderungen der Untersuchung von Spiritualität hin überprüft und neu entwickelt: Kontinuität und Wandel bilden die vertikale, Kontemplation und Aktion die horizontale Achse. Diese Begriffe werde ich nun im Hinblick auf ihre spiritualitätstheologische Bedeutung erläutern, um dann mit ihnen ein Modell als grundliegendes Werkzeug dieser Untersuchung zu bilden und schließlich die Konsequenzen für die weiteren Untersuchungen zu benennen.
2.3. Kontinuität und Wandel
Statt der Parameter Dauer und Wechsel im Riemann-Thomann Modell setzte ich in das Modell dieser Arbeit Kontinuität und Wandele.in. Nach einer allgemeinen Erläuterung des Begriffs der Kontinuität werde ich versuchen darzustellen, in welchem Zusammenhang diese Begriffe zur Spiritualität stehen.
Kontinuität ist ein fundamentaler Begriff sowohl in der Natur-Philosophie, als auch in der Mathematik und der Physik. Nach Aristoteles ist dasjenige kontinuierlich, dessen äußerste Grenzen eine Einheit bilden.[34] Veränderungen sind dann kontinuierlich, wenn sie nicht sprunghaft, plötzlich oder ungleichmäßig sind, sondern dann, wenn es einen lückenlosen Zusammenhang und einen fließenden Übergang gibt. Somit ist dieser Begriff nicht identisch mit dem der Dauer aus dem Riemann-Thomann Modell. Ein andauernder Zustand verändert sich prinzipiell nicht, ein Zustand, der sich kontinuierlich entwickelt, verändert sich - allerdings ohne den Bezug zum Gewesenen zu verlieren.
In Bezug auf die christliche Spiritualität haben Konzepte der Kontinuität in mehrerer Hinsicht Bedeutung: Auf der ersten Ebene ist Kontinuität in christlicher Spiritualität dadurch verwirklicht, dass diese sich immer in die große Kontinuität christlicher Glaubenstraditionen einordnet. Wer betet, stellt sich in die Gemeinschaft aller Christen, die vor ihm gebetet haben, die beten und die nach ihm beten werden. Dies wird deutlich, wenn Worte und Formen genutzt werden, die Christen miteinander verbinden (wie beispielsweise das Vaterunser oder auch das Stundengebet[35] ), prinzipiell gilt dies aber für alle Formen christlicher Spiritualität zu jeder Zeit.
In den spiritualitätstheologischen Überlegungen des Ignatius von Loyola wird ein zweiter Zusammenhang zwischen Kontinuität und Spiritualität deutlich. Der ignatianische Begriff der Exerzitien[36] (deutsch: geistliche Übungen) impliziert, dass geistliches Tun etwas ist, das man grundsätzlich üben kann und das dieses auch einer Wiederholung und Routine und damit der Kontinuität bedarf. Routine meint dabei gerade nicht ein inhaltlich leer gewordenes formales Tun, sondern eine aktives und neuentdeckendes Einüben, das es erst ermöglicht, die Fülle einer Spiritualitätsform zu erfahren. Dieses Üben ist ein Prozess, der zu Fortschritt und Wandel des geistlichen Lebens führt.[37]
Damit ist gezeigt, dass der als Gegenbegriff zur Kontinuität eingeführte Begriff des Wandels kein eigentlicher Gegenbegriff ist. Im Gegensatz zu Wechsel bleibt eine Verbindung zum Gewesenen möglich.[38] Konzepte des Wandels sind in der katholischen Tradition immer wieder rezipiert worden und nehmen eine bedeutsame Stellung ein - ist doch die „Wandlung" ein zentrales Moment jeder Eucharistiefeier. In dieser geht es nicht nur um die Verwandlung des Brotes und Weines in Leib und Blut Christi (Transsubstantiation), sondern immer auch um die Verwandlung des Menschen,[39] wie es das II. Vatikanische Konzil in der dogmatischen Konstitution über die Kirche formuliert:
„In jedem Leibe strömt Christi Leben auf die Gläubigen über, die durch die Sakramente auf geheimnisvolle und doch wirkliche Weise mit Christus [...] vereint werden. [...] Beim Brechen des eucharistischen Brotes erhalten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn [...]. So werden wir alle Gliederjenes Leibes (LG 7)
Wandlung (und somit auch Verwandlung) ist damit ein sakramententheologischer Leitbegriff, der aber auch für andere theologische Bereiche, wie für die Eschatologie,[40] von zentraler Bedeutung ist. Wie kann nun aber Wandel ein Gradmesser für Spiritualität sein?
Die französische Religionssoziologin Danièle Hervieu-Léger skizziert Grundmuster heutiger gelebter Religiosität, die sie mit traditionsträchtigen, aber neu gefüllten Begriffen benennt: Konvertiten und Pilger. Ihr Ansatz ist dabei interreligiös und inkludiert auch den Bereich der individualisierten Religiosität, den sie „mystisch-esoterischen Nebel"[41] nennt.
Der Konvertit ist ein Typus, der in dreifacher Ausführung vorkommt: Immer ist er Wechselnder, entweder von einer (geerbten) Religion in die (selbstgewählte) andere, von einer größtenteils areligiösen in eine religiöse Welt, oder von einer äußerlichen Religion in das Innere derselben.[42]
Der Pilger ist ein Typus, der für eine „in Bewegung geratene Religiosität, die jemanden geistig und körperlich ständig unterwegs sein lässt, eben auf der Suche nach der für die betreffende Person bestimmenden Form von Spiritualität"[43] steht.
Während beim Konvertiten nach Hervieu-Léger also vorrangig Entscheidung und Entschiedenheit im Vordergrund stehen, ist der Pilger ein Suchender. Ich meine, gerade in diesem Typus nicht nur ein allgemeines religiöses Grundmotiv, sondern auch ein Fundament christlicher Spiritualität zu finden: Spiritualität, die immer wieder der Suche, des Neuaufbruchs, des Aggiornamentos, eben des Wandels bedarf.
Damit ist klar, dass christliche Spiritualität immer beides haben muss: Kontinuität und Wandel. Nun könnten man annehmen, dass diese Ebene in einer persönlichen Spiritualitätsausprägung ideal verwirklicht wäre, wenn sie die Kontinuität im Wandel und den Wandel in der Kontinuität vereint. Allerdings wäre so ein Ideal über-menschlich. Für Menschen mit verschiedenen Charaktereigenschaften, verschiedenen Biografien in verschiedenen Lebenskontexten und -Zeiten ist es zu erwarten, dass sie eine Ausprägung von Spiritualität entwickelt haben, die eher in die eine oder in die andere Richtung tendiert, eben weil sie Menschen sind. Für die einzelne Person kann so eine Ausrichtung durchaus ein Ideal darstellen. Problematisch wird Spiritualität erst dann, wenn sie nur das eine oder das andere kennt: Kontinuität wird dann zur Erstarrung, zur reinen Dauer und Wandel zu beliebigem und ziellosem Wechsel.[44]
2.4. Aktion und Kontemplation
Die Parameter Aktion und Kontemplation sind die Begriffe, die ich auf der räumlichen Ebene anstelle von Nähe und Distanz in das zu entwickelnde Modell einsetze. Sowohl innerhalb der Dimension der Aktion als auch innerhalb der Dimension der Kontemplation spielen Nähe und Distanz eine Rolle: Es geht auf der einen Seite um Nähe und Distanz zu Gott und auf der anderen Seite um Nähe und Distanz zur Welt. Dabei ist es aber, wie sich zeigen wird, nicht zulässig, Kontemplation als Nähe zu Gott und gleichzeitig als Distanz zur Welt, beziehungsweise Aktion als Nähe zur Welt und gleichzeitig als Distanz zu Gott zu definieren.
Aktion und Kontemplation sind in der Theologie ein „klassisches Begriffspaar"[45]. Sie als zwei Pole von Spiritualität zu erfassen, ist keine neue Idee. In ihrer aus der antiken (aristotelischen) Philosophie stammenden Bedeutung ist mit Aktion eine auf die Bedürfnisse und Nöte des diesseitigen Lebens beschränkte Tätigkeit, mit Kontemplation die beschauliche Betrachtung, d. h. die Beschäftigung mit der Wahrheit um ihrer selbst willen gemeint. Beide Begriffe verhalten sich dabei, wie Mieth aufzeigt, nicht absolut konträr zueinander, wie es zum Beispiel bei aktiv und passiv der Fall ist.[46]
In derTheologie sind beide Begriffe immer wieder rezipiert worden. In der Rezeption der mönchischen Tradition haben sie als Lebensformen im Sinne einer vita contemplativa und einer vita activa e.inen exponierten Platz eingenommen.[47]
Lange Zeit war dabei Aktion der Kontemplation untergeordnet (z. B. bei Origines, Augustinus und Thomas von Aquin).[48] Diese hellenistisch beeinflusste Wertung ist heute so nicht mehr aufrecht zu halten.
Die Überhöhung der Kontemplation über die Aktion war letztlich in der aristotelischen Philosophie begründet, die eine Überlegenheit des Inneren über das Äußere annimmt. Dies brachte Thomas von Aquin dazu, die These aufzustellen, dass äußere Akte, die direkt aus der Kontemplation erwachsen - wie zum Beispiel Predigt oder Lehre - denjenigen übergeordnet sind, die sich (angeblich) auf Äußerlichkeiten beschränken, wie das Almosengeben oder die Gastfreundschaft. Die Argumente für diese Hierarchie bezieht Thomas von Aristoteles.[49] Denkt man diesen Gedankengang Thomas' konsequent weiter, gelangt man zu der Einsicht, dass das aktive Leben nur noch ein Mittel und eine Vorstufe zur Kontemplation darstellt. Die vita contemplativa wäre damit der vita activa überlegen.
Thomas von Aquin sieht allerdings in Kontemplation und Aktion Handlungsdimensionen, die nur weltlich voneinander getrennt sind: Adam im Paradies kennt diesen Unterschied genauso wenig wie die Engel. Nur wo Sünde im Spiel ist, entsteht eine Spannung, in der die Aktion die Kontemplation behindert.[50]
Die Formel „Kontemplation steht über Aktion" wird von den im 13. Jahrhundert entstehenden Bettelorden angefragt. Diese schaffen ein Ordensideal, in dem Aktion aus Kontemplation hervorgehen soll.[51] Theologisch reflektiert und weiterentwickelt wird diese Idee vor allem von Meister Eckart und Ignatius von Loyola, die ein Modell der Kontemplation in Aktion schaffen.[52]
Hans Urs von Balthasar kommt zu dem Schluss:
„[Kontemplation und Aktion sind] Prävalenzformen einer tieferliegenden Einheit. Sie bedingen sich [...] gegenseitig [...]: Kontemplation ist die Voraussetzung einer wahren Aktion, Aktion ist umgekehrt die unerlässliche Vorbedingung wahrer Kontemplation. Das Höchsterreichbare ist eine Einheit, in der Aktion nicht - wie stets zu befürchten - zu einer Minderung der Kontemplation, sondern im Gegenteil zu deren Fülle ausschlägt"[53].
Es bleibt zu erwähnen, dass jede Form von Spiritualität, die sich an Jesus Christus ausrichtet, genau diese höchsterreichbare Einheit zum Vorbild hat: Dass Christus Wort des Vaters ist, ist seine Kontemplation und seine Aktion.[54]
Dies wird, wie Hans Urs von Balthasar zeigt, besonders deutlich in der Passion Jesu, die Höhepunkt dieser Verbindung von Aktion und Kontemplation ist:
„Dadurch, daß [...][Christi] Aktion zuletzt zur Passion wird, zeigt er der Welt, daß seine Aktion schon immer eine Form der Kontemplation war, daß wirklich der Vater in ihm war und aus ihm sprach und die Werke wirkte, die er tat."[55]
Aktion mit Nächstenliebe und Kontemplation mit Gottesliebe parallel zu setzen, ist schon deshalb nicht möglich. Auch Aktion ist Gottesliebe, auch Kontemplation kann Nächstenliebe sein.
Es ist festzuhalten, dass christliche Spiritualität Kontemplation und Aktion beinhaltet und dass zwischen diesen beiden Polen (beim Menschen in der Welt) immer ein Spannungsverhältnis besteht. Kontemplation mit Gottesliebe und Aktion mit Nächstenliebe zu übersetzten und strikt voneinander zu trennen - was durchaus heute immer noch eine (auch von höchster Stelle)[56] vertretene theologische Position ist - ist letztlich im Blick auf Jesus Christus jedoch nicht haltbar, zumal beide sich aus einer Quelle speisen: „Die wahre und einzige Quelle aller Fruchtbarkeit für Aktion wie für Kontemplation [ist] die Liebe."[57]
Für Aktion und Kontemplation gilt also ebenso wie für Kontinuität und Wandel, dass christliche Spiritualität in einer Dialektik beider Pole zu suchen ist. Auch hier wird die Spiritualität eines einzelnen Menschen gemäß seiner Charakterstruktur eher zu der einen oder zu der anderen Seite tendieren. Das ist schlicht menschlich und wird erst - analog zu dem über Kontinuität und Wandel Gesagten - in den Extremen problematisch: Übersteigerte Aktion wird dann zur Gottvergessenheit und übersteigerte Kontemplation zur Weltentfremdung.
2.5. Gemeinschaft und Individuum?
Es bestand die Überlegung, Gemeinschaft und Individuum als Pole einer weiteren Achse (oder anstatt Kontemplation und Aktion) in dieses Modell mit aufzunehmen. Folgende Fragestellung war dabei leitend: Suchen Menschen eher Spiritualitätsformen der Einsamkeit oder der Gemeinschaft? In diesen Begriffen ist der Aspekt der Räumlichkeit greifbarer als in denen der Kontemplation und der Aktion. Trotzdem sind sie zur Beschreibung christlicher Spiritualität nicht geeignet:
Klaus Hemmerle hat darauf hingewiesen, dass christliche Spiritualität immer Gemeinschaft beinhaltet, da sie „wesenhaft als doppelte, als Gegenbewegung"[58] geschieht. Sie ist „gemeinsamer Weg im gegenseitig ersten Schritt von Gott auf mich und von mir auf Gott zu, und sie ist zugleich mein Weg mit Gott auf den anderen und des anderen auf mich zu"[59].
Somit erscheint eine rein individualistische christliche Spiritualität schlichtweg nicht möglich, sie ist notwendigerweise immer auf Gemeinschaft mit Gott und den Mitmenschen ausgerichtet.[60] Eine spiritualitätstheologische Gleichberechtigung der Begriffe Gemeinschaft und Individualität, wie sie bisher sowohl bei Kontinuität und Wandel, als auch bei Kontemplation und Aktion beschrieben wurde, wäre an dieser Stelle nicht gegeben.
2.6. Das Spiritualitätsfeld
Nach diesen Überlegungen ist es nun möglich, ein Modell zu skizzieren, das von dem Persönlichkeitsmodell nach Riemann und Thomann inspiriert ist, aber dieses durch das Setzen eigener Schwerpunkte spezialisiert, um Spiritualität und Formen von Spiritualität beschreiben zu können:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Das Spiritualitätsfeld
Uber eine entweltlichte Idealvorstellung christlicher Spiritualität kann nach den vorhergehenden Überlegungen gesagt werden, dass diese sich in diesem System insofern auf dem Nullpunkt befindet, als dass dort Kontinuität und Wandel einerseits und Kontemplation und Aktion andererseits eine Symbiose eingehen. Wie bereits gezeigt wurde, ist dies für den einzelnen Menschen aber nicht nur nicht möglich, sondern auch unnötig. Eine Balance zwischen den vier Polen sollte gefunden werden; dabei sind Tendenzen in die eine oder in die andere Richtung biografisch bestimmt.
Bei den bisherigen Überlegungen ist zu bedenken: Sie beziehen sich auf die Spiritualität einer Person bzw. auf die christliche Spiritualität im Allgemeinen. Gerade weil aber in den folgenden Kapiteln nicht die Spiritualität einer Einzelperson, sondern Spiritualität in Zusammenhang mit Personengruppen untersucht wird, ist dieses Modell ein geeignetes Instrumentarium: Es ist zu erwarten, dass Schwerpunkte deutlich werden, die mit diesem Raster erfasst werden können. Diese Schwerpunktsetzung ist gerade im Angebotsbereich sinnvoll, denn kein spirituelles Angebot kann den Anspruch haben, dass in ihm die gesamte Fülle christlicher Spiritualität zum Ausdruck kommt - das wäre hinsichtlich der schon beschriebenen Nähe der Begriffe Spiritualität und Lebensform eine unzulässige Überforderung.
Folgende Fragen sind zu stellen: Betont eine von den Bischöfen gestellte Anforderung an die Spiritualität der Religionslehrer eher die Kontemplation oder die Aktion, die Kontinuität oder den Wandel? Gibt es hinsichtlich ihrer Einstellung zur Spiritualität Tendenzen in der Gruppe der Religionslehrer, die aus den empirischen Daten mithilfe des erstellten Modells herausgearbeitet werden können? Welchen Schwerpunkt setzen die Mentorate in der Konzeption ihrer Angebote?
Um Spiritualitätsformen in der folgenden Untersuchung in dieses Modell einzuordnen, gilt:
- Eine Spiritualitätsausprägung oder -form hat eine Tendenz zur Kontinuität, wenn sie den Schwerpunkt auf diejenige Tradition legt, in der sie steht und/oder wenn sie auf Einübung, also auf Routine im Positiven setzt.
- Eine Spiritualitätsausprägung oder -form hat eine Tendenz zum Wandel, wenn sie den Fokus auf Veränderung, auf Neuaufbruch und auf die Suche nach neuen Formen und Inhalten setzt.
- Eine Spiritualitätsausprägung oder -form hat eine Tendenz zur Kontemplation, wenn sie auf geistige Inhalte fokussiert ist und die „beschauliche Betrachtung" sucht.
- Eine Spiritualitätsausprägung oder -form hat eine Tendenz zur Aktion, wenn sie auf tätige Nächstenliebe und die Umsetzung des Glaubens im Handeln ausgerichtet ist.
Einzelne Formen der Spiritualität hier letztgültig zuzuordnen, ist nicht unproblematisch und geschieht immer unter dem Vorbehalt der Subjektivität. Wo zum Beispiel soll eine Eucharistiefeier eingeordnet werden, die natürlich immer in der großen Kontinuität katholischer Tradition steht, aber sich um eine zeitgemäße Formensprache bemüht? Dies gilt es im Einzelfall abzuwägen.
3. Spiritualität des Religionslehrers in Veröffentlichungen der Deutschen Bischofskonferenz
Für die inhaltliche Gestaltung des Religionsunterrichts sind an den Schulen in Deutschland die Kirchen verantwortlich. Dieses im Grundgesetz verankerte Recht[61] spricht dem Religionsunterricht und den Kirchen damit eine besondere Rolle zu. In der „Missio canonica", der kirchlichen Lehrbeauftragung für Religionslehrer, wird diese kirchliche Autorität auch für die Person und Rolle des Religionslehrers besonders deutlich.
Es gibt es eine ganze Reihe von Beschlüssen, Hirtenschreiben und anderen Textformen, die sich mit dem Religionsunterricht befassen und von der Deutschen Bischofskonferenz verabschiedet wurden. Sie haben einen hohen Grad an Verbindlichkeit für die Gestaltung des katholischen Religionsunterrichts an deutschen Schulen. Die Funktion und Rolle des Religionslehrers wird in diesen Dokumenten wiederholt zum Thema und in diesem Rahmen finden sich immer wieder Aussagen zur Spiritualität des Religionslehrers, mit denen sich das Dokument „Zur Spiritualität des Religionslehrers" in erster Linie, die anderen Dokumente sich mit unterschiedlich starker Akzentuierung befassen.
Im Folgenden werde ich die Dokumente untersuchen, die einen möglichst universalen Anspruch haben (und sich zum Beispiel nicht nur auf eine Schulform beziehen), breit rezipiert wurden und werden und die hinsichtlich der Fragestellung am ergiebigsten sind. Der Beschluss „Der Religionsunterricht in der Schule"[62] der Würzburger Synode (1974) stellt dabei den ältesten Text dar. Das II. Vatikanische Konzil hatte vorher entscheidende Wendungen im innerkirchlichen Verständnis des Zusammenhangs von Kirche und Staat sowie von Kirche und anderen Weltanschauungen und damit letztlich auch andere Voraussetzungen des Religionsunterrichts mit sich gebracht.[63] Eine Analyse älterer Texte ist daher wenig ertragreich, vor allem da die Fragestellung dieser
Arbeit keinen direkten historischen Schwerpunkt aufweist. Der Synodenbeschluss ist von den Veröffentlichungen der Bischöfe der älteste Text zum Religionsunterricht, der weiterhin in aktuellen didaktischen Diskussionen als grundlegender Text rezipiert wird.[64]
Im Folgenden werden die Texte chronologisch nach dem Veröffentlichungsdatum analysiert. Nach einer kurzen Vorstellung und Einordnung werden die Texte hinsichtlich der Zielvorstellungen des Religionsunterrichts und den damit verbundenen Aufträgen oder Anforderungen an den Religionslehrer untersucht. Dies ist wichtig, weil die Aussagen über die Spiritualität des Lehrers nicht losgelöst von diesen Konzeptionen verstanden werden können.[65] In einem zweiten Schritt werden dann ebendiese expliziten und impliziten Aussagen herausgearbeitet, um sie dann in einem dritten Schritt mithilfe des entwickelten Spiritualitätsfeldes[66] zu analysieren und ein Fazit zu ziehen. Zum Schluss dieses Kapitels soll versucht werden, Entwicklungen und Akzentverschiebungen im Verständnis von (Lehrer-)Spiritualität im Vergleich dieser Texte nachzuvollziehen.
3.1. Der Religionsunterricht in der Schule (1974)
„Der Religionsunterricht in der Schule" ist ein Beschluss der Synode der deutschen Bistümer in Würzburg (1974).[67] Dem Religionsunterricht wurde bereits in bei der Vorbereitung der Synode eine hohe Priorität zugesprochen. Die Vorschläge, die diesbezüglich im Vorfeld zur inhaltlichen Vorbereitung eingebracht wurden, trugen die Titel „Religionsunterricht zwischen Kirche, Staat und Gesellschaft", bzw. „Überprüfung der Stellung und der Bedeutung des schulischen Religionsunterrichts". Sie zeigen die Dringlichkeit dieses Themas und die Ausrichtung bereits an.[68] Von akuter Bedeutung war die Frage nach dem Religionsunterricht deshalb, weil dieser seine Selbstverständlichkeit im Fächerkanon der Schule weitgehend verloren hatte und sich einem stärker werdenden säkularen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt sah. Zudem war der Religionsunterricht in den Schulen in seiner Zielsetzung bislang sehr kirchenbezogen und nur langsam wurden in seiner Gestaltungneue pädagogische und theologische Erkenntnisse rezipiert. Viele Schüler konnten die Bedeutung dieses Unterrichts für ihr Leben nicht einsehen.[69]
Der Beschluss ist auch heute noch von großer Bedeutung, nach Erich Feifel stellt er „so etwas wie die Magna Charta des katholischen Religionsunterrichtes dar, weil es ihm gelang, einen Orientierungsrahmen zu schaffen, der dieses Unterrichtsfach theologisch begründet, pädagogisch bestimmt, anthropopologisch orientiert und rechtlich abgesichert kirchlich und gesellschaftlich unterbaut."[70]
Der Synodenbeschluss ist in drei Teile gegliedert. Von einer Situations- und Kontextanalyse des Religionsunterrichts ausgehend wird ein Konzept des Religionsunterrichts erarbeitet. Aus diesem Konzept werden schließlich „Folgerungen und Forderungen"[71] entwickelt.
Ziele des Religionsunterrichts - Auftrag des Religionslehrers Die neu entwickelte Zielsetzung des Religionsunterrichtes wird klar benannt: Dieser soll „zu verantwortlichem Denken und Verhalten im Hinblick auf Religion und Glaube befähigen"[72]. Diese Zielsetzung ist nicht in erster Linie kerygmatisch zu verstehen; der Unterricht hat sein Ziel nicht verfehlt, wenn ein Schüler sich verantwortlich gegen den katholischen Glauben entscheidet. Die Freiheit des Schülers, zu der dieser allerdings befähigt werden muss, steht deshalb im didaktischen Mittelpunkt. Der Religionsunterricht soll „Verständnis und Toleranz"[73] fördern, bleibt dabei aber doch religiös verbindlich: Es geht um die Frage nach Gott, nach dem Anspruch des Evangeliums, nach der Kirche und nach verantwortlichem Handeln in der Gesellschaft.[74] Dabei soll er schülerorientiert sein, ohne seinen wissenschaftlichen und überprüfbaren Anspruch zu verlieren.
Spiritualität des Religionslehrers
Die Person des Religionslehrers steht nicht im Zentrum dieses Dokuments; im Rahmen des Konzepts wird ihr aber ein eigenes Kapitel eingeräumt. Hinsichtlich der Frage nach der Spiritualität werden hier eine Vielzahl von Aussagen getroffen, auch wenn das nicht explizit geschieht: Als Substantiv taucht der Begriff der Spiritualität gar nicht, als Adjektiv „spirituell" nur einmal auf.[75] Eine Definition von Spiritualität wird folglich nicht entwickelt. Es wird hingegen ein Bild des Religionslehrers gezeichnet, das sich durch Festigkeit im Glauben, Konfessionalität und Kirchlichkeit auszeichnet, aber auch von Solidarität zu den Schülern geprägt ist:
1. Es wird vorausgesetzt, dass der Religionslehrer grundsätzlich ein Glaubender ist, der aber in seinem Glauben angefragt werden kann.[76] Dieser Glauben steht auf einem konfessionell geprägten Fundament.[77]
2. Ein Religionslehrer „soll sensibel sein für die religiöse Dimension der Wirklichkeit. Er muß selber ein Mensch sein, der nach dem Sinn des Lebens und der Welt zu fragen gelernt hat."[78]
3. Die Kirche ist „Kommunikationsbasis"[79] für das Glaubensleben des Religionslehrers. Er erhält dort „spirituelle Impulse [...] und [kann] so vor der Verkümmerung seines Glaubens und einer Versandung des religiösen Lebens bewahrt werden."[80]
4. „Die Bindung des Religionslehrers an die Kirche erfordert gleichzeitig ein waches Bewußtsein für Fehler und Schwächen sowie die Bereitschaft zu Veränderung und Reformen. [...] Liebe und kritische Distanz zur Kirche müssen einander nicht ausschließen."[81]
[...]
[1] Hentig, Hartmut von: Die Schule neu denken. S. 246.
[2] Vgl. ebd.
[3] In dieser Arbeit verwende ich aus Gründen der Lesbarkeit das generische Maskulinum. Woimmer von „Pädagogen", „Religionslehrern" und „Schülern" etc. die Rede ist, sollen selbstverständlich beide Geschlechter angesprochen sein.
[4] Rauscher, Gerald: Wahrhaftigkeit. S. 926.
[5] Hentig, Hartmut von: Die Schule neu denken. S. 247.
[6] Ebert, Klaus: Zur Rolle des Religionslehrers. S. 79.
[7] Vgl. Hemmerle, Klaus: Sprechen von Gott. S. 57.
[8] Becker, Jurek: Schlaflose Tage. S. 57.
[9] Dies ist sogar grundgesetzlich abgesichert. Vgl. Art. 7.3 GG sowie die Einleitung zu Kapitel 3.
[10] In den evangelischen Kirchen ist zumindest die Übereinstimmung zwischen Unterricht und Lebensführung in der Vokation nicht explizit gefordert. Vgl. Kapitel 4.1.
[11] Bischöfliches Genera Ivi kariat Münster - Hauptabteilung für Schule und Erziehung: Antrag auf Erteilung der Missio canonica.
[12] In Kapitel 4. ergibt sich die ökumenische Thematik aus den Stichprobenkonstruktionen der untersuchten Studien.
[13] Vgl. Balthasar, Hans-Urs: Das Evangelium als Norm und Kritik aller Spiritualität in der Kirche. S. 247.
[14] Vgl. Hemmerle, Klaus: Spiritualität - was heißt das? S. 13.
[15] Kortner, Ulrich: Geist und Ungeist heutiger Spiritualität. S. 8.
[16] Sudbrack, Josef: Gottes Geist ist konkret. S. 35.
[17] Eine ausführliche Etymologie liefert: Ebd. S. 36-40.
[18] Ebd. S. 38.
[19] Sudbrack, Josef: Spiritualität. S. 852.
[20] Sponsel, Rudolf: Spiritualität.
[21] Bitter, Gottfried: Spiritualität als geistlicher Lebensstil. S. 17.
[22] Steffensky, Fulbert: Schwarzbrot-Spiritualität. S. 7.
[23] Balthasar, Hans-Urs: Spiritualität. S. 341.
[24] Bitter, Gottfried: Spiritualität als geistlicher Lebensstil. S. 19.
[25] Kommission für Erziehung und Schule der Deutschen Bischofskonferenz: Zur Spiritualität des Religionslehrers. S. 12.
[26] Thomann, Christoph; SchulzvonThun, Friedemann: Klärungshilfe 1. S. 174.
[27] Riemann, Fritz: Grundformen der Angst.
[28] Thomann, Christoph; SchulzvonThun, Friedemann: Klärungshilfe.
[29] Vgl. z. B.: Stahl, Eberhard: Dynamik in Gruppen.
[30] Vgl. Thomann, Christoph; SchulzvonThun, Friedemann: Klärungshilfe 1.
[31] Thomann, Christoph; SchulzvonThun, Friedemann: Klärungshilfe 1. S. 177.
[32] Vgl. ebd. S. 178f.
[33] Vgl. ebd. S. 187.
[34] Vgl. Böhningk, Volker: Kontinuum, Kontinuität. S. 330.
[35] Hier wird der Zusammenhang besonders deutlich: Das Stundengebet ist das Gebet, in der die Kirche auf Gott hört und ihn „ohne Unterlaß in Gesang und Gebet" (c. 1173 CIC/83) lobt.
[36] Vgl. Imhof, Paul: Exerzitien. S. 1106f.
[37] Vgl. ebd.
[38] An folgendem Beispiel wird dies deutlich: Wechselt jemand seinen Beruf, kann man einen klaren (Zeit-)Punkt benennen, an dem dies geschieht. Wandeln sich die beruflichen Wünsche einer Person, kann dies ein kontinuierlicher Prozess sein.
[39] Vgl. MEßNER, Reinhard: Einführung in die Liturgiewissenschaft. S. 207.
[40] Vgl. ScHÄRTL,Thomas: Ding. S. 91.
[41] Hervieu-Léger, Daniele: Pilger und Konvertiten. S. 113.
[42] Vgl. Kehl, Medard: Kirche und Orden im Umbruch. S. 3.
[43] Ebd. S. 2f.
[44] Eventuell ist im Sinne Riemanns zu vermuten, dass hier pathologische Formen einer Scheinspiritualität entstehen können, die zwanghaft oder manisch sind. Vgl. Kapitel 2.2.
[45] Balthasar, Hans Urs: Aktion und Kontemplation. S. 245.
[46] Mieth, Dietmar: Aktion und Kontemplation. S. 304.
[47] Vgl. ebd. S. 304.
[48] Vgl. Balthasar, Hans Urs: Aktion und Kontemplation. S. 245.
[49] Vgl. Balthasar, Hans Urs: Aktion und Kontemplation. S. 247.
[50] Vgl. ebd. S. 250f.
[51] Vgl. ebd. S. 250.
[52] Mieth, Dietmar: Aktion und Kontemplation S. 306.
[53] Balthasar, Hans Urs: Aktion und Kontemplation. S. 252.
[54] Balthasar, Hans Urs: Aktion und Kontemplation. S. 366.
[55] Ebd. S. 368.
[56] Beispielsweise in einer Katechese Benedikt XVI.: Dieser sieht den rechten Weg des Christen in einem Mittelweg zwischen Kontemplation und Aktion, setzt dabei aber eine ähnliche Zuordnung voraus. Vgl. Benedikt XVI: Generalaudienz. Mittwoch, 18. Juni 2008.
[57] Balthasar, Hans Urs: Aktion und Kontemplation. S. 258.
[58] Vgl. Hemmerle, Klaus: Spiritualität und Gemeinschaft. S. 74-78.
[59] Ebd.
[60] Vielleicht ist genau das der Unterschied zwischen christlicher Spiritualität und dem, was im esoterischen Kontext mit Spiritualität bezeichnet wird.
[61] Vgl. Art. 7.3 GG. Vgl. zur Rechtslage des Religionsunterrichts in Deutschland allgemein:Ennuschat, Jörg: Religionsunterricht in Deutschland.
[62] Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland:Der Religionsunterricht in der Schule.
[63] Diese Änderungen nachzuzeichnen ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Es kann hier nur auf bereits vorhandene Reflexionen verwiesen werden: Vgl. dazu bspw. Ratzinger, Joseph: Der Weltdienst der Kirche.
[64] Die Schrift „Kirchliche Anforderungen an die Religionslehrerbildung" verweist zum Beispiel an verschiedenen Stellen auf den Würzburger Beschluss. Vgl. Kapitel 3.6.
[65] Dies gilt nur, wenn die Spiritualität des Religionslehrers eine spezifische ist und sich in irgendeiner Form von der Spiritualität anderer Christen unterscheidet.
[66] Vgl. Kapitel 2.6.
[67] Die Einberufung der Synode wurde im Nachgang des II. Vatikanischen Konzils beschlossen.Für ihre Arbeitsweise war ein kollegialer Stil der gemeinsamen Verantwortung von Laien und Priestern charakteristisch. Einen kurzen Überblick liefert: Wittstadt, Klaus: Synode. S. 1191.
[68] Vgl. Volz, Ludwig: Der Religionsunterricht in der Schule. S. 113.
[69] Vgl. Volz, Ludwig: Der Religionsunterricht in der Schule. S. 113.
[70] Feifel, Erich: Zukunftsweisendes Weggeleit? S. 31.
[71] Volz, Ludwig: Der Religionsunterricht in der Schule. S. 115.
[72] Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland:Der Religionsunterricht in der Schule. S. 139.
[73] Ebd. S. 140.
[74] Vgl. ebd. S. 138f.
[75] Vgl. Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland: Der Religionsunterricht in der Schule. S. 147, vgl. 3. auf dieser Seite.
[76] Vgl. ebd. S. 126.
[77] Vgl. ebd. S. 146.
[78] Ebd. S. 147.
[79] Ebd.
[80] Ebd.
[81] Ebd. S. 148.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Spiritualität für Religionslehrer wichtig?
Religionslehrer müssen wahrhaftig sein; ihre persönliche Glaubensüberzeugung und Lebensführung sind untrennbar mit ihrer beruflichen Professionalität verknüpft.
Was sind Mentoratsprogramme?
Es sind kirchliche Ausbildungsprogramme (z.B. in Köln, München, Münster), die angehende Religionslehrer spirituell begleiten und auf die Kirchliche Unterrichtserlaubnis vorbereiten.
Welche Anforderungen stellt die Bischofskonferenz?
Lehrer verpflichten sich, den Unterricht in Übereinstimmung mit der kirchlichen Lehre zu erteilen und die Grundsätze der Kirche in ihrer Lebensführung zu beachten.
Was beinhaltet das Riemann-Thomann-Modell in dieser Analyse?
Es dient als Modell zur Untersuchung verschiedener Dimensionen von Spiritualität, wie etwa das Spannungsfeld zwischen Gemeinschaft und Individuum oder Aktion und Kontemplation.
Welche Angebote gibt es in den Mentoraten?
Dazu gehören obligatorische Orientierungsgespräche, Besinnungstage, Exerzitien sowie kirchenpraktisches Engagement.
- Quote paper
- Matthias Grammann (Author), 2012, Spiritualität in der Ausbildung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern. Analyse von Mentoratsprogrammen in Köln, München und Münster, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202871