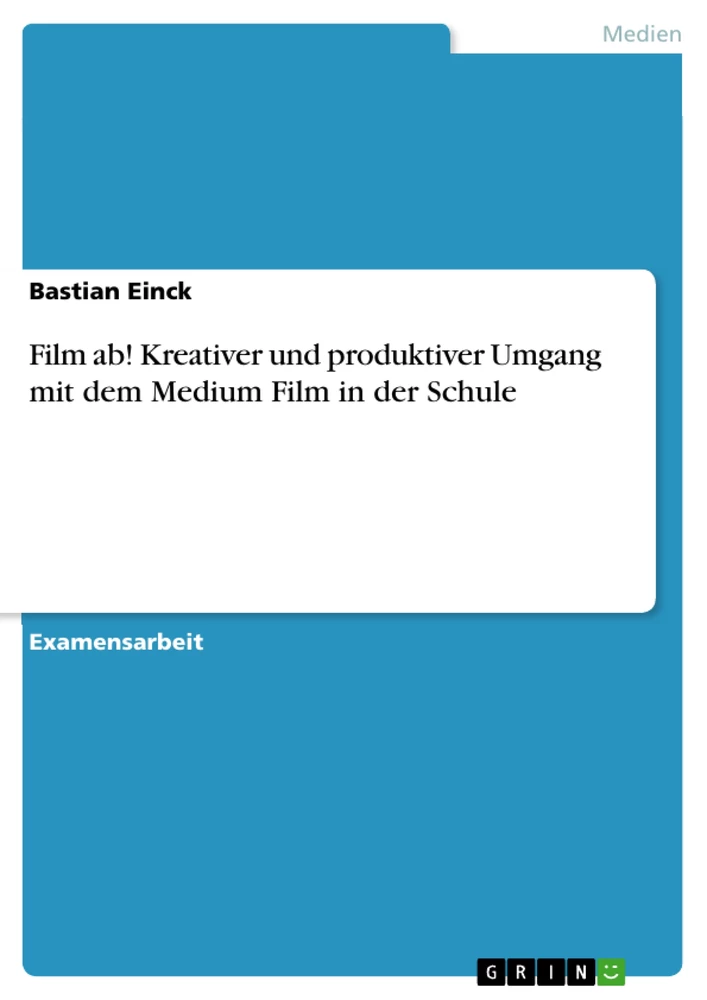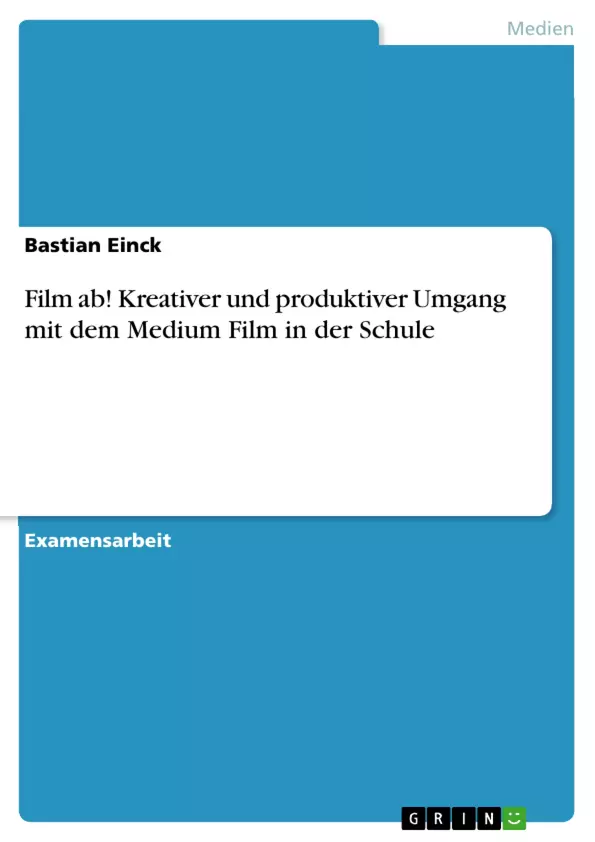Einleitung
Der Einsatz von Spielfilmen im Unterricht spaltet im 21. Jahrhundert noch immer die Kollegien deutscher Schulen. Dass die Schüler Kompetenzen im Umgang mit literarischen Texten erwerben sollen, steht außer Frage, im Bezug auf audiovisuelle Texte, die von Kindern und Jugendlichen bereits seit Jahrzehnten quantitativ häufiger rezipiert werden als gedruckte Texte, scheint dieser Kompetenzerwerb jedoch sekundär.
Ob als Verfilmung eines vorher behandelten Romans oder als erläuternde Reportage zu einem Sachthema: Nach meinen Erfahrungen wird das Medium im Schulalltag sehr einseitig eingesetzt. Im Fach Deutsch wird nahezu ausschließlich analytisch und somit rezeptiv mit dem Medium gearbeitet. In aktuellen Schulbüchern wie beispielsweise „Texte, Themen und Strukturen“ (NRW) aus dem Cornelsen-Verlag finden sich qualitativ hochwertige Materialien zu diesem Bereich. Der Produktionsprozess wird jedoch fast komplett ausgeklammert . Auf dieses Missverhältnis geht die vorliegende Arbeit ein. Aufgrund der problematischen Integration in den Regelunterricht, bedingt durch die Komplexität des Themas sowie die curricularen Vorgaben des Faches, ist das vorliegende Konzept für eine Arbeitsgemeinschaft (AG) vorgesehen.
Fil¬¬me sind audiovisuelle Texte und ein legitimer Gegenstand vieler Schulfächer. Insbesondere für den Deutschunterricht lässt sich im Umgang mit dem Medium eine Vielzahl an gewinnbringenden Einsatzmöglichkeiten bestimmen. Das produktive Arbeiten mit audiovisuellen Texten ist sowohl im Fach Deutsch als auch im Schulalltag jedoch kaum vorhanden. Das Gymnasium zielt auf eine allgemeine Bildung der Schüler ab und darf dabei „das Massenmedium Film [...] nicht ausklammern, weil es schwierig zu handhaben ist“ (vgl. Hildebrand, 2006: 46). Das vor¬liegende Konzept soll zu einer handlungs- und produktionsorientierten Auseinandersetzung mit dem Medium Film am Gymnasium beitragen. Dabei soll das bislang unausgewogene Verhältnis zwischen Analyse und Produktion verbessert werden. Da die Lage an anderen Schulen vermutlich ähnlich ist, wird dezidiert auf eine Übertragbarkeit des Konzepts Wert gelegt. Mit dieser Arbeit möchte ich einen Beitrag zur Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie zum Schulprogramm meiner Ausbildungsschule liefern.
Die Idee zum vorliegenden Konzept entstand primär durch die Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Filmbildung in der Schule
2.1 Didaktische Ansätze
2.2 Rahmenbedingungen
2.2.1 Verankerung in Richtlinien und Lehrplänen
2.2.2 Rahmenbedingungen an der Ausbildungsschule
3. Medienkompetenz – Eine Schlüsselqualifikation im 21. Jahrhundert
3.1 Zum Begriff der Medienkompetenz
3.2 Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen
4. Intentionen des Unterrichtskonzepts
4.1 Ziele des Konzepts
4.2 Lernausgangslage der Teilnehmer
4.3 Organisatorische Voraussetzungen
4.4 Voraussetzungen der Lehrkraft
4.5 Bezug zu den Lehrerfunktionen
5. Ein handlungs- und produktionsorientiertes Filmprojekt zum Aufbau von Kernkompetenzen der Schüler im Umgang mit audiovisuellen Medien
5.1 Einstieg in die Thematik unter Rückgriff auf die Vorerfahrungen der Teilnehmer
5.2 Einführung in die selbstständige digitale Kameraarbeit auf Grundlage von 22 theoretischen Überlegungen zur Bildkomposition
5.3 Einführung in Schnitt- und Montagetechniken anhand der produktions- orientierten Arbeit mit dem Programm Movie Maker
5.4 Erarbeitung und selbstständige Erprobung von Filmtechniken wie Stop-Motion und Rückwärtsaufnahmeverfahren anhand fantastischer Filme
5.5 Einführung in die Erzähltheorie des Mediums zur Erschließung und eigenständiger Nutzung der spezifischen narrativen Potenziale von audiovisuellen Texten
5.6 Die Grammatik des Films – Vertiefung von Schnitt und Montage anhand erster Projektarbeiten
5.7 Film ab! – Erprobung des Erlernten durch die eigenständige Produktion eines Kurzfilmes
5.8 Thematische Anschlussmöglichkeiten
6. Reflexion des Unterrichtskonzeptes und abschließende Bewertung
6.1 Theoretische Reflexion des Konzepts
6.2 Abschließende Bewertung des Konzepts
Literaturverzeichnis
Softwareverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhang
- Quote paper
- Bastian Einck (Author), 2011, Film ab! Kreativer und produktiver Umgang mit dem Medium Film in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202916