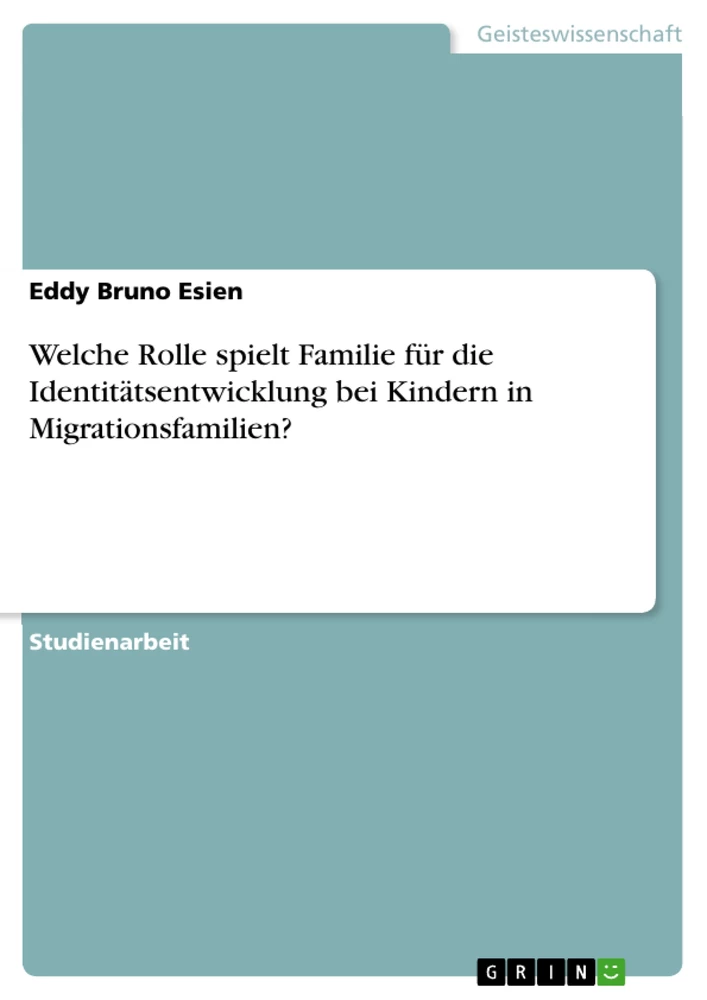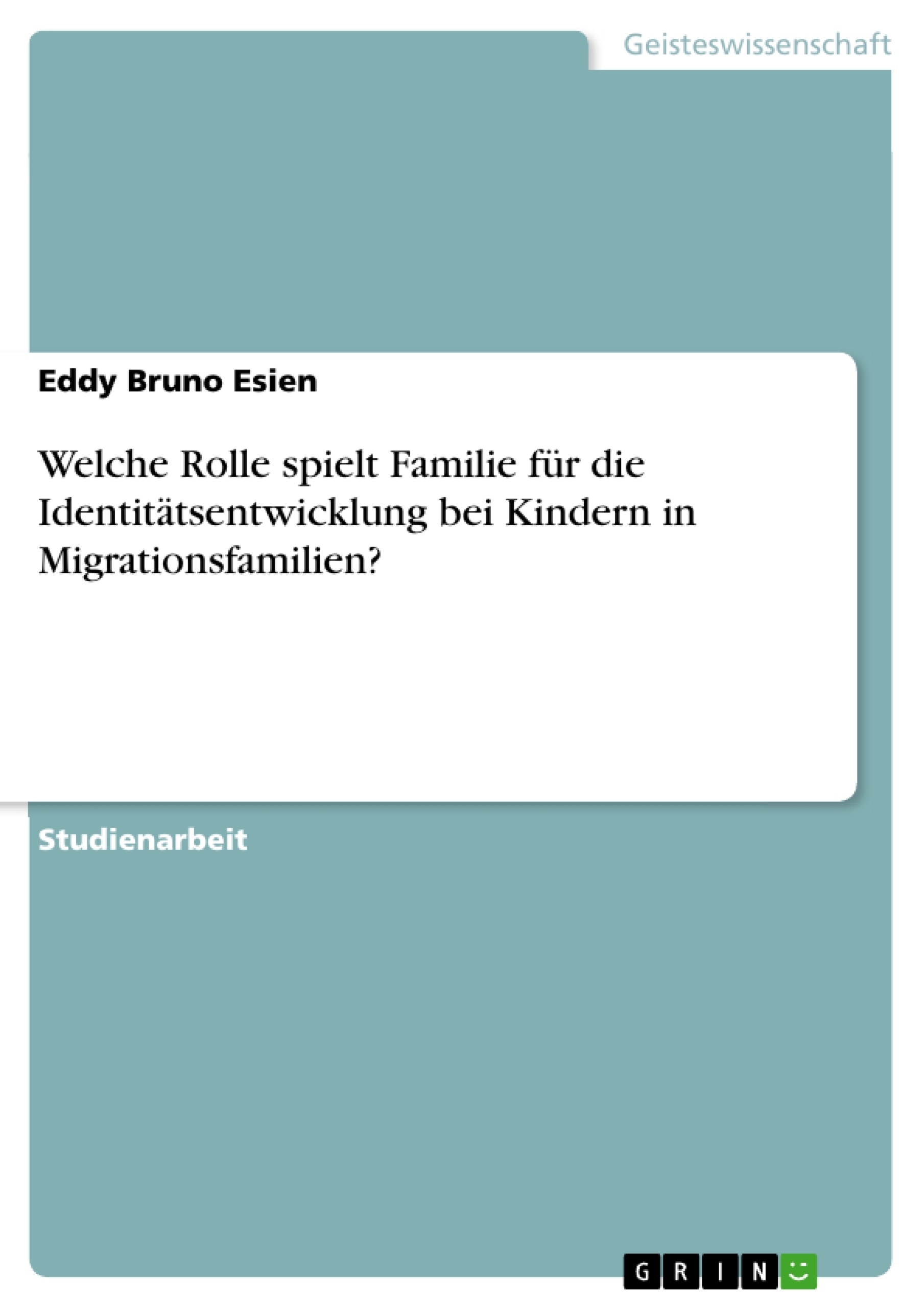Die Beschäftigung mit den Menschen und den einzelnen Individuen ist seit langer Zeit eine zentrale Auseinandersetzung mit der Menschheit. Aufgrund von Migration - „jede Ortsveränderung von Personen“ (Hoffmann-Nowotny 1970:107) und der Vielfältigkeit unserer Welt sowie der zunehmenden Globalisierung kommt es wiederum vermehrt zu Wanderbewegungen von Menschen. Solche Bewegungen führen viele Menschen in andere als ihre ursprünglichen Bereiche der Erde und zu teilweise freiwilligen, teilweise unfreiwilligen Niederlassungen.
Zur Zunahme der Migrationsbewegungen laut Population Referenze Bureau:
„There were 214 million international migrants in 2010, meaning that 3 percent of the world's almost 7 billion people left their country of birth or citizenship for a year or more. The number of international migrants almost doubled between 1985 and 2010“. (vgl.prb.org)
Diese Bewegungen von Menschen führen die Familien und insbesondere deren Kinder oft in komplexe Lagen und Zustände, weil sich das gesamte Familiensystem in einer neuen Gesellschaft mit der erwarteten Struktur, den Normen und Werten neu zu orientieren und zu identifizieren hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abgrenzung der Problemstellung
- Begriffsdefinition und Interpretationsbreite
- Identitätsentwicklung
- Der klassische Erklärungsversuch
- Die psychologische Sichtweise
- Ein unabschließbarer dynamischer Prozess
- Was bedeutet Familie?
- "Migrationsfamilie"
- Theoretischer Hintergrund zur Identitätsentwicklung
- Die Identität nach George Herbert Mead
- Sich selbst zum Objekt machen
- Die Identität nach Erwin Goffman
- Die Präsentation des Selbst im Alltag
- Die Identität nach Erik H. Erikson
- Identität als lebenslange Entwicklung
- Die kulturelle Identität und der Sozialisationsprozess
- Was bedeutet "Kultur"?
- Identität als Teil der Sozialisationsprozesses
- Die Rolle der Familie im Sozialisationsprozess
- Allgemeines
- Spezifika im Sozialisationsprozess der Migrationsfamilie
- Fazit I Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, welche Rolle die Familie für die Identitätsentwicklung von Kindern in Migrationsfamilien spielt. Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Identität als Teil des Sozialisationsprozesses und untersucht die Herausforderungen, denen sich Migrantenfamilien im Umgang mit der Doppelidentität ihrer Kinder stellen müssen. Die Arbeit betrachtet verschiedene theoretische Ansätze zur Identitätsentwicklung und beleuchtet die Rolle von Kultur und Sozialisation in diesem Prozess. Besonderes Augenmerk wird auf die Spezifika des Sozialisationsprozesses in Migrantenfamilien gelegt.
- Identität als lebenslanger Prozess
- Die Rolle der Familie als primäre Sozialisationsinstanz
- Die Herausforderungen der Doppelidentität bei Migrantenkindern
- Die Bedeutung von Kultur und Sozialisation für die Identitätsentwicklung
- Spezifika des Sozialisationsprozesses in Migrantenfamilien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Seminararbeit stellt die Problemstellung dar und grenzt den Forschungsgegenstand ab. Sie definiert den Begriff "Identität" und beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze zur Identitätsentwicklung. Außerdem wird der Begriff "Familie" definiert und die Bedeutung von "Migrationsfamilien" im Kontext der Arbeit erläutert.
Der theoretische Hintergrund der Arbeit widmet sich verschiedenen Ansätzen zur Identitätsentwicklung. Die Arbeit beleuchtet die Theorien von George Herbert Mead, Erwin Goffman und Erik H. Erikson und zeigt auf, wie diese Ansätze das Verständnis von Identität und Sozialisation erweitern.
Die Arbeit untersucht die kulturelle Identität und den Sozialisationsprozess, wobei sie die Bedeutung von Kultur für die Identitätsentwicklung beleuchtet. Sie zeigt auf, wie Migrantenfamilien mit unterschiedlichen kulturellen Werten und Normen konfrontiert sind und welche Herausforderungen dies für die Identitätsentwicklung der Kinder darstellt.
Der Abschnitt über die Rolle der Familie im Sozialisationsprozess betrachtet die Familie als primäre Sozialisationsinstanz und beleuchtet die allgemeinen Funktionen der Familie. Die Arbeit analysiert die spezifischen Herausforderungen, denen sich Migrantenfamilien im Sozialisationsprozess ihrer Kinder stellen müssen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Identitätsentwicklung, die Rolle der Familie, die Migrationsfamilie, die Sozialisation, die Kultur, die Doppelidentität und die Herausforderungen der Integration. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung dieser Themen im Kontext der Identitätsentwicklung von Kindern in Migrationsfamilien.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Familie bei der Identitätsbildung von Migrantenkindern?
Die Familie ist die primäre Sozialisationsinstanz, die Kindern hilft, sich zwischen den Werten der Herkunftskultur und der neuen Gesellschaft zu orientieren.
Was versteht man unter einer "Doppelidentität"?
Es beschreibt die Herausforderung für Kinder, Identitätsmerkmale aus zwei verschiedenen Kultursystemen zu integrieren und ein kohärentes Selbstbild zu entwickeln.
Welche theoretischen Ansätze erklären die Identitätsentwicklung?
Wichtige Theorien stammen von George Herbert Mead (Sich selbst zum Objekt machen), Erving Goffman (Präsentation des Selbst) und Erik H. Erikson (lebenslanger Prozess).
Wie beeinflusst Migration das Familiensystem?
Migration zwingt Familien, ihre Strukturen, Normen und Werte in einer neuen Gesellschaft oft unter komplexen Bedingungen neu zu definieren.
Was bedeutet Sozialisation im Kontext von Migrationsfamilien?
Es ist der Prozess der Einbettung in die Gesellschaft, wobei Migrationsfamilien spezifische Herausforderungen bei der Vermittlung kultureller Identität bewältigen müssen.
- Quote paper
- Eddy Bruno Esien (Author), 2011, Welche Rolle spielt Familie für die Identitätsentwicklung bei Kindern in Migrationsfamilien?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202994