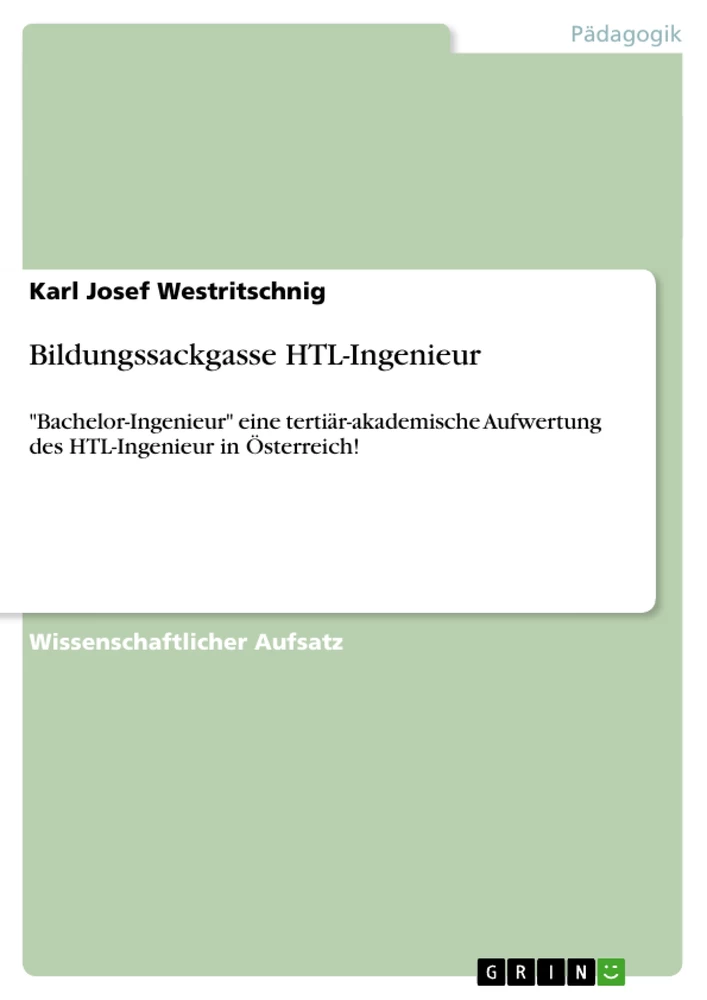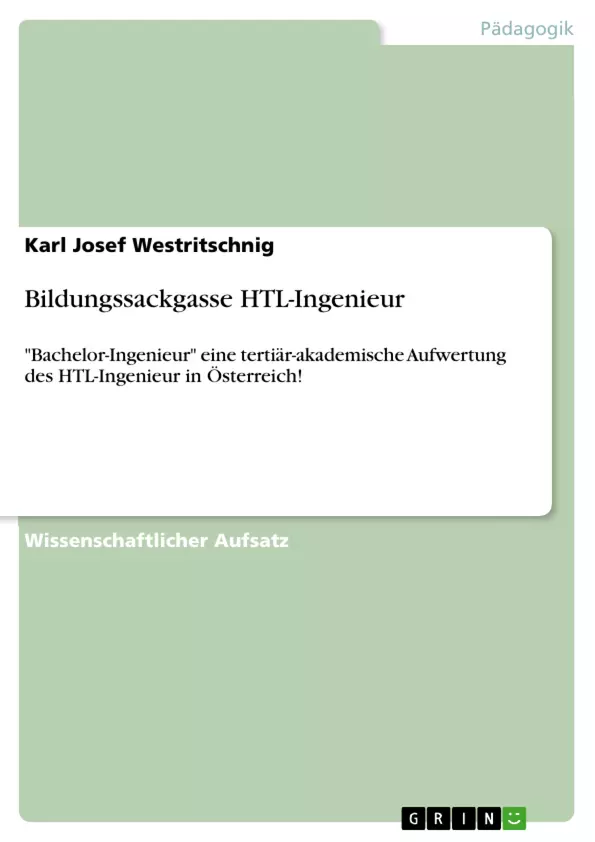Eine Weiterentwicklung der Standesbezeichnung „Ingenieur“, die bereits seit
dem Jahre 1917 durch eine kaiserliche Verordnung geschützt ist, sollte
unbedingt erfolgen. Im Prinzip hat sich seit dieser Zeit zur Erlangung der
Standesbezeichnung Ingenieur“ methodisch nichts getan. Es wird nur die
erforderliche Praxisdauer von acht auf drei Jahre in der Gegenwart verringert. In
der Zwischenkriegszeit wird die Standesbezeichnung Ingenieur den Absolventen
der Technischen Hochschule, ohne Praxiserfordernis unmittelbar verliehen.
Es liegt im Interesse der Absolventen und der Gesellschaft, als auch der
gewerblich-industriellen Wirtschaft. Die qualifizierte Dienstleistungswirtschaft
wird für die HTL-Absolventen zunehmend wichtig. Der HTL-Ingenieur
vermittelt eine praktische und anwendungsorientierte Qualifizierung. Die hohe
Arbeitsmarkt- und Berufsfähigkeit der HTL-Absolventen wird europäisch als
tertiärwürdig angesehen. Die Wirtschaft fragt diese technische
Qualifikationsebene sehr nach. Eine Aufwertung des in der Vergangenheit
bewährten HTL-Ingenieurs, zu einem Europa- und Bologna konformen
„Bachelor-Ingenieur“ wird zunehmend notwendig. Die österreichische Unikat-
Ingenieurbildung auf der Sekundarstufe II bewegt sich zunehmend in eine
Sackgasse. Die europäischen Bildungsprozesse erfordern vor allem auch im
Sinne der Absolventen eine Aufwertung der HTL-Ingenieurbildung.
Wirtschaftsnahen Studie wird entnommen, dass HTL-Absolventen kaum Über- und dequalifiziert erwerbsmäßig beschäftigt sind Diese Absolventen weisen im
Allgemeinen eine hohe Arbeitszufriedenheit auf. Bei dieser Bildungs- und
Qualifikationsebene herrscht in der Wirtschaft ein großer Bedarf. [...]
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
1 Standesbezeichnung Ingenieur mit einer formalen Höherqualifizierung zum akademischen „Bachelor-Ingenieur“
2 HTL-Altingenieure und eine formale Höherqualifizierung zum tertiär-akademischen Bologna „Bachelor-Ingenieur“
3 Standesbezeichnung Ingenieur mit 3-jähriger Ingenieurpraxis traditionell durch das Wirtschaftsministerium verliehen“
4 Europakonformes Zukunftsmodell: Absolventen zum Bachelor-Ingenieur mit Rückbindung an das Bildungssystem
4.1 Absolventen der Höheren Technischen Lehranstalten
4.2 Absolventen der Höheren Land- und Forstwirtschafts Lehranstalten
5 Rückbindung der Ingenieurpraxis dual an das Bildungssystem qualifiziert Ingenieure zum „Bachelor-Ingenieur“
6 Literaturverzeichnis
7 Abkürzungsverzeichnis
Autor Karl Westritschnig
Vorbemerkung
Eine Weiterentwicklung der Standesbezeichnung „Ingenieur“, die bereits seit dem Jahre 1917 durch eine kaiserliche Verordnung geschützt ist, sollte unbedingt erfolgen. Im Prinzip hat sich seit dieser Zeit zur Erlangung der Standesbezeichnung Ingenieur“ methodisch nichts getan. Es wird nur die erforderliche Praxisdauer von acht auf drei Jahre in der Gegenwart verringert. In der Zwischenkriegszeit wird die Standesbezeichnung Ingenieur den Absolventen der Technischen Hochschule, ohne Praxiserfordernis unmittelbar verliehen.
Es liegt im Interesse der Absolventen und der Gesellschaft, als auch der gewerblich-industriellen Wirtschaft. Die qualifizierte Dienstleistungswirtschaft wird für die HTL-Absolventen zunehmend wichtig. Der HTL-Ingenieur vermittelt eine praktische und anwendungsorientierte Qualifizierung. Die hohe Arbeitsmarkt- und Berufsfähigkeit der HTL-Absolventen wird europäisch als tertiärwürdig angesehen. Die Wirtschaft fragt diese technische Qualifikationsebene sehr nach. Eine Aufwertung des in der Vergangenheit bewährten HTL-Ingenieurs, zu einem Europa- und Bologna konformen „Bachelor-Ingenieur“ wird zunehmend notwendig. Die österreichische Unikat-Ingenieurbildung auf der Sekundarstufe II bewegt sich zunehmend in eine Sackgasse. Die europäischen Bildungsprozesse erfordern vor allem auch im Sinne der Absolventen eine Aufwertung der HTL-Ingenieurbildung. Wirtschaftsnahen Studie wird entnommen, dass HTL-Absolventen kaum Über- und de-qualifiziert erwerbsmäßig beschäftigt sind Diese Absolventen weisen im Allgemeinen eine hohe Arbeitszufriedenheit auf. Bei dieser Bildungs- und Qualifikationsebene herrscht in der Wirtschaft ein großer Bedarf.
Eine „duale“ Anbindung der 3-jährigen gehobenen und facheinschlägigen Ingenieurpraxis an das HTL-Bildungssystem sollte erfolgen. Eine Höherqualifizierungsmöglichkeit vom unmittelbaren HTL-Absolventen zum tertiär-akademischen „Bachelor-Ingenieur“ muss gegeben sein. Die Bachelor-Ingenieurprüfung liegt über dem Diplomniveau und gerechtfertigt somit eine tertiär-akademische Aufwertung in die Hochschulebene. Damit soll auf formalem Wege eine Durchlässigkeit zu den Masterprogrammen der Fachhochschulen und Universitäten erreicht werden. Eine nicht notwendige Bildungsredundanz und Bildungssackgasse muss für HTL-Absolventen beseitigt werden. Die bestehende österreichische Unikat-Ingenieurbildung und die vom Wirtschaftsministerium verliehene Standesbezeichnung Ingenieur wird in den tertiär-akademischen Bachelor-Bereich gehoben. Es erfolgt eine „duale“ Rückbindung der Ingenieurpraxis an das bestehende HTL-Bildungssystem. In weiterer Folge ist auch ein Zugang zu den Master- und Doktoranden Studien- und Forschungsprogrammen möglich. Bei den Absolventen der Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Lehranstalten kann die Höherqualifizierung durch die dreijährige gehobene Ingenieurpraxis, ebenfalls analog durch Rückbindung an das bestehende Bildungssystem erfolgen.
Es sollte möglich sein, durch eine Höherqualifizierung ohne Bildungsredundanz, diese bewährte qualitätsvolle, praxisnahe und anwendungsorientierte österreichische HTL-Ingenieurbildung als Bachelorwürdig tertiär-akademischen zu positionieren. Eine berufliche und gesellschaftliche Aufwertung des HTL-Ingenieur wird zunehmend erforderlich. Der HTL-Ingenieur muss zum „Bachelor-Ingenieur“ infolge Höherqualifizierung aufgewertet werden. Die fast hundertjährige Qualitätsmarke Standesbezeichnung Ingenieur“ sollte bei Bildungsüberlegungen und Schulentwicklungen zentral als erstes berücksichtigt werden. Die HTL-Ingenieure treten oft mit Fachhochschulabsolventen und auch Universitätsabsolventen unmittelbar in Konkurrenz. Die Spezialisierung und die Praxiserfahrung des HTL-Absolventen im Betrieb sind vor allem auch für Klein- und Mittelbetriebe von großer Bedeutung. Diese beruflich-fachliche Höherqualifizierung muss durch eine „duale“ Rückbindung an das bestehende HTL-Bildungssystem, mit Überlegungen des Europakonformen Bologna-Zukunftsmodells eines „Bachelor-Ingenieur“ erfolgen. Wer sich über die Standesbezeichnung Ingenieur hinaus, ohne Bildungsredundanz persönlich und beruflich weiterentwickeln will, soll formal durch das ein „weiterentwickeltes“ HTL-Bildungssystem die Möglichkeit bekommen. Der finanzielle, organisatorische und pädagogisch-didaktische Aufwand hält sich in Grenzen. Diese Forschungsarbeit ist eine Beilage zur Dissertation und diese stellt die Möglichkeiten einer HTL-Ingenieurbildung modellhaft-schematisch dar:
1. HTL-Absolventen zum „BACHELOR-Ingenieur“ qualifizieren, durch eine „duale“ Rückbindung der Ingenieurpraxis an das HTL-Bildungssystem
2. HTL-Altingenieure zum „BACHELOR-Ingenieur“ durch eine geringe Modifizierung des vorherigen Modells.
3. HTL-Absolventen und durch den traditionellen Weg einer 3-jährigen Ingenieurpraxis zur Standesbezeichnung Ingenieur.
4. HTL-HLFL-Absolventen und Altingenieure eine modellhaft-schematische Zusammenfassung zum höher qualifizierten „BACHELOR-Ingenieur“.
1 Standesbezeichnung Ingenieur mit einer formalen Höherqualifizierung zum akademischen „Bachelor-Ingenieur“
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument behandelt die Weiterentwicklung der Standesbezeichnung „Ingenieur“ in Österreich, insbesondere im Hinblick auf eine Höherqualifizierung zum akademischen „Bachelor-Ingenieur“ gemäß den Bologna-Kriterien.
Warum ist eine Weiterentwicklung der Standesbezeichnung „Ingenieur“ notwendig?
Eine Weiterentwicklung ist notwendig, um die österreichische Ingenieurbildung (insbesondere die der HTL-Absolventen) an die europäischen Bildungsstandards anzupassen und die Arbeitsmarkt- und Berufsfähigkeit der Ingenieure zu erhöhen. Der bestehende Unikat-Ingenieurabschluss soll tertiär-akademisch aufgewertet werden, um Bildungsredundanz zu vermeiden und den Zugang zu Masterprogrammen zu ermöglichen.
Wer profitiert von dieser Weiterentwicklung?
Absolventen der HTL und Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Lehranstalten (HLFL), die Gesellschaft, die gewerblich-industrielle Wirtschaft und die qualifizierte Dienstleistungswirtschaft profitieren von dieser Weiterentwicklung.
Was ist der Kern der vorgeschlagenen Lösung?
Der Kern der Lösung ist eine "duale" Anbindung der 3-jährigen Ingenieurpraxis an das HTL-Bildungssystem. HTL-Absolventen sollen die Möglichkeit erhalten, sich zum tertiär-akademischen „Bachelor-Ingenieur“ weiterzuqualifizieren. Diese Höherqualifizierung soll formalen Zugang zu Masterprogrammen ermöglichen.
Wie soll die Höherqualifizierung zum „Bachelor-Ingenieur“ konkret aussehen?
Die Höherqualifizierung soll durch einen "Ingenieurpraxis-Vertrag" mit einem Betrieb und die Betreuung durch eine HTL erfolgen. Die Absolventen verfassen eine "Ingenieurpraxis-Studie" und legen eine kommissionelle Bachelor-Ingenieurprüfung ab. Die Prüfung geht über das Niveau der Diplomprüfung hinaus und beinhaltet eine erweiterte Prüfung in ausgewählten Lehrfächern.
Was ist die Rolle des Unterrichtsministeriums?
Das Unterrichtsministerium legt die Rahmenbedingungen für den Bachelor-Ingenieur Studienplan fest, der flächendeckend für Österreich gilt.
Welche Vorteile ergeben sich durch die Höherqualifizierung?
Die Höherqualifizierung führt zu einer gesellschaftlich-beruflichen Statusaufwertung der HTL-Absolventen, einer Aufwertung des Bildungsortes Höhere Technische Lehranstalten und einer besseren Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt.
Welche Modelle werden vorgeschlagen?
Es werden Modelle vorgeschlagen, um HTL-Absolventen, HTL-Altingenieure und Absolventen der HLFL durch eine Rückbindung der Ingenieurpraxis an das Bildungssystem zum "BACHELOR-Ingenieur" zu qualifizieren.
Was bedeutet "duale" Rückbindung der Ingenieurpraxis?
"Duale" Rückbindung bedeutet, dass die praktische Erfahrung im Betrieb (Ingenieurpraxis) eng mit dem theoretischen Wissen an der HTL verknüpft wird. Die HTL betreut und begleitet die praktische Ausbildung, und die erworbenen Kenntnisse werden im Rahmen der Bachelor-Ingenieurprüfung bewertet.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. MMag. Dr. Karl Josef Westritschnig (Author), 2012, Bildungssackgasse HTL-Ingenieur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203054