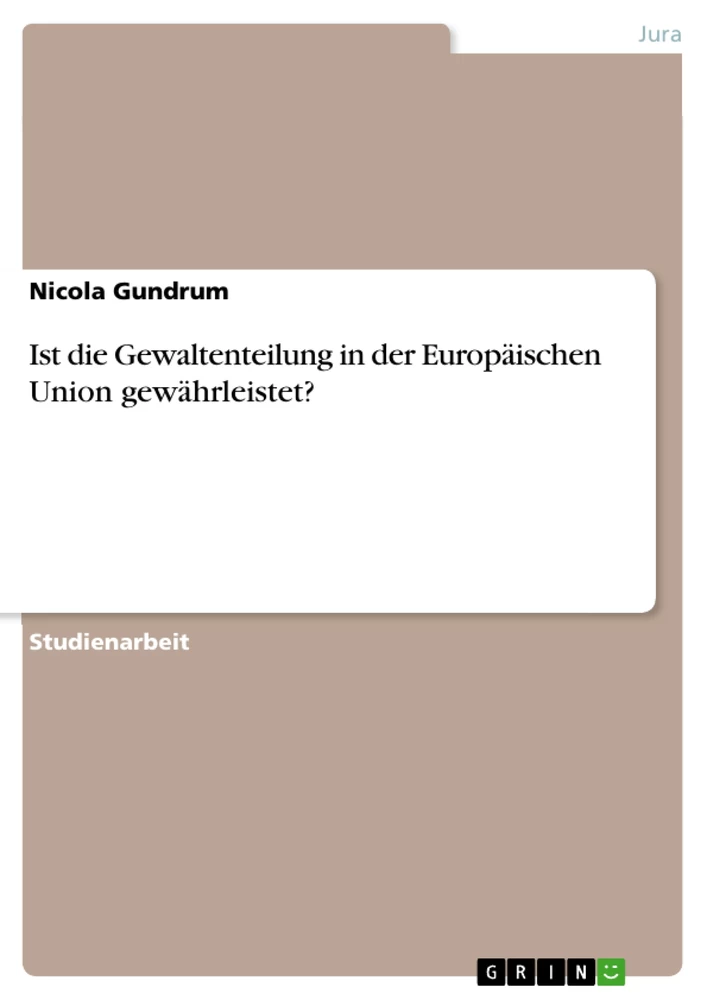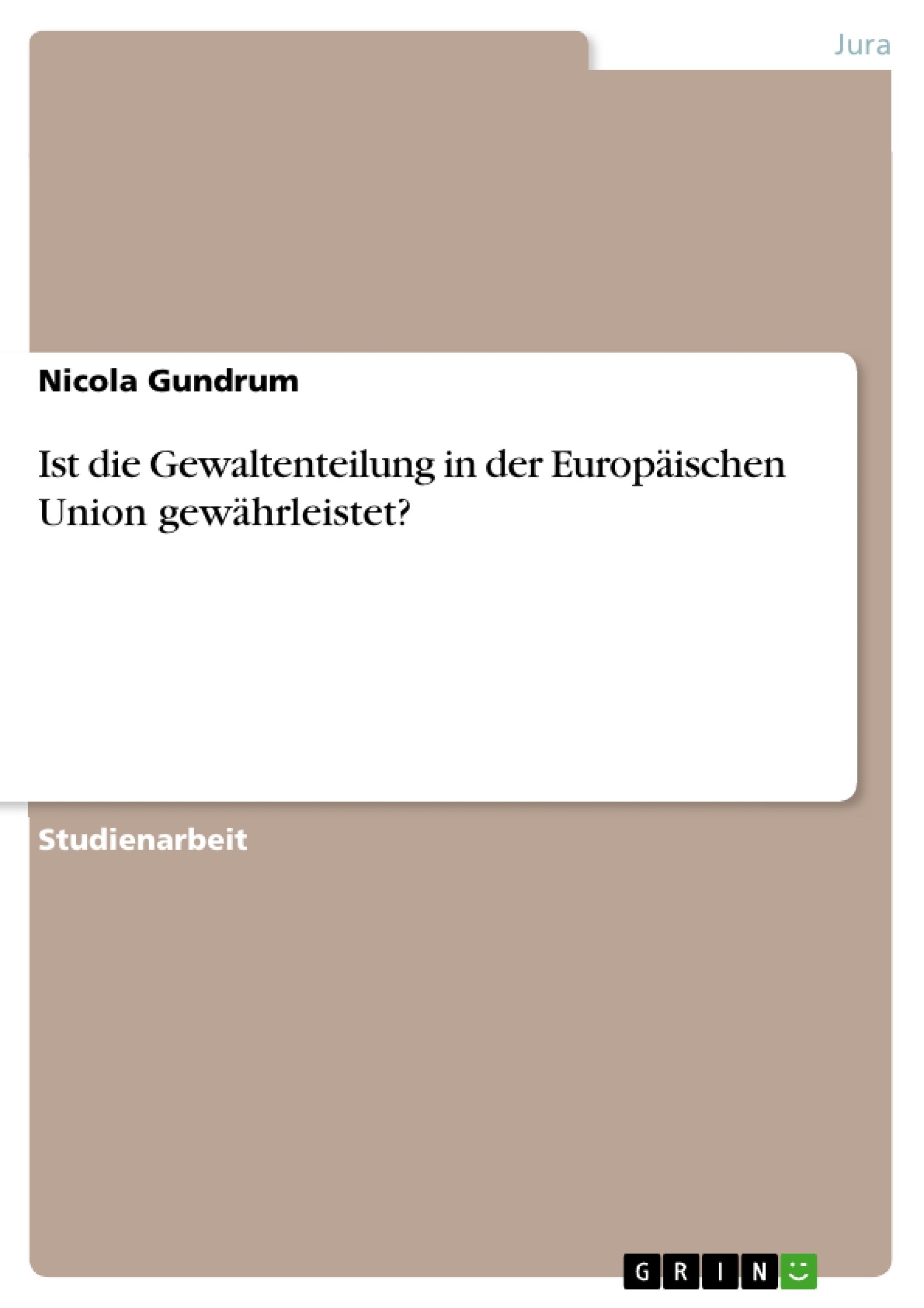Als im Jahre 1952 mit dem Vertrag von Paris die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) geschaffen wurde, war der damit einsetzende, einzigartige Entwicklungs- und Integrationsprozess, der zur heutigen Europäischen Union (EU) führte, kaum voraussehbar.
Schritt für Schritt wurden die Kompetenzen von der nationalen auf die supranationale Ebene übertragen, sodass die EU sich von einer wirtschaftlichen Interessengemeinschaft zu einem komplexen Mehrebenensystem formierte, welches „irgendwo zwischen Staatenbund und Bundesstaat“ anzuordnen ist.
Bei diesem Prozess müssen die demokratischen und machtmissbrauchsschützenden Strukturen, die in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten über Jahrhunderte hinweg errungen wurden sind, berücksichtigt werden. Die Grundstruktur bietet hierbei die Gewaltenteilung, die in den Verfassungen der einzelnen Mitgliedsstaaten festgeschrieben ist.
Vertrauen in die EU und Unterstützung dieser durch deren Bürger ist abhängig von einer klaren Struktur, Transparenz und demokratischen Verhältnissen in Form einer klaren Gewaltenteilung. Eine schwache Wahlbeteiligung an den Europawahlen von 43% im Jahr 2009 verweist hier auf ein Defizit. Im Gegensatz dazu lag beispielsweise die Wahlbeteiligung an den Bundestagswahlen in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) bei 72% im Jahr 2009, die jedoch auch schon als sehr gering eingestuft wurde. Dies leitet über zu folgender Fragestellung, auf welche in den nächsten Kapiteln eine Antwort gefunden werden soll: Ist die Gewaltenteilung in der EU gewährleistet?
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Das Prinzip der Gewaltenteilung
3 Die Gewaltenteilung in der Europäischen Union
3.1 EU-Kommission
3.1.1 Ernennungsprozess
3.1.2 Aufgabenspektrum
3.1.2.1 Gesetzgebenden Funktionen der EU-Kommission
3.1.2.2 Exekutivfunktionen der EU-Kommission
3.1.2.3 Judikative Funktionen der EU-Kommission
3.1.2.4 Repräsentativfunktionen der EU-Kommission
3.1.3 Zusammenfassung EU-Kommission
3.2 EU-Ministerrat
3.2.1 Exekutivfunktionen des EU-Ministerrats
3.2.2 Zusammenfassung EU-Ministerrat
3.3 EU-Parlament
3.3.1 Kontrollfunktionen und Haushaltsbefugnisse des EU-Parlaments
3.3.2 Legislativfunktionen des EU-Parlaments
3.3.3. Zusammenfassung EU-Parlament
3.4 Europäische Gerichtshof (EuGH)
3.4.1 Judikative Funktionen des Europäischen Gerichtshofs
3.4.2 Gesetzgebende Funktionen des Europäischen Gerichtshofs
3.4.3 Zusammenfassung Europäischer Gerichtshof
4 Fazit
Literaturverzeichnis
- Citation du texte
- Nicola Gundrum (Auteur), 2012, Ist die Gewaltenteilung in der Europäischen Union gewährleistet?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203378