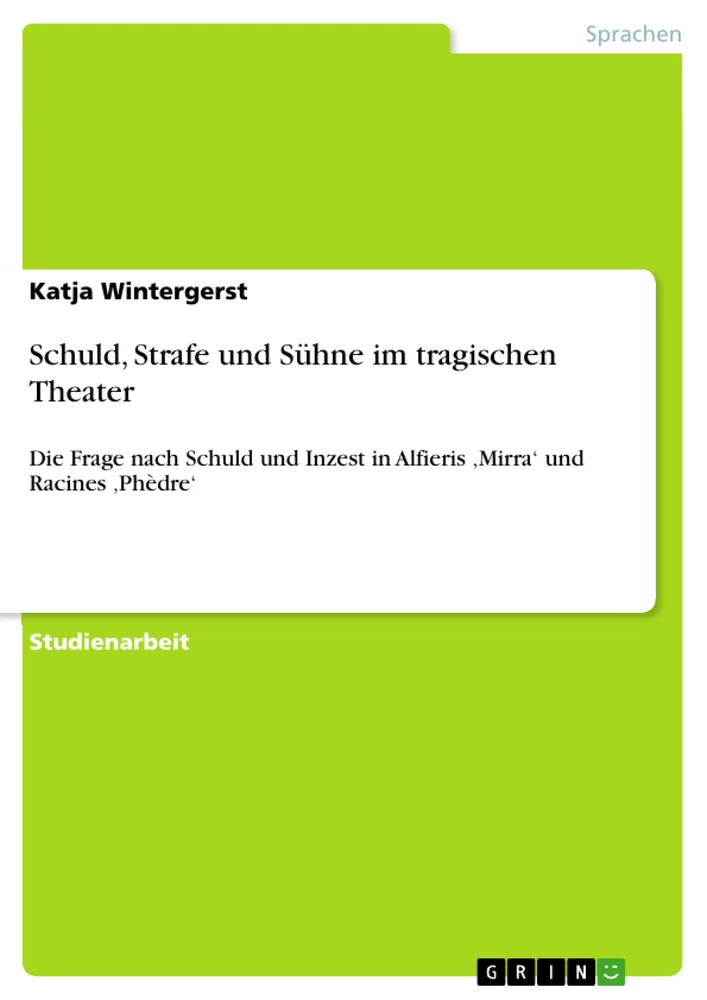Seit Jahrhunderten sind Themen wie Inzest, Schuld und Strafe beliebte Motive in der Literatur. Der Mythos der Tötung des Vaters und der sexuellen Hingabe zur Mutter veranlasste schon in der Antike Sophokles dazu, sein bis heute zur Weltliteratur zählendes Werk „König Ödipus“ zu schreiben. Seit damals beschäftigten sich einige bedeutende Dramatiker wie z.B. Aischylos, Euripides, Seneca oder Friedrich Hölderlin mit diesem Stoff. Auch Shakespeares „Hamlet“ und Goethes „Don Carlos“, die sich inhaltlich dem Inzestdrama widmen, zählen zu den großen Werken der Literatur. (vgl. Rank 1912: 40-63)
In allen Tragödien, die sich mit Schuld, Strafe, Inzest oder Vergeltung beschäftigen, spielt das Fehlen einer Ordnung eine zentrale Rolle. Es wird eine Welt inszeniert, die beherrscht wird von Verfehlung, Unordnung und Sittenlosigkeit, ausgelöst durch die Schuld einer oder mehrerer Personen. Durch Vergeltung oder Strafe kann, muss aber nicht die Ordnung wieder hergestellt werden.
Der französische Literaturwissenschaftler, Kulturanthropologe und Religionsphilosoph René Girard beschäftigt sich in seiner ‚mimetischen Theorie‘ mit eben jenen Tragödien von Sophokles und Euripides und versucht anhand des aus der griechischen Antike überlieferten Sagenstoffs zu erklären, wie durch tragische Destabilisierung und krisenhaften Abbau von Hierarchien Lösungen für diese Situationen gefunden werden können. Zentrale Begriffe sind Nachahmung und Gewalt.
Doch ist dieses Prinzip des ordnungsstiftenden Sündenbocks immer anwendbar? Kann ein willkürlich als schuldig Verurteilter tatsächlich die Ord-nung wieder herstellen? Und welche Art von Strafe oder Vergeltung ist für diesen Vorgang nötig?
Diese Arbeit vergleicht das italienische Drama „Mirra“ von Vittorio Alfieri mit dem französischen Drama „Phèdre“ von Jean Baptiste Racine im Hinblick auf die Frage nach Schuld und Strafe und ob Girards These des Sündenbockmechanismus in diesem Fall anwendbar ist. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schuld- und der Inzestfrage, d.h. ob sich die Protagonisten der Dramen der inzestuösen Liebe hingeben und damit eine schuldhafte Sünde begehen und inwieweit Vergeltung oder Bestrafung die Ordnung wiederherstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 René Girard und Inzest, Schuld und Strafe in der Literatur
- 2 Vittorio Alfieri und seine Tragödie „Mirra“
- 2.1 Biographie Alfieris und Einführung in „Mirra“
- 2.2 Die Schuldfrage – Wer hat Schuld am Leiden Mirras?
- 2.3 Die Inzestfrage - Liegt hier wirklich Inzest vor?
- 2.4 Funktioniert Girards Sündenbocktheorie bei „Mirra“?
- 3 Jean Racine und seine Tragödie „Phèdre“
- 3.1 Einführung in „Phèdre“
- 3.2 Die Schuld- und Inzestfrage bei „Phèdre“
- 3.3 Die Sündenbocktheorie bei „Phèdre“
- 4 Abschließender Vergleich und Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Tragödien „Mirra“ von Vittorio Alfieri und „Phèdre“ von Jean Racine im Hinblick auf die Themen Schuld, Strafe und Inzest. Die zentrale Fragestellung ist, inwieweit René Girards Sündenbocktheorie auf diese Dramen anwendbar ist. Die Analyse konzentriert sich auf die Schuldzuweisung an die Protagonisten und die Frage nach der tatsächlichen Existenz von Inzest in den Stücken.
- Anwendung der mimetischen Theorie von René Girard auf literarische Werke
- Analyse der Schuldfrage in den Tragödien „Mirra“ und „Phèdre“
- Untersuchung des Inzestmotivs in beiden Dramen
- Bewertung der Funktionalität des Sündenbockmechanismus in den jeweiligen Kontexten
- Vergleich der beiden Dramen und ihrer Darstellung von Schuld, Strafe und Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
1 René Girard und Inzest, Schuld und Strafe in der Literatur: Dieses Kapitel führt in die Thematik von Inzest, Schuld und Strafe in der Literatur ein und stellt René Girards mimetische Theorie vor. Girard analysiert, wie mimetisches Begehren zu Gewalt und gesellschaftlicher Destabilisierung führt und wie die Opferung eines Sündenbocks die Ordnung wiederherstellen kann. Das Kapitel beleuchtet die zentrale Rolle von Nachahmung und Gewalt in tragischen Konflikten und legt den theoretischen Rahmen für die folgende Analyse der Dramen Alfieris und Racines. Beispiele aus der antiken griechischen Tragödie und Werken von Shakespeare und Goethe veranschaulichen die weitverbreitete Beschäftigung mit diesen Motiven in der Literaturgeschichte. Die Frage nach der Anwendbarkeit des Sündenbockprinzips wird als leitendes Thema für die weitere Untersuchung eingeführt.
2 Vittorio Alfieri und seine Tragödie „Mirra“: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in das Leben und Werk von Vittorio Alfieri und konzentriert sich auf seine Tragödie „Mirra“. Es wird Alfieris Biographie skizziert, um den Kontext seiner Arbeit zu verstehen, insbesondere seinen kritischen Standpunkt zum Absolutismus. Die Inhaltsangabe von „Mirra“ wird kurz dargestellt, bevor die Arbeit sich der Analyse der Schuldfrage und des Inzestmotivs widmet. Die zentrale Frage ist, ob Mirra schuldig ist und ob der Inzest tatsächlich stattfindet. Schließlich wird untersucht, ob Girards Sündenbocktheorie auf diese spezifische Tragödie angewendet werden kann, unter Berücksichtigung der psychologischen Komplexität des Stücks und der Abweichung vom traditionellen dramatischen Rahmen, die Alfieri selbst hervorhebt.
Schlüsselwörter
Mimetische Theorie, René Girard, Sündenbockmechanismus, Schuld, Strafe, Inzest, Vittorio Alfieri, Mirra, Jean Racine, Phèdre, Tragödie, klassisches Drama, Gewalt, Ordnung, mimetisches Begehren.
Häufig gestellte Fragen zu: René Girard und Inzest, Schuld und Strafe in der Literatur (Alfieri & Racine)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Tragödien „Mirra“ von Vittorio Alfieri und „Phèdre“ von Jean Racine unter dem Aspekt von Schuld, Strafe und Inzest. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit René Girards Sündenbocktheorie auf diese Dramen angewendet werden kann.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf der mimetischen Theorie von René Girard. Girards Theorie erklärt, wie mimetisches Begehren zu Gewalt und sozialer Destabilisierung führt und wie die Opferung eines Sündenbocks die soziale Ordnung wiederherstellen kann.
Welche Dramen werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf zwei klassische Tragödien: „Mirra“ von Vittorio Alfieri und „Phèdre“ von Jean Racine. Die Arbeit vergleicht die Darstellung von Schuld, Strafe und Inzest in beiden Dramen.
Welche zentralen Fragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Schuldzuweisung an die Protagonisten in beiden Dramen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, ob Inzest tatsächlich in den Stücken vorkommt. Schließlich wird geprüft, ob und wie Girards Sündenbockmechanismus in den jeweiligen Kontexten funktioniert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 führt in die Theorie von René Girard und die Thematik von Schuld, Strafe und Inzest ein. Kapitel 2 analysiert Alfieris „Mirra“, Kapitel 3 Racines „Phèdre“, und Kapitel 4 vergleicht die Ergebnisse beider Analysen.
Welche Aspekte von Alfieris „Mirra“ werden analysiert?
Die Analyse von „Mirra“ umfasst eine kurze Biographie Alfieris, eine Inhaltsangabe des Dramas, eine Untersuchung der Schuldfrage, eine Auseinandersetzung mit dem Inzestmotiv und schließlich eine Bewertung der Anwendbarkeit von Girards Sündenbocktheorie auf das Stück.
Welche Aspekte von Racines „Phèdre“ werden analysiert?
Die Analyse von „Phèdre“ beinhaltet eine Einführung in das Drama, eine Untersuchung der Schuld- und Inzestfrage und eine Bewertung der Anwendbarkeit von Girards Sündenbocktheorie.
Welches Ergebnis wird angestrebt?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen Vergleich der beiden Dramen im Hinblick auf Schuld, Strafe und Inzest vorzunehmen und zu untersuchen, inwieweit Girards mimetische Theorie und der Sündenbockmechanismus diese literarischen Werke erklären können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Mimetische Theorie, René Girard, Sündenbockmechanismus, Schuld, Strafe, Inzest, Vittorio Alfieri, Mirra, Jean Racine, Phèdre, Tragödie, klassisches Drama, Gewalt, Ordnung, mimetisches Begehren.
- Quote paper
- B.A. Katja Wintergerst (Author), 2011, Schuld, Strafe und Sühne im tragischen Theater, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203392