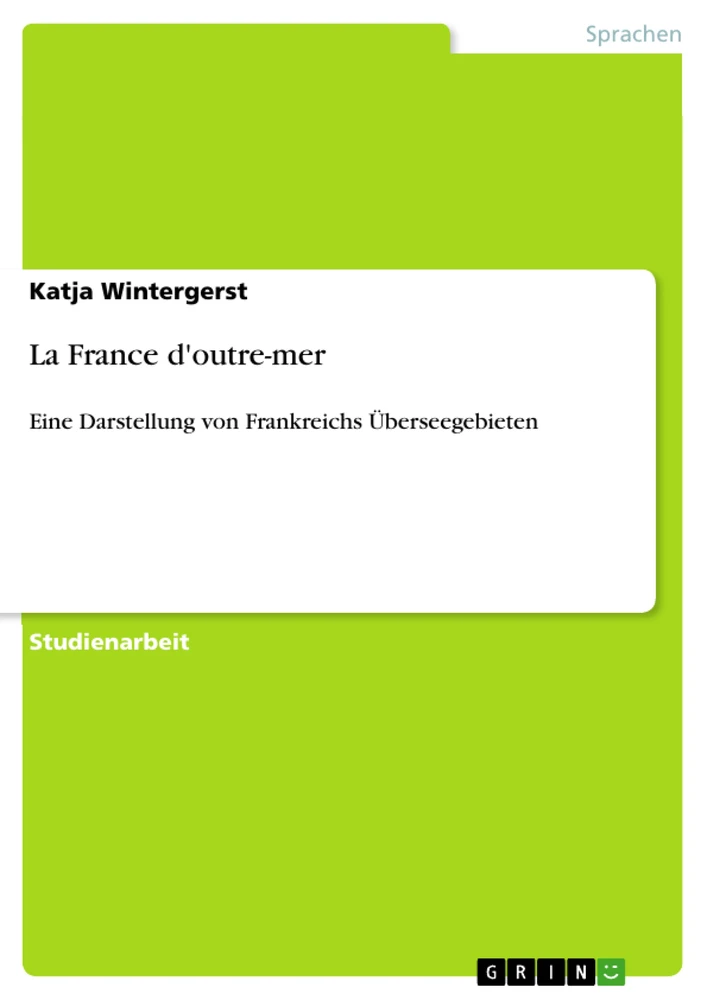Die Gesamtfläche Frankreichs einschließlich der Inseln in Europa beträgt 547.030 km², davon sind ca. 545.000 km² Landfläche und 1.400 km² Wasserfläche. Frankreich ist somit der flächenmäßig größte Staat Westeuropas. Nach Deutschland liegt Frankreich innerhalb der Europäischen Union mit 65, 53 Millionen Einwohnern auf dem zweiten Platz. (vgl. INSEE: estimations de population et statistiques de l’état civil )
Neben dem Territorium auf dem europäischen Festland gehören zu Frankreich jedoch auch Überseegebiete in der Karibik, Südamerika, vor der Küste Nordamerikas, im Indischen Ozean und in Ozeanien sowie ein Teil der Antarktis. Diese Überseegebiete, Reste des einstigen Kolonialreiches Frankreich, haben insgesamt eine Fläche von ca. 120.000 km² (ohne die antarktischen Gebiete) und eine Bevölkerungszahl von ca. 2,65 Millionen. (vgl. alles Ministère des affaires étrangères et européennes 2010)
Diese Arbeit skizziert im Folgenden erst kurz die Kolonialgeschichte Frankreichs über die letzten fünf Jahrhunderte, um verständlich zu machen, warum Teile des französischen Staatsgebiets außerhalb Europas liegen.
Dann werden die Gebiete systematisch, ihrer verwaltungsmäßigen Einteilung folgend, vorgestellt.
Als Abschluss soll kurz das zuständige Ministerium sowie die allgemeinen Bedingungen und Zukunftsaussichten beschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Frankreichs Staatsgebiete außerhalb Europas
- Kolonialmacht Frankreich
- Französische Kolonialisierung
- Französische Dekolonialisierung
- Frankreichs Überseegebiete
- Départements et régions d'outre-mer (DOM-ROM)
- Collectivités d'outre-mer (COM)
- Collectivité sui generis (CSG)
- Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
- Das Überseeministerium
- Zustand und Zukunft der Überseegebiete
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den französischen Überseegebieten und ihrer Geschichte. Ziel ist es, einen Überblick über die Entwicklung der französischen Kolonialpolitik, die verschiedenen Verwaltungseinheiten der Überseegebiete und deren aktuellen Zustand zu geben. Die Arbeit verzichtet auf eine detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Gebieten, konzentriert sich aber auf die historischen und politischen Zusammenhänge.
- Die Geschichte der französischen Kolonialisierung
- Die verschiedenen Kategorien der französischen Überseegebiete
- Die Rolle des Überseeministeriums
- Der gegenwärtige Zustand der Überseegebiete
- Die Zukunftsperspektiven der Überseegebiete
Zusammenfassung der Kapitel
Frankreichs Staatsgebiete außerhalb Europas: Der einführende Abschnitt beginnt mit einer bildhaften Beschreibung von Frankreich als Hexagon, begrenzt durch natürliche Grenzen und offene Seewege. Er stellt den Kontrast zwischen dem europäischen Kernland und den weit verstreuten Überseegebieten heraus und liefert erste Zahlen zur Fläche und Bevölkerung Frankreichs, sowohl im europäischen Kernland als auch in den Überseegebieten. Diese Einleitung schafft eine geographische und demographische Grundlage für die nachfolgenden Kapitel und hebt die Bedeutung der Überseegebiete im Gesamtkontext des französischen Staats hervor.
Kolonialmacht Frankreich: Dieses Kapitel behandelt die lange Geschichte Frankreichs als Kolonialmacht, unterteilt in zwei Kolonialreiche. Es beschreibt den Aufstieg und Fall des ersten Kolonialreichs (1534-1815), beginnend mit den Erkundungen Jacques Cartiers und der Besiedlung Neufrankreichs. Es beleuchtet den territorialen Umfang und die Bevölkerung des ersten Kolonialreichs, das von Nordamerika bis zum Indischen Ozean reichte, sowie seinen Zerfall durch den Siebenjährigen Krieg und die Unabhängigkeit Haitis. Das zweite Kolonialreich (ab 1830) konzentrierte sich auf Afrika und Asien, erreichte nach dem Ersten Weltkrieg seine größte Ausdehnung, bevor es im 20. Jahrhundert nach und nach zerfiel.
Frankreichs Überseegebiete: Dieses Kapitel wird sich mit den verschiedenen Kategorien der französischen Überseegebiete auseinandersetzen – DOM-ROM, COM, CSG und TAAF – und deren jeweiligen administrativen Besonderheiten und politischen Status. Es wird die unterschiedlichen Beziehungen dieser Territorien zum französischen Mutterland beleuchten und mögliche historische oder kulturelle Verbindungen aufzeigen. Die Darstellung wird auf die Verwaltungsgliederung und die politischen Strukturen fokussieren, um die verschiedenen Rechtsordnungen und ihre Implikationen für die Bevölkerung der jeweiligen Gebiete zu verdeutlichen.
Das Überseeministerium: Dieser Abschnitt wird die administrative Struktur und die Funktionen des Ministeriums für die Überseegebiete beleuchten. Er wird die Zuständigkeiten des Ministeriums beschreiben, die politischen Entscheidungswege erörtern und die Rolle des Ministeriums in Bezug auf die Entwicklung und die Verwaltung der Überseegebiete erklären. Der Abschnitt wird auch die Beziehungen des Ministeriums zu anderen Ministerien und Institutionen sowie die wichtigen politischen Akteur*innen analysieren.
Schlüsselwörter
Frankreich, Überseegebiete, Kolonialismus, Dekolonialisierung, DOM-ROM, COM, CSG, TAAF, Überseeministerium, Verwaltung, Politik, Geschichte, Geographie, Bevölkerung.
Häufig gestellte Fragen zu: Frankreichs Staatsgebiete außerhalb Europas
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die französischen Überseegebiete. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Geschichte der französischen Kolonialpolitik, den verschiedenen Verwaltungseinheiten der Überseegebiete und deren aktuellem Zustand.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Geschichte der französischen Kolonialisierung und Dekolonialisierung, die verschiedenen Kategorien französischer Überseegebiete (DOM-ROM, COM, CSG, TAAF), die Rolle des französischen Überseeministeriums, der aktuelle Zustand und die Zukunftsperspektiven der Überseegebiete. Das Dokument beleuchtet die historischen und politischen Zusammenhänge und verzichtet auf detaillierte Beschreibungen einzelner Gebiete.
Welche Kategorien französischer Überseegebiete werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen Départements et régions d'outre-mer (DOM-ROM), Collectivités d'outre-mer (COM), Collectivité sui generis (CSG) und Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Es erläutert die administrativen Besonderheiten und den politischen Status jeder Kategorie.
Welche Rolle spielt das Überseeministerium?
Das Dokument beschreibt die administrative Struktur und die Funktionen des französischen Überseeministeriums. Es erläutert die Zuständigkeiten des Ministeriums, die politischen Entscheidungswege und die Rolle des Ministeriums in Bezug auf die Entwicklung und Verwaltung der Überseegebiete.
Wie ist die Geschichte der französischen Kolonialisierung dargestellt?
Die Darstellung der französischen Kolonialgeschichte gliedert sich in zwei Kolonialreiche: Das erste (1534-1815) mit Fokus auf Neufrankreich und seinen Zerfall, und das zweite (ab 1830) mit Schwerpunkt auf Afrika und Asien. Es wird der Aufstieg, die Ausdehnung und der spätere Zerfall der Kolonialreiche beschrieben.
Welche geographischen und demographischen Aspekte werden behandelt?
Die Einleitung stellt Frankreich als Hexagon dar und hebt den Kontrast zwischen dem europäischen Kernland und den weit verstreuten Überseegebieten hervor. Es werden erste Zahlen zur Fläche und Bevölkerung sowohl des europäischen Kernlands als auch der Überseegebiete präsentiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Frankreich, Überseegebiete, Kolonialismus, Dekolonialisierung, DOM-ROM, COM, CSG, TAAF, Überseeministerium, Verwaltung, Politik, Geschichte, Geographie, Bevölkerung.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist für akademische Zwecke konzipiert und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit den französischen Überseegebieten auf strukturierte und professionelle Weise.
- Citation du texte
- B.A. Katja Wintergerst (Auteur), 2012, La France d'outre-mer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203393