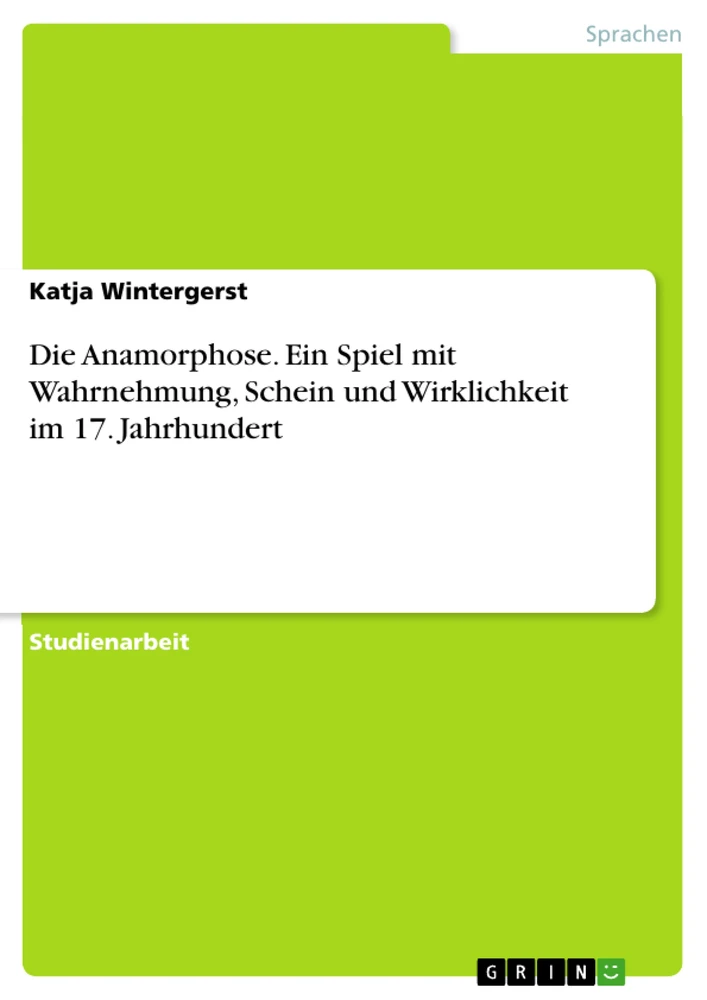Der Begriff der Anamorphose kommt ursprünglich aus der Biologie und bezeichnet tierische oder pflanzliche Gestaltwandelungen aufgrund von unerwarteten Veränderungen der Umwelt oder durch Veränderungen des Erbgutes eines Organismus.
Seit dem Beginn der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert in Europa etablierte sich der Begriff der Anamorphose jedoch auch in der Bildenden Kunst. Man versteht darunter die Darstellung einer Person, eines Gegenstandes oder eines Ereignisses, die in der normalen Ansicht nur verzerrt erscheint. Erst wenn der Betrachter das Bild selbst zurückformt, d.h. einen bestimmten Standpunkt oder Blickwinkel zum verzerrten Bild einnimmt oder spezielle Spiegel zu Hilfe nimmt, wird es ihm möglich, das anamorphotische Bild zu entzerren und seine Originalform zu erkennen. Dieser bestimmte Standpunkt kann vom Maler vorgegeben werden oder er muss vom Betrachter selbst erst herausgefunden werden, z.B. durch Bewegung im Raum oder Betrachtung von den Seiten.
Diese Arbeit soll anhand der Geschichte und der verschiedenen Herstellungsverfahren sowie der Einordnung in den kulturellen Kontext des 17. Jahrhunderts die Bedeutung von Anamorphosen aufzeigen und einen Einblick in das Mysterium der optischen Täuschung mittels Verzerrung geben und so eine Entdeckung der Unbekannten möglich machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Die Anamorphose
- 2.1 Begriffsklärung und Formen von Anamorphosen
- 2.2 Geschichte der Anamorphose
- 2.3 Verfahren zur Herstellung von Anamorphosen
- 2.4 Kultureller Kontext
- 2.5 Bedeutung von Anamorphosen im Kontext des 17. Jahrhunderts
- 3 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anamorphose im 17. Jahrhundert in Frankreich. Sie beleuchtet die Entwicklung der Anamorphose von ihren Anfängen bis zum 17. Jahrhundert, ihre verschiedenen Herstellungstechniken und ihren kulturellen Kontext. Ziel ist es, die Bedeutung von Anamorphosen als optische Täuschungen und deren Rolle in der Kunst und Philosophie des 17. Jahrhunderts aufzuzeigen.
- Etymologie und verschiedene Formen der Anamorphose
- Historische Entwicklung der Anamorphose von der Renaissance bis zum 17. Jahrhundert
- Verfahren zur Herstellung von Anamorphosen (projektiv und geometrisch)
- Der kulturelle Kontext der Anamorphose im französischen Barock und Cartesianismus
- Bedeutung der Anamorphose als Spiel mit Wahrnehmung, Schein und Wirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einführung beschreibt den Begriff der Anamorphose, ursprünglich aus der Biologie stammend, und seine Übernahme in die bildende Kunst. Sie erklärt das Prinzip der Anamorphose als verzerrte Darstellung, die erst aus einem bestimmten Blickwinkel oder mithilfe von Spiegeln ihre wahre Form offenbart. Die Einführung verweist auf Platos Auseinandersetzung mit künstlichen Trugbildern und skizziert die Geschichte der Anamorphose vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, wobei sie auf ihre Bedeutung im 17. Jahrhundert in Frankreich hinweist und die Zielsetzung der Arbeit darlegt.
2 Die Anamorphose: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der Anamorphose. Es beginnt mit einer etymologischen Erklärung des Begriffs und einer Unterscheidung verschiedener Formen (optisch, katoptrisch, dioptrisch). Die Geschichte der Anamorphose wird von ihren Anfängen bis ins 20. Jahrhundert nachgezeichnet, wobei bedeutende Künstler wie Leonardo da Vinci und Hans Holbein erwähnt werden. Es werden detailliert die verschiedenen Herstellungsverfahren, das projektive und das geometrische Verfahren, erläutert und schließlich die Einordnung der Anamorphose in den kulturellen Kontext des 17. Jahrhunderts, insbesondere in Bezug auf den französischen Barock und den Cartesianismus, vorgenommen.
Schlüsselwörter
Anamorphose, optische Täuschung, Perspektive, Renaissance, Barock, Frankreich, 17. Jahrhundert, Jean-François Niceron, Cartesianismus, Wahrnehmung, Schein, Wirklichkeit, projektives Verfahren, geometrisches Verfahren, Vanitas, memento mori.
Häufig gestellte Fragen: Anamorphose im 17. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Anamorphose im 17. Jahrhundert in Frankreich. Sie untersucht die Entwicklung, die Herstellungstechniken und den kulturellen Kontext dieser besonderen Form der optischen Täuschung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Etymologien und verschiedenen Formen der Anamorphose, ihre historische Entwicklung von der Renaissance bis ins 17. Jahrhundert, die Herstellungsverfahren (projektiv und geometrisch), den kulturellen Kontext im französischen Barock und Cartesianismus, und schließlich die Bedeutung der Anamorphose als Spiel mit Wahrnehmung, Schein und Wirklichkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einführung, ein Hauptkapitel "Die Anamorphose" und eine Zusammenfassung. Die Einführung erklärt den Begriff der Anamorphose und ihren historischen Kontext. Das Hauptkapitel bietet eine detaillierte Darstellung der verschiedenen Aspekte der Anamorphose, einschließlich der Geschichte, der Herstellungstechniken und des kulturellen Kontextes. Das dritte Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Wie wird die Anamorphose definiert?
Die Anamorphose wird definiert als eine verzerrte Darstellung, die erst aus einem bestimmten Blickwinkel oder mithilfe von Spiegeln ihre wahre Form offenbart. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Biologie und wurde in die bildende Kunst übernommen.
Welche Herstellungsverfahren werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert das projektive und das geometrische Verfahren zur Herstellung von Anamorphosen.
Welchen kulturellen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den kulturellen Kontext der Anamorphose im französischen Barock und im Kontext des Cartesianismus.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Anamorphose, optische Täuschung, Perspektive, Renaissance, Barock, Frankreich, 17. Jahrhundert, Jean-François Niceron (obwohl nicht explizit im Text erwähnt, ist es ein wichtiger Kontext), Cartesianismus, Wahrnehmung, Schein, Wirklichkeit, projektives Verfahren, geometrisches Verfahren, Vanitas, memento mori.
Welche historischen Persönlichkeiten werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt bedeutende Künstler wie Leonardo da Vinci und Hans Holbein im Zusammenhang mit der Geschichte der Anamorphose.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung von Anamorphosen als optische Täuschungen und deren Rolle in der Kunst und Philosophie des 17. Jahrhunderts aufzuzeigen.
- Citar trabajo
- B.A. Katja Wintergerst (Autor), 2012, Die Anamorphose. Ein Spiel mit Wahrnehmung, Schein und Wirklichkeit im 17. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203395