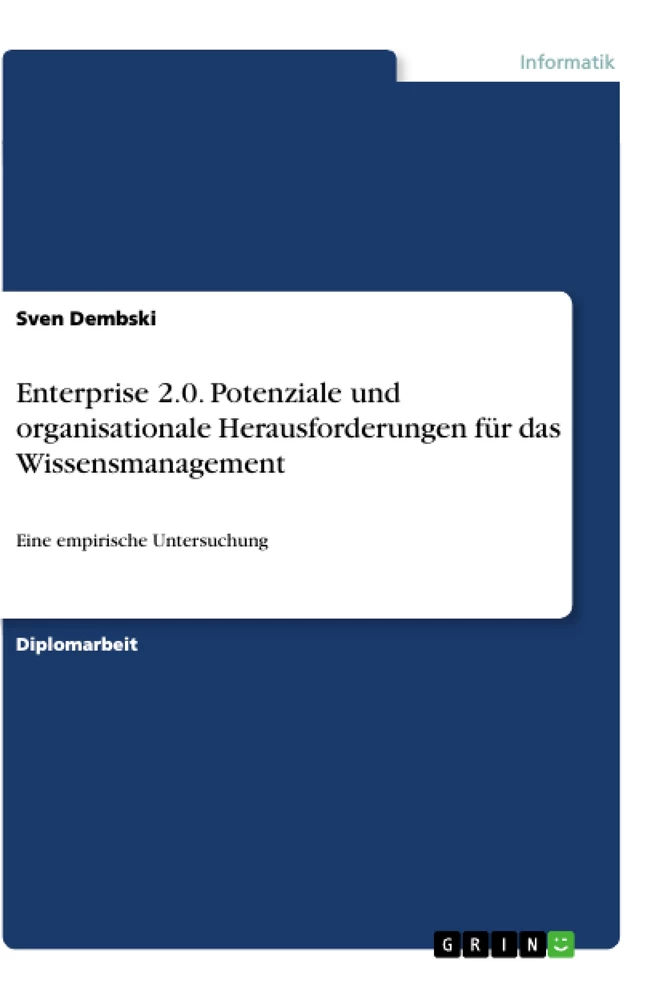Die vorliegende Arbeit stellt die Potenziale von Social Software-Anwendungen wie z. B. Wikis, Weblogs und Social Networks für den Einsatz im Unternehmenskontext („Enterprise 2.0“) dar. Für jede der untersuchten Anwendungen wird eine Sicht auf die interne Anwendung
im Unternehmen sowie eine Sicht auf den unternehmensexternen Einsatz eingenommen. Davon ausgehend werden die potenziellen Einsatzmöglichkeiten dieser Anwendungen, insbesondere für das Wissensmanagement, herausgearbeitet.
Darüber hinaus wird eine empirische Untersuchung (Unternehmensbefragung) durchgeführt, welche die durch den Einsatz von Social Software-Anwendungen hervorgerufenen Veränderungen bzw. Anpassungen der Organisationsstruktur und Unternehmenskultur, untersucht. Basierend auf den Ergebnissen wird der organisationale Wandel durch Enterprise 2.0 beschrieben.
Betrachtete Forschungsfragen sind:
- Welche Potenziale ergeben sich durch den Einsatz von Social Software für Unternehmen und welche Social Software-Anwendungen eignen sich besonders für das Wissensmanagement?
- Ist der Einsatz von Social Software-Anwendungen in Unternehmen bereits verbreitet und welche Anwendungen werden eingesetzt?
- Welche Voraussetzungen für Veränderungen in der Unternehmenskultur sind für den erfolgreichen Einsatz von Social Software notwendig und welche Veränderungen in der Organisationskultur haben bereits stattgefunden?
- Welche Anpassungen der Organisationsstruktur ergeben sich aus Veränderungen der Unternehmenskultur?
Inhaltsverzeichnis
BILDERVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGS- UND AKRONYMVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
1.1 MOTIVATION
1.2 GEGENSTAND UND ZIEL DER ARBEIT
1.3 METHODISCHER ANSATZ
1.4 GANG DER UNTERSUCHUNG
2. GRUNDLAGEN
2.1 WEB 2.0 UND SOCIAL SOFTWARE
2.1.1 Definition und Begriffserklärung
2.1.2 Arten von Social Software-Anwendungen
2.1.2.1 Wiki
2.1.2.2 Weblog
2.1.2.3 Social Network
2.1.2.4 Social Bookmark
2.1.2.5 Social Tag
2.1.2.6 Instant Message
2.1.2.7 Microblog
2.1.2.8 Podcast und Vodcast
2.1.3 Zusammenfassende Bemerkungen
2.2 ORGANISATIONSSTRUKTUR
2.2.1 Definition und Begriffserklärung
2.2.2 Dimensionen von Organisationsstrukturen
2.2.2.1 Auswahl der Strukturdimensionen
2.2.2.2 Art und Grad der Spezialisierung
2.2.2.3 Koordination
2.2.2.4 Konfiguration
2.2.2.5 Entscheidungsdelegation
2.2.2.6 Formalisierung
2.2.3 Formen von Organisationsstrukturen
2.2.3.1 Einliniensystem
2.2.3.2 Mehrliniensystem
2.2.3.3 Matrixorganisation
2.3 UNTERNEHMENSKULTUR
2.3.1 Definition und Begriffserklärung
2.3.2 Ebenen von Unternehmenskulturen nach SCHEIN
2.3.3 Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Organisationsstruktur
2.4 WISSENSMANAGEMENT
2.4.1 Definition und Begriffserklärung
2.4.2 Grundausrichtungen des Wissensmanagements
2.4.3 Arten von Wissen
2.4.4 Konzept des Wissensmanagement nach Probst
3. ENTERPRISE 2.0 - POTENTIALE FÜR UNTERNEHMEN
3.1 DEFINITION UND BEGRIFFSERKLÄRUNG
3.2 INTERNE SICHTWEISE
3.2.1 Wiki
3.2.2 Weblog
3.2.3 Social Network
3.2.4 Social Bookmark
3.2.5 Social Tag
3.2.6 Instant Message
3.2.7 Microblog
3.2.8 Podcast/ Videocast
3.2.9 Zusammenfassung
3.3 EXTERNE SICHTWEISE
3.3.1 Wiki
3.3.2 Weblog
3.3.3 Social Network
3.3.4 Social Bookmark
3.3.5 Social Tag
3.3.6 Instant Message
3.3.7 Microblog
3.3.8 Podcast/ Videocast
3.3.9 Zusammenfassung
4. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
4.1 MOTIVATION
4.2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON ONLINE-BEFRAGUNGEN
4.2.1 Vorteile von Online-Befragungen
4.2.2 Nachteile von Online-Befragungen
4.3 METHODISCHES VORGEHEN
4.3.1 Zielgruppe und Auswahl der Unternehmen
4.3.2 Vorstellung des Fragebogendesigns
4.3.3 Methoden zur statistischen Auswertung
4.4 EFS SURVEY
5. ERGEBNIS DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG
5.1 RÜCKLAUFQUOTE
5.2 ERGEBNIS DER ONLINE-BEFRAGUNG
5.2.1 Basisdaten
5.2.1.1 Unternehmensdaten
5.2.1.2 Wissensmanagement
5.2.2 kein Einsatz
5.2.2.1 Enterprise 2.0
5.2.2.2 Kultur und Organisation
5.2.3 Einsatz in Planung
5.2.3.1 Enterprise 2.0
5.2.3.2 Kultur und Organisation
5.2.4 Einsatz
5.2.4.1 Enterprise 2.0
5.2.4.2 Kultur und Organisation
5.3 ORGANISATIONALE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DAS WISSENSMANAGEMENT
6. LIMITATIONEN UND KRITISCHE WÜRDIGUNG
7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
7.1 ZUSAMMENFASSUNG
7.2 AUSBLICK
ANHANG
ANHANG I - E-MAIL-ANSCHREIBEN
ANHANG II - FRAGEBOGEN
ANHANG III - HÄUFIGKEITSTABELLEN
LITERATURVERZEICHNIS
Bilderverzeichnis
BILD 1: NETZWERK-VISUALISIERUNG BEI XING.COM
BILD 2: TAG-CLOUD ZUM THEMA ENTDECKEN AUF FLICKR.COM
BILD 3: KLASSIFIKATIONSSCHEMA VON SOCIAL SOFTWARE
BILD 4: EINLINIENSYSTEM
BILD 5: MEHRLINIENSYSTEM
BILD 6: MATRIXORGANISATION
BILD 7: DIE DREI EBENEN DER UNTERNEHMENSKULTUR NACH SCHEIN
BILD 8: ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ORGANISATIONSSTRUKTUR UND UNTERNEHMENSKULTUR
BILD 9: WISSENSTREPPE NACH NORTH
BILD 10 WISSENSZYKLUS NACH PROBST
BILD 11: FRAGEBOGENSTRUKTUR TEIL 1
BILD 12 FRAGEBOGENSTRUKTUR TEIL 2
BILD 13: BRANCHE
BILD 14: UNTERNEHMENSGRÖßE
BILD 15: STANDORTE
BILD 16: ORGANISATIONSSTRUKTUR
BILD 17: MITARBEITERPOSITION
BILD 18: ANZAHL IT-MITARBEITER
BILD 19: GRAD DER KOMMUNIKATION
BILD 20: GRAD DES WISSENSAUSTAUSCHS
BILD 21: WISSENSSPEICHERUNG UND WISSENSVERTEILUNG
BILD 22: BEGRIFFSVERSTÄNDNIS ENTERPRISE 2.0
BILD 23: EINSATZ VON ENTERPRISE 2.0?
BILD 24: ENTERPRISE 2.0-RISIKEN (KEIN EINSATZ)
BILD 25: ENTERPRISE 2.0-CHANCEN (KEIN EINSATZ)
BILD 26: VORSTELLBARE VERÄNDERUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (KEIN EINSATZ)
BILD 27: VORAUSSETZUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (KEIN EINSATZ)
BILD 28: VERÄNDERUNGEN IN DER ORGANISATIONSSTRUKTUR (KEIN EINSATZ)
BILD 29: ENTERPRISE 2.0-PLANUNG
BILD 30: ENTERPRISE 2.0-ZIELE (PLANUNG)
BILD 31: KONKRETE ANWENDUNGEN (PLANUNG)
BILD 32: EINSATZBEREICH (PLANUNG)
BILD 33: ART DES EINSATZES (PLANUNG)
BILD 34: EINSATZ PRIVAT (PLANUNG)
BILD 35: ERWARTETE VERÄNDERUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (PLANUNG)
BILD 36: VORAUSSETZUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (PLANUNG)
BILD 37: ERWARTETE VERÄNDERUNG DER OS (PLANUNG)
BILD 38: SEIT WANN ENTERPRISE 2.0-EINSATZ? (EINSATZ)
BILD 39: ENTERPRISE 2.0-ZIELE (EINSATZ)
BILD 40: EINSATZBEREICH (EINSATZ)
BILD 41: KONKRETE ANWENDUNGEN (EINSATZ)
BILD 42: ART DES EINSATZES (EINSATZ)
BILD 43: RICHTLINIEN (EINSATZ)
BILD 44: EINSATZ PRIVAT UND GESCHÄFTLICH (EINSATZ)
BILD 45: VORAUSSETZUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (EINSATZ)
BILD 46: ERWARTETE VERÄNDERUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (EINSATZ)
BILD 47: STATTGEFUNDENE VERÄNDERUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (EINSATZ)
BILD 48: GEGENÜBERSTELLUNG ERWARTET - STATTGEFUNDEN (EINSATZ)
BILD 49: VERÄNDERUNGEN DER ORGANISATIONSSTRUKTUR (EINSATZ)
BILD 50: HERAUSFORDERUNGEN AGGREGIERT
BILD 51: RISIKEN AGGREGIERT
BILD 52: AII - STARTSEITE
BILD 53: AII - UNTERNEHMENSDATEN
BILD 54: AII - WISSENSMANAGEMENT
BILD 55: AII - ENTERPRISE 2.0-BEGRIFFSVERSTÄNDNIS
BILD 56: AII - EINSATZ IN PLANUNG (FILTER)
BILD 57: AII - RISIKEN UND CHANCEN (KEIN EINSATZ)
BILD 58: AII - KULTUR UND ORGANISATION (KEIN EINSATZ)
BILD 59: AII - PLANUNG UND ZIELE (PLANUNG)
BILD 60: AII - EINSATZBEREICH (PLANUNG)
BILD 61: AII - RICHTLINIEN UND PRIVATER EINSATZ (PLANUNG)
BILD 62: AII - VERÄNDERUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN UNTERNEHMENSKULTUR (PLANUNG)
BILD 63: AII - VERÄNDERUNGEN ORGANISATIONSSTRUKTUR (PLANUNG)
BILD 64: AII - PLANUNG UND ZIELE (EINSATZ)
BILD 65: AII - EINSATZBEREICH (EINSATZ)
BILD 66: AII - RICHTLINIEN UND PRIVATER UND GESCHÄFTLICHER EINSATZ (EINSATZ)
BILD 67: AII - VERÄNDERUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN UNTERNEHMENSKULTUR (EINSATZ)
BILD 68: AII - VERÄNDERUNGEN ORGANISATIONSSTRUKTUR UND RISIKEN (EINSATZ)
BILD 69: AII - ENDE
Tabellenverzeichnis
TABELLE 1: AUFFASSUNGEN VON UNTERNEHMENSKULTUR
TABELLE 2: AIII - BRANCHE
TABELLE 3: AIII - UNTERNEHMENSGRÖßE
TABELLE 4: AIII - STANDORTE
TABELLE 5: AIII - ORGANISATIONSSTRUKTUR
TABELLE 6: AIII - MITARBEITERPOSITION
TABELLE 7: AIII - ANZAHL IT-MITARBEITER
TABELLE 8: AIII - GRAD DER KOMMUNIKATION
TABELLE 9: AIII - GRAD DES WISSENSAUSTAUSCHS
TABELLE 10: AIII - WISSENSSPEICHERUNG
TABELLE 11: AIII - WISSENSVERTEILUNG
TABELLE 12: AIII - BEGRIFF BEKANNT?
TABELLE 13: AIII - BEGRIFFSVERSTÄNDNIS ENTERPRISE 2.0
TABELLE 14: AIII - EINSATZ VON ENTERPRISE 2.0?
TABELLE 15: AIII - EINSATZ IN PLANUNG?
TABELLE 16: AIII - ENTERPRISE 2.0-RISIKEN (KEIN EINSATZ)
TABELLE 17: AIII - ENTERPRISE 2.0-CHANCEN (KEIN EINSATZ)
TABELLE 18: AIII - VORSTELLBARE VERÄNDERUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (KEIN EINSATZ).
TABELLE 19: AIII - VORAUSSETZUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (KEIN EINSATZ)
TABELLE 20: AIII - VERÄNDERUNGEN DER ORGANISATIONSSTRUKTUR (KEIN EINSATZ)
TABELLE 21: AIII - ENTERPRISE 2.0-PLANUNG (PLANUNG)
TABELLE 22: AIII - ENTERPRISE 2.0-ZIELE (PLANUNG)
TABELLE 23: AIII - KONKRETE ANWENDUNGEN (PLANUNG)
TABELLE 24: AIII - EINSATZBEREICH (PLANUNG)
TABELLE 25: AIII - ART DES EINSATZES (PLANUNG)
TABELLE 26: AIII - RICHTLINIEN (PLANUNG)
TABELLE 27: AIII - EINSATZ PRIVAT (PLANUNG)
TABELLE 28: AIII - ERWARTETE VERÄNDERUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (PLANUNG)
TABELLE 29: AIII - VORAUSSETZUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (PLANUNG)
TABELLE 30: AIII - ERWARTETE VERÄNDERUNGEN DER ORGANISATIONSSTRUKTUR (PLANUNG)
TABELLE 31: AIII - ENTERPRISE 2.0-RISIKEN (PLANUNG)
TABELLE 32: AIII - SEIT WANN ENTERPRISE 2.0-EINSATZ? (EINSATZ)
TABELLE 33: AIII - ENTERPRISE 2.0-ZIELE (EINSATZ)
TABELLE 34: AIII - KONKRETE ANWENDUNGEN (EINSATZ)
TABELLE 35: AIII - EINSATZBEREICH (EINSATZ)
TABELLE 36: AIII - ART DES EINSATZES (EINSATZ)
TABELLE 37: AIII - RICHTLINIEN (EINSATZ)
TABELLE 38: AIII - EINSATZ PRIVAT UND GESCHÄFTLICH (EINSATZ)
TABELLE 39: AIII - ERWARTETE VERÄNDERUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (EINSATZ)
TABELLE 40: AIII - STATTGEFUNDENE VERÄNDERUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (EINSATZ)
TABELLE 41: AIII - VORAUSSETZUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (EINSATZ)
TABELLE 42: AIII - STATTGEFUNDENE VERÄNDERUNGEN DER ORGANISATIONSSTRUKTUR (EINSATZ) .
TABELLE 43: AIII - ERWARTETE VERÄNDERUNGEN DER ORGANISATIONSSTRUKTUR (EINSATZ)
TABELLE 44: AIII - ENTERPRISE 2.0-RISIKEN (EINSATZ)
TABELLE 45: AIII - VORAUSSETZUNGEN DER UNTERNEHMENSKULTUR (AGGREGIERT)
TABELLE 46: AIII - ENTERPRISE 2.0-RISIKEN (AGGREGIERT)
Abkürzungs- und Akronymverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Motivation sowie den Gegenstand und das Ziel dieser Arbeit vor. Ferner wird auf den verfolgten methodischen Ansatz und den weiteren Verlauf in dieser Arbeit eingegangen.
1.1 Motivation
Unternehmen sind in zunehmendem Maße der Dynamik ihrer Umwelt ausgesetzt. Einer Dynamik, die nicht zuletzt durch die Entwicklung im Bereich der Informationstechnologie (IT) immer mehr voran getrieben wird und die Unternehmen mittlerweile durchdrungen hat. Hinzu kommt die zunehmende Vernetzung der Welt, die den Wandel der Weltwirtschaft zudem beschleunigt (vgl. Buhse und Stamer 2008, S. 244). Damit sind Informationen und daraus gewonnenes Wissen in den letzten Dekaden für Unternehmen immer wichtiger geworden. Der Informationssektor kann inzwischen - neben dem primären, sekundären und tertiären Wirtschaftssektor - als vierter Wirtschaftssektor betrachtet werden (vgl. Lehner 2009, S. 5). „Zu ihm zählen vor allem die Produktion von „Information“ sowie Dienstleistungen im Umfeld von Informationstechnologie“ (Lehner 2009, S. 5). Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Bewältigung der Informationsflut. Laut KRCMAR (2005, S. 52) verdoppelt sich das gedruckte Wissen alle acht Jahre. Bei gleichzeitig zunehmender Verbreitung von Intranets, geht damit ein Zuwachs von unternehmensintern verfügbaren Informationen einher (ebd.). Diese Informationen und Wissensbestände müssen gehandhabt werden. Jedoch stellt sich zunehmend heraus, dass bisher genutzte Technologien bzw. Systeme dieser Aufgabe nicht mehr adäquat gerecht werden (vgl. Lehner 2009, S. 7). „Neue Wege und Alternativen sind gerade in den Bereichen Wissenssicherung und -generierung nötig, um auf eine sich ändernde Arbeitswelt reagieren und im Wettbewerb bestehen zu können.“ (Günther und Spath 2010, S.6). Dazu gehören unter anderem die Sicherstellung der Kommunikation im Unternehmen und die ständige Verfügbarkeit von Wissen. Während die Verfügbarkeit von Wissen vornehmlich unternehmensintern zu gewährleisten ist, spielt bei der Kommunikation zudem die externe Ausrichtung zu Kunden, Lieferanten oder Partnern eine große Rolle.
Technologien, die unter dem Begriff „ Web 2.0 “ oder spezieller unter „ Social Software “ zusammengefasst werden können, sollen zur Unterstützung dieser Aufgaben beitragen (vgl. Koch und Richter 2007, S. 1). Die Anwendungen, die unter dem durch O’REILLY
(2005) populär gewordenen Begriff Web 2.0 zusammen gefasst werden können, wurden anfangs nur im privaten Umfeld eingesetzt. Eine Studie der Berlecon Research Group (vgl. Berlecon 2007, S. 12) stellt fest, dass 2007 in einigen Unternehmen Social Soft- ware-Anwendungen zu finden sind, diese aber nur bei vereinzelten Mitarbeitern Verwendung finden. Der Erfolg, der von Wikipedia1 oder anderen Social SoftwareAnwendungen dieser Art ausgeht, lässt allerdings auf das Potenzial, das Social Software z. B. durch die Wissensgenerierung und Wissenssicherung für Unternehmen bietet, schließen (vgl. Spath und Günther 2010, S. 6). Obwohl seit 2007 die Anzahl der Unternehmen, die Social Software-Anwendungen einsetzen (vgl. z. B. Adelsberger et. al 2009, S. 25) gestiegen ist, ist der Einsatz von Social Software im Unternehmen, auch Enterprise 2.0-Anwendungen genannt, noch bei weitem nicht ausgereift und die möglichen Einsatzpotenziale nicht vollständig erschlossen.
Social Software-Anwendungen sind soziotechnische Systeme (vgl. Back und Heidecke 2009a, S. 4). Daher ist neben der technischen Sichtweise und der reinen Einführung von Enterprise 2.0-Anwendungen auch die menschliche Beteiligung und Nutzung dieser Anwendungen notwendig (vgl. Back und Heidecke 2009a, S. 5; Günther und Spath 2010, S. 6), um insbesondere für das Wissensmanagement Nutzen zu stiften. Durch das Zusammenwirken von Wissensmanagement und Unternehmenskultur (vgl. Mandl und Reimann-Rothmeier 2000, S. 160) ist für Enterprise 2.0-Anwendungen als soziotechnisches System auch die Unternehmenskultur von Bedeutung. HAMANN (2008, S. 8-9) stellt neben der Unternehmenskultur auch die Relevanz der Organisationsstruktur und den damit einhergehenden Wandel heraus. Daraus folgt, dass im Zuge des Einsatzes von Enterprise 2.0-Anwendungen neben der technischen Sichtweise besonders den möglichen Veränderungen der Unternehmenskultur und der Organisationsstruktur Beachtung zu schenken ist.
Gerade in diesem Punkt fehlt allerdings oft das Bewusstsein für den Änderungsbedarf hinsichtlich der Unternehmenskultur (vgl. Schein 2010, S. 19) und Organisationsstruktur im praktischen Einsatz in Unternehmen.
1.2 Gegenstand und Ziel der Arbeit
Der Gegenstand dieser Arbeit gliedert sich in zwei Hauptziele. Das erste Ziel ist die Herausarbeitung der Potenziale für Unternehmen, die sich aus dem Einsatz von Social
Software-Anwendungen ergeben können. Hierzu wird eine Sicht auf den Einsatz dieser Anwendungen eingenommen und zwischen dem internen und extern gerichteten Unternehmenseinsatz differenziert. Für beide Sichten werden alle, in Kapitel 2.1.2 erläuterten, Arten von Social Software-Anwendungen hinsichtlich des Nutzens für Unternehmen betrachtet. Dabei stehen insbesondere die potenziellen Einsatzmöglichkeiten für das Wissensmanagement im Vordergrund.
Das zweite Ziel dieser Arbeit ist die empirische Untersuchung des organisationalen Wandels, der mit dem Einsatz von Social Software-Anwendungen im Unternehmen einher geht. In der Literatur lassen sich z. B. bei BACK UND HEIDECKE (2009a, S. 4-5) Hinweise auf Veränderungen der Unternehmenskultur und damit verbunden mit der Organisationsstruktur identifizieren. Obwohl es zum Einsatz von Social SoftwareAnwendungen in Unternehmen bereits empirische Untersuchungen gibt, hat nach Kenntnis des Autors keine dieser Untersuchungen den organisationalen Wandel in Form von Veränderungen in der Unternehmenskultur und Organisationsstruktur explizit adressiert.
Aus diesem Grund lassen sich nachfolgende Forschungsfragen identifizieren, deren Beantwortung sich die vorliegende Arbeit zum Ziel gesetzt hat:
Welche Potenziale ergeben sich durch den Einsatz von Social Software für Unternehmen und welche Social Software-Anwendungen eignen sich besonders für das Wissensmanagement?
Ist der Einsatz von Social Software-Anwendungen in Unternehmen bereits verbreitet und welche Anwendungen werden eingesetzt?
Welche Voraussetzungen für Veränderungen in der Unternehmenskultur sind für den erfolgreichen Einsatz von Social Software notwendig und welche Veränderungen in der Organisationskultur haben bereits stattgefunden? Welche Anpassungen der Organisationsstruktur ergeben sich aus Veränderungen der Unternehmenskultur?
Um der Beantwortung dieser Fragestellungen gerecht zu werden, wird die empirische Untersuchung in Form einer Unternehmensumfrage als Online-Befragung durchgeführt. Ziel ist es, an Hand der sich daraus ergebenen Informationen den Status quo bezüglich der Verbreitung des Einsatzes von Social Software im Unternehmen zu ermitteln. Aufbauend auf der Nutzung dieser Anwendungen werden Aussagen über Veränderungen in der Organisationsstruktur und Unternehmenskultur getroffen. Abschließend wird erläutert, welche Herausforderungen sich durch den organisationalen Wandel durch Enterprise 2.0, insbesondere für das Wissensmanagement, ergeben.
1.3 Methodischer Ansatz
Die Forschungsmethodik der Wirtschaftsinformatik2 bietet einen behavioristischen („Behavioral Science“) und einen gestaltungsorientierten bzw. konstruktivistischen („Design Science“) Ansatz. (vgl. Frank 2007, S. 163-170). Dabei fokussiert letztgenannter Ansatz die Konstruktion und Bewertung von IT-Artefakten, hingegen der behavioristische Ansatz die empirische Wahrheitsfindung verfolgt (vgl. Becker und Pfeiffer 2006, S. 2). Mit der Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Analyse der Verbreitung von Enterprise 2.0-Anwendungen zum Einen und der Analyse der Unternehmenskultur und Organisationsstruktur zum Anderen, sowie der anschließenden Auswertung, sollen Aussagen über das Verhalten der Unternehmen bzw. der Organisationsmitglieder dieser Unternehmen, getroffen werden. Aus diesem Grund liegt der vorliegenden Arbeit der behavioristische Ansatz zugrunde.
1.4 Gang der Untersuchung
Das methodische Vorgehen der Arbeit gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 werden die Grundlagen zur Identifikation der Potenziale von Enterprise 2.0 und die Bewertung der Änderungen der Unternehmenskultur und Organisationsstruktur gelegt. Dafür werden in Kapitel 2.1 die Arten von Social Software-Anwendungen erklärt. Als Basis der Analyse der organisationalen Herausforderungen für das Wissensmanagement werden in Kapitel 2.2 Dimensionen und Formen von Organisationsstrukturen erläutert, bevor in Kapitel 2.3 auf die verschiedenen Ebenen von Unternehmenskulturen eingegangen wird. Um den Bezug der Potenziale von Enterprise 2.0-Anwendungen für das Wissensmanagement herzustellen, konzentriert sich Kapitel 2.4 als letztes Unterkapitel im Grundlagenteil auf die Erläuterung des Wissensmanagements. In Kapitel 3 werden ausgehend von der Unterteilung in interne und externe Unternehmenssicht für alle die in Kapitel 2.1 erläuterten Social Software-Anwendungendie Potenziale bei dem Einsatz in Unternehmen, insbesondere für das Wissensmanagement, herausgearbeitet. Kapitel 4 beschreibt die Online-Befragung und fokussiert dabei neben der Motivation das methodische Vorgehen hinsichtlich der Zielgruppenauswahl, des Fragebogendesigns und der für die Auswertung verwendeten statistischen Verfahren. An Hand der Aufgliederung in die Fragebogenpfade, ob der Einsatz von Enterprise 2.0Anwendung stattfindet, geplant wird oder nicht angestrebt wird, erfolgt in Kapitel 5 die Präsentation der Ergebnisse der empirischen Untersuchung, sowie sich daraus ergebende Erkenntnisse hinsichtlich organisationaler Herausforderungen für das Wissensmanagement. Kapitel 6 beinhaltet mögliche Limitationen für die Ergebnisse der empirischen Untersuchung bevor die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick in Kapitel 7 schließt.
2. Grundlagen
In diesem Kapitel werden die Grundlagen zu den Themenblöcken Web 2.0, Organisationsstrukturen, Unternehmenskultur und dem Wissensmanagement dargelegt. Damit wird ein einheitliches Begriffsverständnis etabliert, welches die Voraussetzung für die Beantwortung der Forschungsfragen darstellt.
2.1 Web 2.0 und Social Software
In diesem Kapitel werden, die in der Literatur am häufigsten genannten, Social Software-Anwendungen vorgestellt. Dabei wird mit der Begriffserklärung begonnen. Wie bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben, konzentriert sich diese Ausarbeitung auf die Einflüsse auf die Unternehmenskultur und somit auf die sozialen Aspekte des Web 2.0. Aus diesem Grund nimmt die technische Sichtweise auf diese Anwendungen einen untergeordneten Stellenwert ein.
2.1.1 Definition und Begriffserklärung
Der Begriff Web 2.0 wurde 2004 im Rahmen eines Brainstormings zur Vorbereitung der gleichnamigen Konferenz, die Veränderungen im Internet adressierte (vgl. Back und Heidecke 2009a, S.3), benutzt. Popularität erlangte der Begriff erst im Jahr 2005 durch den Artikel „What is Web 2.0?“ von TIM O’REILLY (2005). Trotzdem lässt sich in der Wissenschaft bis heute keine gemeinschaftlich akzeptierte Definition zum Begriff Web 2.0 finden (vgl. Alby 2008). Es lassen sich lediglich Eigenschaften bzw. Prinzipien identifizieren, welche Web 2.0 kennzeichnen. In diesem Kontext nennt O’REILLY (2005) selbst nachstehende Prinzipien, die bis heute noch als wichtig für die Beschreibung von Web 2.0 angesehen werden (vgl. Koch und Richter 2007, S. 3; Back und Heidecke 2009a, S. 3 nach O’Reilly 2005):
Das Web als Plattform Nutzung der kollektiven Intelligenz Datengetriebene Anwendung Permanenter Beta-Status - Ende des klassischen Softwarelebenszyklus Beliebige Kombinierbarkeit von Komponenten oder ganzen Anwendungen Plattform- und Geräteunabhängigkeit Umfassende Anwenderfreundlichkeit und Einfachheit Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Versionierung „2.0“ nicht zwingend für grundlegend technische Neuerungen steht. Auch wenn neue Technologien wie Ajax und RSS für das Web 2.0 stehen, besteht die wichtigste Entwicklung die das Web 2.0 kennzeichnet in der Mitwirkung der Internetnutzer (im weiteren Verlauf „User“ genannt) und somit in der Art und Weise, wie das Web jetzt genutzt wird (vgl. Bohl et. al. 2007, S. 27). Prinzipien wie Umfassende Anwenderfreundlichkeit und Einfachheit ermöglichen es den Usern ohne Programmierkenntnisse das Internet aktiv zu gestalten, Inhalte zu erstellen (user-generated content), sich mitzuteilen und letztlich mit anderen Usern zu verknüpfen und zu kommunizieren.(vgl. Bächle und Daurer 2006, S. 75; Hippner 2006, S. 16; ) „Jeder ist Macher und Nutzer gleichermaßen und kann mitmachen im neuen Web“ (Beck 2007, S. 5). Web 2.0 bezeichnet nicht nur neue Anwendungen, sondern ist vielmehr eine „Orientierung hin zu den Bedürfnissen der einzelnen Benutzer und einer sozialen Bewegung (breite Mitwirkung und Selbstdarstellung der Endbenutzer), die dazu führt, dass die Grenze zwischen Autor und Leser […] verschwimmt, Benutzer also mehr und mehr zu gemeinsamen Informationsräumen beitragen.“ (Koch und Richter 2007, S. 4).
Für den Begriff Social Software existiert derzeit ebenso wenig eine allseits akzeptierte Definition, wie für Web 2.0 (vgl. Alby 2008, S. 89). Ein Grund dafür ist die Uneinigkeit über den Zusammenhang zwischen Social Software und Web 2.0. Dazu merkt HIPPNER (2006, S. 6) an, dass vereinzelt Social Software mit Web 2.0 gleichgesetzt, in den meisten Fällen aber als Teilmenge von Web 2.0 angesehen wird. Wird zum Beispiel die Definition von BÄCHLE UND KOLB (2010, S. 31) oder BACK UND HEIDECKE (2009a, S. 4) angeführt, so fällt auf, dass der soziale Aspekt, welchen O’REILLY (2005) bereits als Prinzip Nutzung der kollektiven Intelligenz von Web 2.0 angeführt hat, das Hauptmerkmal von Social Software darstellt. Demnach werden unter Social Software soziotechnische (Software-)Systeme verstanden, die zur Unterstützung der menschlichen Kommunikation, Kooperation, Interaktion und Zusammenarbeit dienen. Hierbei stellt der Aufbau und die Pflege von sozialen Netzwerken in virtuellen Gemeinschaften, in denen sich die Teilnehmer selbstorganisierend austauschen, das Hauptmerkmal von Social Software dar (vgl. Bächle und Kolb 2010, S. 31 nach Bächle 2005 und Bächle 2006; Back und Heidecke 2009a, S. 4).
Im Gegensatz zu Web 2.0 stellt Social Software keine Technologien bereit. Social Software-Anwendungen nutzen die durch das Web 2.0 angebotenen Technologien wie bspw. Ajax oder RSS. Social Software ist daher als Teilmenge von Web 2.0 anzusehen (vgl. Szugat et. al. 2006, S. 14). Diese Betrachtungsweise dient als Basis für den weiteren Verlauf dieser Arbeit.
2.1.2 Arten von Social Software-Anwendungen
In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Arten von Social SoftwareAnwendungen beschrieben. Anhand dieser Unterscheidung wird in Kapitel 3 die Identifikation der Potenziale von Enterprise 2.0 vorgenommen. Aus diesem Grund stellt die Erläuterung der verschiedenen Arten von Social Software-Anwendungen eine Voraussetzung für die spätere Beantwortung der ersten Forschungsfrage dar.
2.1.2.1 Wiki
Ein Wiki ist technisch nicht neu. Die Entwicklung geht 1995 auf CUNNINGHAM zurück. (vgl. Leuf und Cunningham 2001). Die Herkunft des Wortes „leitet sich aus dem Hawaiianischen ab und bedeutet soviel wie schnell oder rasch.“ (Erpenbeck und Sauter 2007, S. 142). Durch den Namen soll das Ziel verdeutlicht werden, schnell und unkompliziert Inhalte in einem Wiki erstellen zu können (vgl. Ebersbach et al. 2008, S. 37). Unter einem Wiki wird eine Sammlung von Webseiten verstanden, die auf dem Hypertext-Prinzip basieren. Mit Hypertext-Prinzip ist gemeint, dass zwischen einzelnen Seiten und Artikel3 eines Wikis Querverweise (Hyperlinks) existieren (vgl. Bächle und Kolb 2010, S. 31), wodurch eine Netzstruktur zwischen den Seiten bzw. Artikeln entsteht. Orientiert an der übergeordneten Definition von Social Software dient ein Wiki zur kollaborativen Erstellung von Texten (Artikeln), Tabellen oder anderen digitalen Medien zur (schriftlichen) Fixierung und Publikation von Informationen und Wissen. Daher stellen Wikis Webseiten zur kollaborativen Erstellung von Informationen. Dieser Erstellungsprozess muss nicht nach einem bestimmten Muster ablaufen. Ein Wiki zeichnet sich dadurch aus, dass alle User nach Belieben Veränderungen an den in ein Wiki eingestellten Inhalten durchführen oder aber neue Inhalte bzw. Seiten oder Artikel erstellen können (vgl. Müller und Gronau 2009, S. 11). Änderungen werden, ohne die notwendige Existenz lokal auf dem Computer installierter Software (vgl. Komus und Wauch 2008, S. 6), durch einen Bearbeitungsmodus realisiert, durch den die User keine Pro- grammiersprachen beherrschen und HTML-Kenntnisse besitzen müssen (vgl. Kollmann 2009, S. 559).
Trotz der Historie-Funktion, welche die versionierte Nachverfolgung der getätigten Änderungen an einem Artikel ermöglicht, ist die Möglichkeit, dass jeder User beliebige Anpassungen vornehmen kann, kritisch zu betrachten. Es kann neben Vandalismus auch zu dem Problem kommen, dass bestimmte User die Möglichkeit zur Änderung von Artikeln zu ihrer Selbstdarstellung missbrauchen (vgl. Ebersbach et. al 2008, S. 34f.). Andererseits ist die Einfachheit der Nutzung eines Wikis als Vorteil zu werten. Somit können sich durch den Einsatz von Wikis auch Potenziale für den Unternehmenseinsatz ergeben. Diese werden in Kapitel 3.2.1 und 3.3.1 herausgestellt.
2.1.2.2 Weblog
Der Begriff Weblog leitet sich aus den Wörtern „web“, für Netz, und „log“, für Tagebuch, ab (vgl. Mikloweit 2007, S. 57). Abgekürzt Blog genannt, wird unter einem Weblog eine Webseite verstanden, die tagebuchartig in der Regel von einem Autor, dem sogenannten Blogger, mit Beiträgen aktualisiert wird. Angeblich wurde der Begriff bereits 1997 (auf der Webseite) von Jorn BARGER4 genutzt, jedoch wurde der Begriff erst ab 1999 durch die Verbreitung von Weblog-Publishing-Systemen wie blogger.com5 populär (vgl. Robes 2009, S. 20).
Weblogs zeichnen sich dadurch aus, dass die vom Blogger eingestellten Beiträge in chronologisch umgekehrter Reihenfolge auf der Webseite erscheinen. Der aktuellste Beitrag steht demzufolge ganz oben. Leser haben dann die Möglichkeiten zu jedem der eingestellten Beiträge Kommentare zu verfassen (vgl. Manouchehri Far, 2010, S. 30). Diese erscheinen in chronologisch korrekter Reihenfolge so dass der letzte Kommentar unten angefügt wird. Jedem Blog-Beitrag wird eine feste URL, ein sogenannter PermaLink, zugewiesen. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, Blogeinträge (in anderen Weblogs) zu referenzieren (vgl. Alpar et. al. 2007, S. 13). Das Referenzieren von Beiträgen in anderen Weblogs wird auch als Trackback bezeichnet. „Mittels Trackbacks lässt sich somit automatisch ein Netzwerk von Beiträgen und Kommentaren aufbauen.“ (Bächle und Kolb 2010, S. 32). Die Gesamtheit aller Weblogs wird Blogosphäre genannt (vgl. Bächle und Kolb 2010, S. 32; Schönefeld 2009, S. 60; Schmidt 2006, S. 3).
Die Nutzung von Weblogs ist vielfältig. Inzwischen lassen sich nicht mehr nur persönliche Weblogs finden, in denen einzelne Blogger - zumeist durch subjektive Sichtweise ihrer Leserschaft mitteilen, welche privaten und beruflichen Ereignisse den Blogger gerade beschäftigen (vgl. Koch und Richter 2007, S. 24). Ähnlich wie bei Wikis existieren in der Praxis auch themenspezifische Weblogs, in denen durch die Kommentarfunktion Diskussionen zu beliebigen Themen entstehen können. MANOUCHEHRI FAR (2010, S. 29-30) nimmt eine Einteilung in private Weblogs, Nachrichten-Blogs, PR-Blogs und Corporate Blogs vor. Bezogen auf die eingangs in Kapitel 1.2 genannten Forschungsfragen lässt diese Einteilung erkennen, dass Weblogs wohl in jedem Themenbereich eingesetzt werden können. Die diesbezügliche Anwendung im Unternehmenskontext ist Gegenstand von Kapitel 3.2.2 und 3.3.2.
Trotz der vermeintlichen Vorteile darf auch bei Weblogs eine kritische Auseinandersetzung nicht fehlen. Die subjektive Schreibweise eines Bloggers kann zur Meinungsbildung benutzt werden (vgl. Smolnik und Riempp 2007, S. 20). Zudem kann jeder User einen Kommentar schreiben, wodurch die Gefahr besteht, dass die Kommentarfunktion für eigene Werbung oder Spam missbraucht wird. Desweiteren schreiben einer Umfrage zur Folge 2006 noch 55% der User nicht mit dem realen Namen, sondern benutzen ein Pseudonym (vgl. Robes 2009, S.21 nach Lenhart und Fox 2006). Obwohl die genannten 55% bereits einige Jahre zurückliegen, bleibt die kritische Haltung gegenüber der Möglichkeit durch Nutzung eines Pseudonyms die Kommentarfunktion zu missbrauchen, bestehen.
2.1.2.3 Social Network
Unter einem Social Network wird eine Plattform im Internet verstanden, welche zum Aufbau und zur Pflege von Kontakten und sozialen Beziehungen dient (vgl. Manouchehri Far 2010, S. 39; Koch und Richter 2007, S. 53). Bei anderen Autoren lassen sich hierfür synonyme Begriffe wie Social-Networking-Dienste, Social Networking Services oder Social-Network-Systeme finden (vgl. Schönefeld 2008; Alpar et al. 2007). Zur Abstraktion von rein technischen Systemen oder Services, wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für diese Ausarbeitung der Begriff Social Network verwendet wird. RICHTER und KOCH (2008, S. 1242-1248) bieten dazu eine Kategorisierung der Grundfunktionen von Social Networks an: Demnach weisen Social Networks Funktionen (i) zum Identitätsmanagement, (ii) zur Expertensuche, (iii) zur Kontextawareness (Kontext/Vertrauensaufbau/Visualisierung), (iv) zum Kontaktmanagement, (v) zur Netzwer- kawareness und (vi) zum gemeinsamen Austausch (Kommunikation) auf. Identitätsmanagement meint die Erstellung eines Benutzerprofils, das jeder User in einem Social Network haben muss und mit persönlichen Angaben vom User ausgefüllt werden sollte. Unter Expertensuche wird die Möglichkeit verstanden, nach anderen Usern zu suchen um diese dann zu kontaktieren oder zur eigenen Kontaktliste hinzuzufügen. Allgemein sei erwähnt, dass in der Literatur zwischen privaten und beruflichen Social Networks unterschieden wird (vgl. Schönefeld 2008, S. 69). Wird dieses Kriterium angeführt, so scheint die Bezeichnung ‚Expertensuche‘ in privaten Social Networks eher unpassend, da in der Regel keine Experten sondern Freunde und Bekannte gesucht werden. Letztlich muss aber auch in privaten Social Networks eine Suche nach Kontakten ermöglicht werden, was hiermit zum Ausdruck gebracht wird. Die Kontextawareness-Funktion hat das Ziel den Vertrauensaufbau der User zu fördern. Dafür wird wie in Bild 1 zu sehen, eine Visualisierung der Kontakte und deren Beziehungen angeboten um dem User ein Bild seiner Umgebung im Social Network zu verschaffen. „Unter Netzwerkawareness wird hier das Gewahrsein über die Aktivitäten (bzw. den aktuellen Status und Änderungen des Status) der Kontakte im persönlichen Netzwerk verstanden“ (Richter und Koch 2008, S. 1246).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1: Netzwerk-Visualisierung bei XING.com (Quelle: Xing 2009)
Zum Kontaktmanagement gehören alle Funktionen die mit der Pflege des Beziehungsnetzwerkes verbunden sind. Dazu zählt z. B. die Möglichkeit, Kontakte in Listen zu verwalten (vgl. Richter und Koch 2008, S. 1247). Mit der Unterstützung eines gemeinsamen Austauschs werden Funktionen zur Interaktion zwischen den Usern subsummiert. Das kann der Austausch durch persönliche Nachrichten oder in Gruppen bzw. Foren sein. Auch wenn bei anderen Autoren keine explizite Einteilung der Funktionen vorgenommen wird, lassen sich ähnliche der oben genannten Funktionen identifizieren (vgl. Hippner 2006, S. 13). Desweiteren können Social Networks offenen oder geschlossenen sein (vgl. Koch und Richter 2009a, S. 73). Wie soeben herausgestellt wur- de, dienen Social Networks zur Kontaktaufnahme und Kommunikation. Um dies zu gewährleisten müssen Kritikpunkte überwunden werden, welche bereits bei den Weblogs angeführt wurden. In diesem Zusammenhang kann kritisch betrachtet werden, dass User sich nicht mit dem realen Namen registrieren, falls diese dem Social Network nicht vertrauen. Dieser Aspekt wird auch im Internet diskutiert6.
2.1.2.4 Social Bookmark
Social Bookmarks sind persönliche Linksammlungen. Diese sind öffentlich und zeichnen sich dadurch aus, dass diese von Usern mit Schlagworten (Tags) versehen werden (vgl. Hippner 2006, S. 12). Im Vergleich zu lokalen Bookmarks (Lesezeichen), bei denen nur der User lokal in dem Browser, in welchem ein Bookmark erstellt wurde, diesen auch wieder aufrufen kann, wird bei Social Bookmarks „eine zentrale und von allen Teilnehmern sichtbare Ablage von Lesezeichen, d. h. Links in das Web oder Intranet“ (Schönefeld 2008, S. 72) realisiert. Dabei kann der User nicht nur auf die eigenen Bookmarks, sondern auch auf Bookmarks anderer User zugreifen. User mit ähnlichen Bookmark-Portfolios können eine Ergänzung für eigene Bookmarks darstellen und stehen daher besonders im Interesse (vgl. Gust von Loh 2009, S. 230). Existieren bei anderen Usern identische Bookmarks kommt es auf diese Weise zu Mehrfachnennungen, wodurch auch die Relevanz eines Bookmarks für eine Anzahl von Usern deutlich gemacht wird (vgl. Schönefeld 2008, S. 72). Wie bereits oben in der Definition von HIPPNER (2006, S. 12) erwähnt, besteht ebenfalls die Möglichkeit, Bookmarks mit Tags zu versehen. Hierdurch können einem Bookmark zusätzliche Kontextinformationen hinzugefügt werden um die Bookmark-Suche zu einem späteren Zeitpunkt zu erleichtern (vgl. Koch und Richter 2007, S. 46; Schönefeld 2008, S. 72). Ebenso hier kann die Gefahr des Vandalismus kritisch gesehen werden. Es besteht die Möglichkeit thematisch falsche Tags zu vergeben. Da ein Bookmark dann mit der Schlagwort-Suche nicht mehr auffindbar ist, wird dieser dadurch nutzlos. Dies kann auch unabsichtlich auf Grund ungeschulter User passieren, die unbewusst mehrdeutige oder ungenaue Schlagworte vergeben (vgl. Hotho 2009, S. 28; Koch und Richter 2009, S. 50).
Neben der privaten Nutzung bieten Social Bookmarks auch Potenziale für den Einsatz in Unternehmen. Wie diese Potenziale aussehen, ist das Thema in Kapitel 3.2.4 und Kapitel 3.3.4.
2.1.2.5 Social Tag
Eine weitere Social Software-Anwendung ergibt sich durch die Verwendung sogenannter Social Tags. Social Tagging als Aktivität, auch Collaborative Tagging genannt (vgl. Koch und Richter 2007, S. 46), beschreibt den Prozess bei dem viele User Metadaten in Form von Schlagworten einem geteilten Inhalt hinzufügen (vgl. Golder und Huberman 2006, S. 198). Dabei können Tags für beliebige Objekte wie z. B. Hyperlinks, Bilder, Videos oder Texte vergeben werden (vgl. Koch und Richter 2007, S. 46; Schönefeld 2008, S. 75). Die so entstehende gemeinschaftlich indexierte Sammlung von Tags wird als Folksonomies bezeichnet (vgl. Bächle und Kolb 2010, S. 32; Smolnik und Riempp 2006, S. 21). Folksonomies setzt sich aus „folk“ für Leute und „taxonomy“ für Taxonomie zusammen (vgl. Alby 2008, S. 127). Zur Schaffung einer Übersicht über häufig verwendete Tags hat sich die Darstellung einer Tag-Cloud etabliert. Wie in Bild 2 veranschaulicht, werden „die am häufigsten verwendeten Tags typographisch am größten dargestellt“ (Schönefeld 2008, S. 74f).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 2: Tag-Cloud zum Thema Entdecken auf flickr.com7 (Quelle: Flickr 2012)
Bei der in Bild 2 gezeigten Tag-Cloud handelt es sich um eine Tag-Sammlung als Referenz auf Fotos auf der Foto-Plattform Flickr.com.
Desweiteren ist zu erwähnen, dass Social Bookmarks durch die Möglichkeit Tags vergeben zu können, in unmittelbarem Zusammenhang zu Social Tagging steht. Aus diesem Grund fokussiert die kritische Auseinandersetzung mit Social Tagging ebenfalls die fehlerhafte Vergabe sogenannter Tags. Trotzdem ergeben sich auch hier Potenziale für den Unternehmenseinsatz, welche in Kapitel 3.2.5 und 3.3.5 diskutiert werden.
2.1.2.6 Instant Message
Instant Message bzw. „ Instant Messaging ist ein serverbasierter Dienst, der es ermöglicht, in Echtzeit über eine Clientsoftware mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren. Diese bekommen Textmitteilungen im Push-Verfahren über ein Netzwerk zugestellt und können unmittelbar darauf antworten“ (Kuhlenkamp et. al. 2007, S. 28). Neben der Möglichkeit direkt zu antworten, auch synchrone Kommunikation genannt, besteht bei den meisten Instant Messaging-Diensten auch die Möglichkeit sogenannte OfflineNachrichten zu verschicken, welche auch als asynchrone Kommunikation bezeichnet wird (vgl. Bächle und Daurer 2006, S. 75). Hierbei kann der Sender Textmitteilungen an Teilnehmer absetzen, die aktuell nicht in der Clientsoftware eingeloggt sind. Sobald der Teilnehmer sich einloggt, erhält er dann die ihm in seiner Abwesenheit zugesandten Nachrichten.
Instant Messaging-Dienste zeichnen sich dadurch aus, dass jeder Teilnehmer durch einen eindeutigen Namen oder eine Nummer identifiziert werden und dieser seine Kontakte in einer Kontaktliste verwalten kann (vgl. Bächle und Lehmann 2010, S. 169). Ferner ist es jedem Teilnehmer möglich, seinen aktuellen Onlinestatus festzulegen. Die meisten Instant Messaging Programme bieten die Auswahl zwischen „bereit“, „abwesend“, „nicht verfügbar“, „nicht stören“ oder „nicht verbunden“ (vgl. Bächle 2006; Hippner 2006, S. 14). Diese Option hat den Vorteil, dass für andere Teilnehmer bereits vor der Kontaktaufnahme ersichtlich ist, ob der gewünschte Kommunikationspartner erreichbar ist oder nicht. Allerdings gibt es neben Instant Messaging inzwischen auch neuere Formen der direkten Kommunikation, welche nicht nur Textnachrichten sondern auch Audio- und Videoübertragungen ermöglichen. MANOUCHEHRI FAR (2010, S. 50) spricht hierbei von Voice-over-IP8 -Systemen. Diese VoIP-Systeme realisieren in der Regel nicht nur Audio- und Videoübertragungen, sondern ferner die textuelle Kommunikation wie diese bei reinen Instant Messaging-Diensten zu finden ist. Beide Arten der direkten Kommunikation, also Instant Messaging und Voice-over-IP, werden als Instant Communication zusammen gefasst (vgl. Koch und Richter 2009b, S. 67; Bächle und Lehmann 2010, S. 168).
Wird bei einer Betrachtung von offenen Instant Messaging Diensten wie ICQ9 oder AIM10 ausgegangen11, kann der Datenschutz als kritisch gesehen werden. Hintergrund
ist der, dass oft nicht klar ist wo oder wie die versandten Nachrichten gespeichert werden und der Betreiber diese zu seinem Nutzen weiterverwendet (vgl. Höhne 2010, S. 8). Der Nutzen, der sich durch Instant Messaging-Anwendungen ergibt, beschränkt sich nicht nur auf den privaten Gebrauch. Aus diesem Grund beschäftigen sich die Kapitel 3.2.6 und 3.3.6 mit den Potenzialen für den Einsatz in Unternehmen.
2.1.2.7 Microblog
Ein Microblog ist eine Abspaltung des Weblogs und wird auch als Mini-Weblog bezeichnet (vgl. Koch und Richter 2009, S. 35). Zudem besteht eine Ähnlichkeit zur SMS aus der Mobiltelefonie (vgl. Schönefeld 2009, S. 79). Ein Microblog ermöglicht es, SMS-artige Kurznachrichten im Internet zu veröffentlichen. Die Ähnlichkeit zum Weblog liegt in der Reihenfolge, in welcher die Nachrichten angezeigt werden. Genau wie beim Weblog, steht auch beim Microblog die neueste Nachricht immer oben. Entsprechend ihrer Chronologie werden angehängte Kommentare unten angefügt. Ferner besteht auch hier die Möglichkeit die Nachrichten eines Autors zu abonnieren. User, die abonnierte Textnachrichten bekommen und dem Autor damit folgen, werden „Follower“ genannt (vgl. Koch und Richter 2009, S. 35). Allerdings kann der Autor einstellen, ob die von ihm verfassten Kurznachrichten nur für die beim gleichen MicrobloggingAnbieter registrierten oder auch anonymen User sichtbar sein sollen. Der bekannteste Microblogging-Anbieter ist Twitter12.
Da inzwischen auch Social Networks die Veröffentlichung von kurzen (Status)Nachrichten ermöglichen, kann über die Notwendigkeit einer eigenständigen Microblogging-Anwendung gestritten werden. Der Vorteil besteht jedoch darin, auch Mitteilungen absetzen zu können, ohne in einem Social Network registriert zu sein. Desweiteren kann auch hier die Frage nach dem Datenschutz und dem Verbleib bzw. der Speicherung der abgesetzten Nachrichten gestellt werden (vgl. Kapitel 2.1.2.6). Obwohl Microblogs im unternehmerischen Kontext vor kurzem noch kaum zur Anwendung kamen (vgl. Koch und Richter 2009, S. 37), lassen sich Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen identifizieren. Diese werden in Kapitel 3.2.7 und 3.3.7 diskutiert.
2.1.2.8 Podcast und Vodcast
„Unter Podcasting versteht man das Produzieren und Anbieten von Mediendateien (meist als Audiodatei im MP3-Format) über das Internet.“ (Hippner 2006, S. 11; Koch und Richter 2007, S. 34). Der Podcast als solches, stellt laut ALBY (2008, S. 73) daher das Produkt - eine Audiodatei - des Podcasting dar. Der Begriff setzt sich aus dem MP3-Player „iPod“ und „Broadcasting“, dem englischen Begriff für „Sendung“ bzw. „Übertragung“ zusammen. (vgl. Alby 2008, S. 73). Auch wenn KOCH UND RICHTER (2007, S. 36) sowie HÄNTSCHEL-ERHART (2009, S. 51) postulieren, dass Podcasts aus mehreren Sendung oder Episoden bestehen, welche auch per RSS abonniert werden können, ist fest zu halten, dass dies nicht zwingend der Fall sein muss. Laut ALBY (2008, S. 73) werden auch Audiodateien als Podcast bezeichnet, welche weder aus mehreren Episoden bestehen noch abonnierbar sind. Außerdem kann ein Podcast nicht nur beliebig lang sein, sondern sich inhaltlich auch mit jedem Thema befassen. Dazu können private Tagebücher oder Nachrichten genauso zählen wie Hörspiele oder gar wissenschaftliche Fachvorträge (vgl. Hippner 2006, S. 11-12).
Neben Podcasts haben sich sogenannte Vodcasts, auch als Videocast bezeichnet, etabliert. Diese stellen eine Erweiterung des Podcasts dar, indem die Tonspur des Podcasts um eine Videospur ergänzt wird. Auf diese Weise können Videobotschaften publiziert werden. Podcasts und Vodcasts lassen sich nicht nur im privaten Umfeld einsetzen. Die Potenziale hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen, werden in Kapitel 3.2.8 und Kapitel 3.3.8 erläutert.
2.1.3 Zusammenfassende Bemerkungen
Wie in Kapitel 2.1.2.1 bis 2.1.2.8 durch die Beschreibung der Social SoftwareAnwendungen deutlich wurde, zielen nicht alle diese Anwendungen auf den gleichen Nutzen ab. Zwar haben all diese Social Software-Anwendungen die Vernetzung der User zum Ziel, jedoch schlägt z. B. HIPPNER (2006, S. 8) eine Einteilung vor. Demnach lassen sich die drei Zieldimensionen (i) Verteilung von Informationen, (ii) Kommunikation zwischen Usern und (iii) Aufbau und Verwaltung von Beziehungen unterscheiden (vgl. Hippner 2006, S. 8). Auch GÜNTHER UND SPATH (2010, S. 18) legen identische Zieldimensionen zugrunde. Die entsprechende grafische Darstellung ist in Bild 3 erkennbar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 3: Klassifikationsschema von Social Software
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hippner 2006, S. 8)
Demnach lassen sich Microblogs, Podcasts/Vodcasts, Social Bookmarks und Social Tags der Informations- bzw. Kollaborationsdimension zuordnen. Instant Messaging dient der Kommunikation, während Social Networks der Beziehungsdimension zuzuordnen sind. Wikis und Weblogs haben sowohl Informations- als auch Kommunikationscharakter, weshalb eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist. Streng genommen trifft dies ebenso auf andere Anwendungen zu, da hier auch durch die Kommentarfunktion oder durch persönliche Nachrichten (Social Network) Kommunikation entsteht. Wenngleich über die exakte Position der Anwendungen in dieser grafischen Darstellung gestritten werden kann, ist die generelle Einordnung in diese Klassifikation bereits zielführend. In Kombination mit der Unterscheidung zwischen interner und externer Sichtweise in Kapitel 3, erleichtert das Klassifikationsschema von Social Software (vgl. Bild 3) die Übersicht der potenziellen Einsatzmöglichkeiten der Anwendungen.
2.2 Organisationsstruktur
Im folgenden Kapitel wird das grundlegende Verständnis zum Thema Organisations- struktur gelegt, welches die Basis zur Beantwortung der letzten Forschungsfrage in Ka- pitel 5 bildet. Dazu wird mit einer Einordnung und Begriffsdefinition begonnen. Anschließend werden die Dimensionen von Organisationsstrukturen thematisiert. Das Kapitel schließt mit der Betrachtung der Formen von Organisationsstrukturen ab.
2.2.1 Definition und Begriffserklärung
Bevor eine Definition des Begriffs Organisationsstruktur vorgenommen wird, müsste, um einen begrifflichen Rahmen zu schaffen, erst mit einer Einleitung zum allgemeinen Organisationsbegriff begonnen werden. Ausgehend vom Adressatenkreis dieser Ausarbeitung wird jedoch auf eine Beschreibung der Differenzierung von funktionalem, institutionellem und instrumentellem Organisationsbegriff verzichtet. Hingegen sei an dieser Stelle der Zusammenhang zu den Organisationstheorien erwähnt. Organisationsstrukturen werden durch Organisationstheorien beschrieben. Da aber eine Erläuterung der Organisationstheorien im Rahmen dieser Arbeit nicht zielführend ist, wird davon abstrahiert13. Beim Leser soll an dieser Stelle lediglich das Bewusstsein über die Existenz eines Zusammenhangs zwischen Organisationstheorien und Organisationsstrukturen, gebildet werden.
Mit Bezugnahme auf die eingangs erarbeiteten Forschungsfragen fokussiert dieses Kapitel folglich die grundlegenden Fragen, was unter einer Organisationsstruktur verstanden wird und welche Ausprägungen existieren.
In der Literatur wird häufig von formaler Organisationsstruktur gesprochen (vgl. Bamberger und Wrona 2004, S. 281; Kieser und Kubicek 1992, S. 67; Kieser und Walgenbach 2010, S.14), was zu der Annahme führt, dass auch eine informale Organisationsstruktur existiert. Wird die Definition zur formalen Organisationsstruktur von KIESER UND KUBICEK (1992, S. 18) angeführt, lässt sich eine entsprechende Differenzierung erahnen. Diese definieren formale Organisationsstrukturen als „Gesamtheit aller formalen Regelungen zur Arbeitsteilung und zur Koordination“ (Kieser und Kubicek 1992, S. 18). Formale Regelungen haben laut BAMBERGER UND WRONA (2004, S. 279) eine handlungssteuernde Wirkung. Sie dienen dazu Verhaltensvorschriften zu entwickeln und zu legitimieren. Informale Regelungen entstehen indes nicht autorisiert und offiziell, sondern entstehen emergent. So können z. B. divergierend zu den formalen Regelungen veränderte Kommunikationswege oder Machtbeziehungen entstehen (vgl. Bamberger und Wrona 2004, S. 279). Der Aspekt der informalen Regelungen lässt allerdings nicht auf die Existenz einer informalen Organisationsstruktur schließen, da sich in diesem Fall komplette Organisationsstrukturen emergent entwickeln müssten. Dieses Faktum ist nicht gegeben sobald eine Planung der Organisationsstruktur existiert. Informale Regelungen hängen indes unmittelbar mit der Unternehmenskultur zusammen. Die genauere Betrachtung dieses Zusammenhangs erfolgt in Kapitel 2.3.3, in welchem auf die Unternehmenskultur eingegangen wird.
Durch die formalen Regelungen und Strukturen wird das äußere Stellengefüge gebildet. Stellen werden Aufgaben und Kompetenzen zugeteilt, wodurch eine Struktur entsteht (vgl. Kieser und Walgenbach 2010, S. 18). Die Basis bilden zwei idealtypischen Grundformen: Einliniensystem und Mehrliniensystem (vgl. Schulte-Zurhausen 1999, S. 229). Die Matrixorganisation leitet sich aus den idealtypischen Grundformen ab und gehört zu den drei Formen, welche nachfolgend in Kapitel 2.2.3 weiter erklärt werden. Eine Organisationsstruktur besteht nicht ausschließlich aus der durch die Stellenbildung entstandenen Struktur. Bereits in Kapitel 2.1 ist der Kollaborationsgedanke von Social Software-Anwendungen dargestellt. Um im weiteren Verlauf Aussagen dieser Anwendungen bezogen auf die unterschiedlichen Organisationsstrukturen durchführen zu können, müssen neben den Formen von Organisationsstrukturen, welche auch unter dem Begriff der Konfiguration zusammengefasst werden, weitere beschreibende Merkmale von Organisationsstrukturen wie z. B. die Aufgabenkoordination oder die Entscheidungsdelegation betrachtet werden. Auch in der Literatur wird der Merkmalsauswahl zur adäquaten Beschreibung von Organisationsstrukturen eine hohe Bedeutung beigemessen (vgl. Kieser und Kubicek 1992, S. 67). Aus diesem Grund beschäftigt sich das nachfolgende Kapitel 2.2.2 mit den Dimensionen von Organisationstrukturen.
2.2.2 Dimensionen von Organisationsstrukturen
Im Mittelpunkt der Beschreibung von Organisationsstrukturen stehen die Dimensionen. Daher besteht das Ziel dieses Kapitels in der Auswahl und Beschreibung der für die vorliegende Arbeit am besten geeigneten Dimensionen von Organisationsstrukturen.
2.2.2.1 Auswahl der Strukturdimensionen
Wie bereits im vorangegangenen Kapitel angemerkt, ist die Auswahl der relevanten Strukturdimensionen zur Beschreibung von Organisationsstrukturen elementar. Je nach Problemstellung können für die Gestaltung einer Lösung in Form einer Konfiguration der Organisationsstruktur unterschiedliche Eigenschaften oder Dimensionen relevant sein (vgl. Kieser und Walgenbach 2010, S. 65). Aus diesem Grund lassen sich bei diversen Autoren verschiedene Gewichtungen der Dimensionen finden. Für die vorliegende Arbeit findet daher eine Dimensionsauswahl statt, um dem Ziel, Social SoftwareAnwendungen im Fokus der Organisationsstruktur und zu betrachten, gerecht zu werden. PICOT (2002, S. 238) schlägt z. B. die Dimensionen Aufgabenverteilung, Verteilung von Entscheidungsrechten, Verteilung von Weisungsbefugnissen und Programmierung 14 vor. Allerdings betrachtet PICOT zum Einen nicht explizit die Koordination und zum Anderen scheint die Bedeutung der Programmierung unter Berücksichtigung des Fokus Social Software auf Grund der mit dieser Dimension verbundenen Inflexibilität nicht passend. Bei WELGE findet die Koordination sdimension neben der Spezialisierung und Konfiguration mehr Gewicht, allerdings wird dort die Delegation nicht thematisiert (vgl. Welge 1987, S. 393f), welche bei der Betrachtung kollaborativer Social SoftwareAnwendungen berücksichtigt werden sollte. HILL ET AL. (1976, S. 173) nennen sechs Strukturdimensionen zur Beschreibung von Organisationsstrukturen. Diese lauten: (De- )Zentralisierung, Funktionalisierung, Delegation, Partizipation, Standardisierung und Arbeitszerlegung (vgl. Hill et. al. 1976, S. 173) . Da bei genauerer Betrachtung in allen Dimensionen die Formalisierung vorhanden ist (vgl. Hill et. al 1976, S. 171), erscheint eine eigene Dimension für die Standardisierung überflüssig. Obwohl HILL ET. AL. (ebd.) einen ähnlichen Ansatz wie KIESER UND KUBICEK (1992, S. 75-167) verfolgen, lässt sich auf Grund der expliziten Nennung von Koordination und Formalisierung eine bessere Eignung für die vorliegende Ausarbeitung feststellen. Folglich bilden die von KIESER UND KUBICEK (1992, S. 74) genannten Strukturdimensionen Spezialisierung, Koor- dination, Konfiguration, Entscheidungsdelegation und Formalisierung die Basis für die später in dieser Arbeit erfolgende Herausarbeitung der organisationalen Herausforderungen im Enterprise 2.0. Dazu werden diese Dimensionen in den nachfolgenden Unterkapiteln kurz beschrieben.
2.2.2.2 Art und Grad der Spezialisierung
„Die Dimension Spezialisierung bezieht sich auf den Kern der Organisationsstruktur die Frage, wie organisatorische Einheiten gebildet werden“ (Bamberger und Wrona 2004, S. 281). Diese Dimension besteht aus zwei Bestandteilen: die Aufgabenanalyse, die auch als Art der Spezialisierung bezeichnet wird und die Aufgabensynthese, die auch Grad der Spezialisierung genannt wird. Dabei wird der Aspekt zu Grunde gelegt, dass ein Aufgabenkomplex einen mengenmäßigen Umfang von Aufgaben nicht überschreiten darf, um ihn mit einer Person zu bewältigen (vgl. Kieser und Kubicek 1992, S. 76). An diesem Punkt beschäftigt sich die Aufgabenanalyse mit der sinnhaften Teilung einer Oberaufgabe in mehrere Teilaufgaben (vgl. Schulte-Zurhausen 1999, S. 40). Die Aufteilung kann laut KOSIOL (1962, S. 49ff) nach den Gliederungskriterien Rang, Phase, Verrichtung, Objekt oder Zweckbeziehung erfolgen. Dabei stehen die Kriterien Verrichtung und Objekt auch bei anderen Autoren besonders im Fokus (vgl. Bamberger und Wrona 2004, S. 293-294; Fiedler 2010, S. 35-36). Die Aufteilung nach Verrichtung findet sich in der Literatur häufig unter dem Begriff der funktionalen Organisation und beschreibt die Aufteilung z. B. in die Prozesse Einkauf, Produktion und Vertrieb (vgl. Fiedler 2010, S. 36-38). Die Gliederung nach Objekten, oder auch divisionale Organi- sation genannt, beschäftigt sich mit der Gliederung z. B. in Kundengruppen, Produktgruppen oder Regionen. Der Grad der Spezialisierung baut auf der Art der Spezialisierung auf. Hierbei werden die durch die Aufgabenanalyse entstandenen Teilaufgaben zu handhabbaren Aufgabenkomplexen zusammen gefasst (vgl. Schulte-Zurhausen 1999, S. 41). Auf diese Weise ergibt sich der Grad der Spezialisierung durch die Heterogenität der Aufgabenkomplexe (Kieser und Kubicek 1992, S. S. 76-78). Ein hoher Grad der Spezialisierung beinhaltet sowohl Vor- als auch Nachteile. KIESER UND KUBICEK (1992, S. 78) stellen unter anderem heraus, dass ein hoher Spezialisierungsgrad auf Grund der wenigen unterschiedlichen Tätigkeiten zum Einen eine schnellere Einarbeitung ermöglicht und zum Anderen Aufgabenabläufe schneller verinnerlicht werden. Wiederkehrende Durchführung und daraus resultierende Lerneffekte führen zu höherer Prozessgeschwindigkeit und damit zu höherer mengenmäßigen Leistung. Als Nachteil wird jedoch die Monotonie der Aufgaben angeführt, sowie der durch die Spezialisierung entstehende Koordinationsbedarf (vgl. Kieser und Kubicek 1992, S. 78 nach Friedmann 1956). Jener Koordinationsbedarf rechtfertigt die Betrachtung der Koordination als eigene Dimension.
2.2.2.3 Koordination
Ausgehend von der Spezialisierung und der damit verbundenen Arbeitsteilung besteht der Bedarf nach Abstimmung (vgl. Picot et. al 2002, S. 75). Hierbei steht nicht nur im Fokus die Aufgabenkomplexe ex ante und antizipativ entsprechenden Stelleninhabern zu zuweisen (Vorauskoordination), sondern ferner ex post im Störungsfall mit Koordinationsmaßnahmen reaktiv gegen zu steuern (Feedbackkoordination) (vgl. Kieser und Kubicek 1992, S. 100f; Vahs 2009, S. 108). Um diesem Koordinationsbedarf der Interdependenzen zwischen den Teilaufgaben entgegen zu wirken, werden Koordinations- mechanismen angewandt. Ähnlich der Strukturdimensionen lässt sich eine Vielzahl verschiedener Koordinationsmechanismen identifizieren. Diese werden zwischen strukturellen und nichtstrukturellen Mechanismen unterschieden (vgl. Bamberger und Wrona 2004, S. 283), allerdings wird ausgehend von der Relevanz in diesem Kapitel nur auf die strukturellen Koordinationsmechanismen15 eingegangen. KIESER UND KUBICEK (1992, S. 104-117) führen die vier Mechanismen persönliche Weisungen, Selbstabstim- mung, Programme und Pläne an. Diese sollen auch Gegenstand dieser Ausarbeitung sein, da jene Mechanismen durch die Berücksichtigung sowohl personenorientierter und technokratischer als auch hierarchischer und dezentraler Koordination den umfangreichsten Ansatz bieten. Ferner bietet diese Klassifizierung eine einfache Einordnung zur Eignung und exemplarischen Anwendbarkeit von Social Software-Anwendungen bei der Koordinationshandhabung. Persönliche Weisung meint die direkte vertikale Kommunikation zwischen übergeordneter und untergeordneter Instanz bei der die übergeordnete Instanz der Untergeordneten Anweisungen erteilt (hierarchische Koordination) (vgl. Bamberger und Wrona 2004, S. 283-284). Im Gegensatz dazu bietet die Selbstabstimmung (dezentrale Koordination) eine Entlastung der Kommunikationswege und höhere Mitarbeitermotivation als Folge von mehr Entscheidungsfreiraum durch Gruppenentscheidungsprozesse. „Beide Vorteile können zu einer Erhöhung der Flexibilität der Organisation führen.“ (Kieser und Kubicek 1992, S. 110). Programme und Pläne gehören der Kategorie der technokratischen Koordinationsmechanismen an. Beide implizieren laut BAMBERGER UND WRONA (2004, S. 284-285) an Verfahrensrichtlinien gekoppelte Handlungserwartungen und schränken somit die Flexibilität der Akteure ein. Programme können dabei nur bei wohlstrukturierten Problemen mit hoher Wiederho- lungshäufigkeit (Standardisierung) zur Anwendung kommen (vgl. Bamberger und Wrona 2004, S. 284). Mit Rückgriff auf die Erklärungen aus Kapitel 2.1 und unter Berücksichtigung der hier über die Flexibilität getroffenen Aussagen kann bereits an dieser Stelle die These aufgestellt werden, dass Social Software-Anwendungen in Unternehmen eher in Prozessen der Selbstabstimmung zum Einsatz kommen und auf Grund der strikten Vorgaben weniger in der Durchführung von Programmen zu finden sein werden.
2.2.2.4 Konfiguration
Die Dimension Konfiguration beschreibt die äußere Form des Stellengefüges (vgl. Kieser und Kubicek 1992, S. 126 nach Pugh et. al 1968) und besteht aus den Teildimensionen Gliederungstiefe, Leitungsspanne und Leitungssystem. Durch die Gliederungstiefe wird die „Anzahl der hierarchischen Ebenen eines Systems“ (Bamberger und Wrona 2004, S. 282) ausgedrückt, hingegen die Leitungsspanne die Anzahl einer Instanz direkt untergeordneten Stellen, welche auch als Subordinationsspanne bezeichnet wird, beschreibt (vgl. Kieser und Kubicek 1992, S. 151). Die Aussagekraft dieser beiden Teildimensionen ist allerdings umstritten. KIESER UND KUBICEK (ebd.) weisen darauf hin, dass eine starke Gliederungstiefe häufig mit einer geringen Leitungsspanne verbunden ist. Wenn jedoch nicht von einer reinen persönlichen Weisung ausgegangen wird und zudem technokratische Koordinationsinstrumente zum Einsatz kommen, kann trotz hoher Gliederungstiefe auch eine hohe Leitungsspanne existieren.
Das Leitungssystem zielt auf die Weisungsbefugnis innerhalb einer Organisationsstruktur ab und ist somit elementarer Bestandteil der hierarchischen Struktur. Da der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit der Einfluss von Social Software auf eben jene Struktur darstellt, widmet sich Kapitel 2.2.3 ausführlich dem Leitungssystem bzw. den sogenannten Formen von Organisationsstrukturen.
2.2.2.5 Entscheidungsdelegation
Die vierte betrachtete Hauptdimension ist die Entscheidungsdelegation. Diese ist von der in der Konfigurationsdimension erwähnten Weisungsbefugnis zu differenzieren. KIESER UND KUBICEK definieren die Entscheidungsdelegation als „umfangmäßige Verteilung von Entscheidungsbefugnissen“ (Kieser und Kubicek 1992, S. 155). Die Delegation ist damit unmittelbar mit anderen bereits erläuterten Dimensionen verknüpft, als dass eine Abhängigkeit zur Leitungsspanne existiert. VAHS (2003, S. 95) führt an, dass durch zunehmende Gliederungstiefe auf Grund der Entlastung der Unternehmensfüh- rung der Bedarf nach Delegation wächst. Auf diese Weise werden Entscheidungsbefugnisse, das „Recht, zukünftige Sachverhalte für die Organisation nach innen und/oder außen verbindlich festzulegen“ (Kieser und Walgenbach 2010, S. 151), an in der Hierarchie nachgelagerte Ebenen weiter gegeben (vgl. Vahs 2009, S. 96f). Diese Entscheidungsbefugnis kann die Mitarbeiter motivieren, jedoch besteht auch die Gefahr der Überforderung, Frustration und kann in Folge dessen zu Fehlentscheidungen führen (vgl. Bamberger und Wrona 2004, S. 185).
2.2.2.6 Formalisierung
Bei der fünften und nach KIESER UND KUBICEK (1992, S. 159-168) letzten Hauptdimension von Organisationsstrukturen handelt es sich um die Formalisierung. Unter Formalsierung wird der „Einsatz schriftlich fixierter organisatorischer Regeln in Form von Organisationsschaubildern, -handbüchern, Richtlinien, Stellenbeschreibungen usw.“ (Kieser und Kubicek 1992, S. 159; Kieser und Walgenbach 2010, S. 157) verstanden. Ferner findet sich in Anlehnung an PUGH ET. AL (1968) die Differenzierung in die drei Teildimensionen (i) Strukturformalisierung, (ii) Formalisierung des Informationsflusses und (iii) Leistungsdokumentation, die auch von VAHS (2003, S. 119-120) vertreten wird. Durch die schriftliche Fixierung formaler Regelungen steht die Formalisierung in direktem Zusammenhang mit den Dimensionen Spezialisierung, Koordination und Konfiguration. Laut KIESER UND KUBICEK können bei korrekter Erfassung eines Organisationsschaubildes unter anderem Aussagen über die Art der Spezialisierung oder der Weisungsbefugnisse getroffen werden (vgl. Kieser und Kubicek 1992, S. 161). BAMBERGER UND WRONA (2004, S. 285) stellen den Dokumentationscharakter als Vorteil heraus und auch Vahs (2009, S. 121) hält fest, dass durch die Formalisierung Aufgaben- und Kompetenzbereiche transparenter werden. Ein zu hoher Formalisierungsgrad kann sich jedoch nachteilig auswirken da so der Handlungsfreiraum der Mitarbeiter zu sehr eingeschränkt wird und dieser Überorganisation zur Folge haben kann (vgl. Hill et. al 1976, S. 171; Vahs 2009, S. 121). Auch die Papierflut, die sich häufig durch einen zu hohen Formalisierungsgrad ergibt, wirkt sich negativ auf die Mitarbeitermotivation aus (vgl. Vahs 2009, S. 121).
2.2.3 Formen von Organisationsstrukturen
Formale Organisationsstrukturen lassen sich, entsprechend ihrem Leitungssystem, in mehrere Formen unterteilen. Obwohl sich in der Literatur noch weitere, abgespaltene,
Formen finden lassen (z. B. Stablinienorganisation oder reine Projektorganisation (vgl. Fiedler 2010, S.43, 46)), beschränkt sich dieses Kapitel neben den idealtypischen Formen Einliniensystem und Mehrliniensystem auf Grund der Popularität in der Praxis (vgl. Vahs 2003, S. 138) auf die Beschreibung der Matrixorganisation. Hierbei werden die Merkmale sowie deren Vor- und Nachteile herausgestellt. Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt wurde, handelt es sich bei der Organisationsstruktur um die Verbindung zwischen Stellen und übergeordneten Leitungsstellen. Durch sogenannte Linien werden Weisungen zu niedrigeren Stellen einerseits und Meldewege zu höheren Stellen andererseits, beschrieben (vgl. Vahs 2003, S. 109).
Die in den grafischen Darstellungen zu sehenden Verbindungslinien zwischen den Leitungsstellen (doppelt umrandeten Rechtecke) und den ausführenden Stellen (einfach umrandete Rechtecke) stellen Weisungs- und Meldewege dar.
2.2.3.1 Einliniensystem
Das Einliniensystem zeichnet sich dadurch aus, dass für jede Stelle in der Organisationsstruktur lediglich eine weisungsbefugte übergeordnete Instanz existiert (vgl. Fiedler 2010, S. 33). Bild 4 zeigt ein exemplarisches Organisationsschaubild (Organigramm), das diesen Aspekt durch die Linien zwischen den einzelnen Stellen modelliert. Im Umkehrschluss bedeutet dies gleichsam, dass äquivalent zum Weisungsweg (top-down) im Einliniensystem nur ein Meldeweg (bottom-up) existiert (vgl. Vahs 2003, S. 109-110). Dem entsprechend, dass bei einem idealtypischen Einliniensystem keine Instanzebene übersprungen werden darf, kommt es zu langen Kommunikationswegen (ebd. S. 110). Die einzige Ausnahme stellt die fayolsche Brücke dar, die 1919 auf Henri FAYOL zurück geht (vgl. Kieser und Kubicek 1992, S. 127). Diese ermöglicht, wie in Bild 4 zu sehen ist, die Kommunikation zwischen Stellen derselben Hierarchieebene, wenn gleich im Nachgang dieser direkten Kommunikation eine Meldung an die übergeordnete Instanz erfolgen muss (vgl. Vahs 2003, S. 110).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 4: Einliniensystem
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Vahs 2003, S. 109)
Auch wenn sich rückgreifend auf das Thema dieser Ausarbeitung bereits an dieser Stelle die Frage stellt, inwieweit sich die selbstbestimmten Social-Software-Anwendungen mit der heroischen Struktur des Einliniensystem vereinbaren lassen, existieren für das Einliniensystem auch Vorteile. VAHS (2003, S 110) oder auch SCHULTE-ZURHAUSEN (2010, S. 255) stellen heraus, dass durch die eindeutigen Regelungen der Unterstellungsverhältnisse und der damit verbundenen Kompetenz- und Verantwortungsverteilung ein vermindertes Risiko von (Kompetenz)Konflikten existiert. Zudem ergeben sich durch die einfache Leitungsstruktur nicht nur den Informationsfluss betreffende, sondern auch generelle Kontrollmöglichkeiten. Dem gegenüber steht als Nachteil die durch die Kontrolle bedingten langen Kommunikations- und Weisungswege (vgl. Vahs 2003, S. 110). Da der Informationsfluss keine Hierarchieebenen überspringt, entsteht eine hohe Belastung für die Leitungsstellen, die sich zum Einen auf Informationsfilterungen und zum Anderen auf die Gefahr der Überorganisation auswirkt (ebd.). Desweiteren wird auf diesem Weg das Hierarchiedenken gefördert und die Abhängigkeit der Mitarbeiter von der übergeordneten Leitungsstelle hervorgehoben.
2.2.3.2 Mehrliniensystem
„Beim Mehrliniensystem erhalten in Anlehnung an das Funktionsmeistersystem von TAYLOR die nachgeordneten Stellen von mehreren vorgesetzten Leitungsstellen Anweisungen“ (Vahs 2003, S. 110). Im Gegensatz zum Einliniensystem bei dem die Positionsmacht im Vordergrund steht, steht beim Mehrliniensystem die funktionale Mehrfachunterstellung im Mittelpunkt. Diese ermöglicht die direkte Kommunikation mit den fachspezifischen übergeordneten Leitungsstelleninhabern und wird aus diesem Grund auch als Prinzip des kürzesten Weges bezeichnet (vgl. Schulte-Zurhausen 2010, S. 254). Die grafische Darstellung eines idealtypischen Mehrliniensystems zeigt Bild 5. Ebenso beim Mehrliniensystem lassen sich Vor- und Nachteile identifizieren. VAHS (2003, S. 111) nennt als Vorteil die Verteilung der Leitung und damit einhergehende Spezialisierung auf mehrere funktionale Leitungsstellen. Dadurch wird die Leitungsspitze entlastet und die fachliche Autorität betont. Die Mehrfachunterstellung führt zu geringerer hierarchischer Distanz, was wiederum kürzere Informations- und Weisungswege durch direkte und schnelle Kommunikation begünstigt. Auf der anderen Seite führt VAHS (ebd.) als Nachteile die problematische Abgrenzung von Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen und die Gefahr widersprüchlicher Weisungen und damit verbundenen Kompetenzkonflikten an.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 5: Mehrliniensystem
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Vahs 2003, S. 109)
Zudem kann der große Bedarf an Leitungskräften als Nachteil gesehen werden. Auch SCHULTE-ZURHAUSEN (2010, S. 255) betont den umfangreichen Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf sowie die problematische Zurechnung von Fehlern als Nachteil von Mehrliniensystemen (vgl. auch Vahs 2003, S. 111).
Obwohl beim Mehrliniensystem die hierarchische Distanz geringer als im Einliniensystem ist und die Mehrfachunterstellung mehr Flexibilität hinsichtlich der Wahl des Kommunikationsweges bietet, stellt sich die Frage, ob diese Flexibilität bereits zur besseren Eignung für den Einsatz von Social Software-Anwendungen im Unternehmen führt.
2.2.3.3 Matrixorganisation
Die Matrixorganisation stellt eine Spezialform des Mehrliniensystems dar (vgl. Schulte-Zurhausen 2010, S. 255). Wie in Bild 6 ersichtlich, verteilen sich die Leitungsfunktionen auf zwei Matrixstellen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 6: Matrixorganisation
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Vahs 2003, S. 112)
Diese beiden übergeordneten Leitungsstellen (Matrixstellen) werden häufig zum Einen nach Verrichtung (z. B. Beschaffung, Produktion, Absatz) und zum Anderen nach Objekt (z. B. Produktgruppe oder Kundengruppe) differenziert (vgl. Bleicher und Meyer 1976, S. 119). Matrixstellen sind gegenüber den untergeordneten Stellen (Matrixschnittstellen) weisungsbefugt (vgl. Schulte-Zurhausen 2010, S. 255f; Vahs 2009, S. 114). Sich dadurch ergebende widersprüchliche Weisungen können von der Matrixleitung beseitigt werden. Die Matrixleitung ist den beiden Matrixstellen direkt übergeordnet und hat die Funktion der Koordination dieser sowie die Konflikthandhabung inne (vgl. Vahs 2009 S. 114f). Dabei werden die Vor- und Nachteile der Matrixorganisation deutlich. Durch die unterschiedliche Ausrichtung der Matrixstellen wird die Matrixleitung entlastet. Nachteilig ist jedoch die uneinheitliche Leitung die nicht nur zu Kompetenzkonflikten führt, sondern ferner ein höheres Kommunikations- und Abstimmungsmaß bedingt (vgl. Vahs 2009, S. 115). Bei SCHULTE-ZURHAUSEN (2010, S. 257) sowie bei VAHS (2003, S. 114) lassen sich noch weitere Vor- und Nachteile identifizieren. Beide Autoren stellen positiv fest, dass durch die Matrixorganisation das Hierarchiedenken verringert wird und die direkte Kommunikation den Austausch von Informationen erhöht. Desweiteren fördern die dadurch entstehenden positiven Konflikte die Problembewältigung. Außerdem können durch die Zusammenarbeit mit zwei übergeordneten Leitungsstellen Spezialisierungsvorteile genutzt werden. Als Nachteil nennen SCHULTEZURHAUSEN (2010, S. 257) und VAHS (2003, S. 114) den hohen Bedarf an Leitungskräf- ten, der durch die spezialisierten Matrixstellen entstehen. Auch die hohen Anforderungen an die Kooperationsfähigkeit stellen einen Nachteil dar (ebd.).
2.3 Unternehmenskultur
Ziel dieses Kapitels ist die Definition und Begriffserklärung von Unternehmenskultur. Auf Basis der Popularität in der Literatur wird das drei Ebenen Modell von SCHEIN dabei besonders hervorgehoben (vgl. Steinmann und Schreyögg 2005, S. 712-717; Staehle 1999, S. 498-499). Wegen der Bedeutung für die Betrachtung des organisationalen Wandels wird zum Abschluss auf den Zusammenhang zwischen Organisationsstruktur und Unternehmenskultur eingegangen.
2.3.1 Definition und Begriffserklärung
Im Vergleich zur Organisationsstruktur lässt sich der Kulturbegriff nicht trennscharf abgrenzen. Der Ursprung der Kultur liegt in der Anthropologie und Ethnologie und wurde erst später sukzessive auf die Soziologie, Psychologie und Betriebswirtschaft übertragen (vgl. Scherm und Süß 2001, S. 20; Staehle 1999, S. 498). Wie Tabelle 1 zeigt, haben sich im Laufe der Zeit daraus diverse Definitionen oder Auffassungen von Unternehmenskultur entwickelt.
Tabelle 1: Auffassungen von Unternehmenskultur
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Kutschker und Schmid 2008, S. 685 nach Schmid 1996)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Trotzdem lassen sich folgende Kernmerkmale der Unternehmenskultur über die verschiedenen Definitionen hinweg identifizieren (vgl. Schreyögg 2008, S. 365): Implizit: selbstverständliche Annahmen und geteilte Überzeugungen prägen das Handeln in der Alltagspraxis.
Kollektiv: gemeinsame Orientierungen, Werte, Handlungsmuster machen die Unternehmenskultur zu einem kollektiven Phänomen.
Konzeptionell: durch die Vorgabe von Mustern für die Selektion und Interpretation von Ereignissen wird durch die Unternehmenskultur eine konzeptionelle Welt des Systems repräsentiert.
Emotional: zu gemeinsamen Orientierungen und Werten gehört auch die Normierung von dem was gehasst und was geliebt wird.
Historisch: die Unternehmenskultur entsteht durch stetige Lernprozesse. Durch diese Entwicklung als Reaktion auf den Umgang mit Problemen und Umwelteinflüssen entsteht eine Historie. Implizit ist damit auch der fortwährende Änderungsprozess von Kulturen und der nie abgeschlossene Lernprozess erwähnt.
[...]
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
2 Nicht zu verwechseln mit dem internationalen, überwiegend im angelsächsischen Raum benutzten, Begriff des Information Systems (IS), welcher andere Forschungsziele impliziert, als die deutschsprachige Wirtschaftsinformatik dies tun (vgl. Frank 2007, S. 157)
3 Technisch kann ein Link immer nur auf eine (Web)Seite verweisen. Auf einer (Web)Seite können allerdings mehrere Artikel existieren so dass ein Link zwar rekursiv auf dieselbe Seite, jedoch auf einen anderen Artikel verweist.
4 Andere sehen Peter Merholz oder Tim Berners-Lee als Schöpfer dieses Begriffs (vgl. Alby 2006; Berners-Lee 1999).
5 Siehe: http://www.blogger.com.
6 Vergleiche z. B. den Blog von Klaus Nitsche (2011)
7 http://www.flickr.com
8 Voice-over-IP (VoIP) bezeichnet die Möglichkeit Sprachsingnale über das Internet zu senden.
9 http://www.icq.com/de
10 http://www.aim.com/
11 Offen bezeichnet in diesem Zusammenhang, dass sich die Nutzung nicht auf eine geschlossene Gruppe von Usern beschränkt, sondern alle Internetnutzer diese Dienste verwenden können.
12 http://twitter.com/
13 Es existieren diverse Organisationstheorien, wie z. B. der Bürokratie-Ansatz, der situative Ansatz, der Population-Ecology-Ansatz oder die Transaktionskostentheorie, welche sich der Organisationsstruktur als Instrument des äußeren Stellengefüges bedienen und auf Basis der Organisationstheorien die verschiedenen Formen und die optimale Gestaltung von Organisationsstrukturen erklärt werden können (vgl. Kieser und Walgenbach 2010, S. 1). Allerdings ist - da die Erläuterung der Organisationsstrukturen nur der Grundlage für den Bezug zur Organisationskultur dient - die Erklärung der verschiedenen Organisationstheorien nicht zielführend. Entsprechende Erläuterungen zu den Organisationstheorien lassen sich jedoch in der Literatur z. B. bei KIESER UND EBERS (2006), SCHULTE-ZURHAUSEN (2010) oder VAHS (2009) finden.
14 In diesem Zusammenhang beschreibt die Programmierung (auch Standardisierung oder Programme genannt) den Grad, inwieweit Prozesse mit Hilfe von Routinen (Verfahrensrichtlinien) beschrieben werden können (vgl. Kieser und Kubicek 1992, S. 110-111).
15 Eine Übersicht über die Klassifizierung struktureller Koordinationsmechanismen findet sich bei WELGE (1987, S. 413).
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Enterprise 2.0"?
Enterprise 2.0 bezeichnet den Einsatz von Social Software-Anwendungen wie Wikis, Blogs und sozialen Netzwerken innerhalb eines Unternehmens zur Verbesserung der Zusammenarbeit.
Welche Social Software eignet sich für Wissensmanagement?
Besonders Wikis, Weblogs und Social Bookmarking werden als effektiv für die Speicherung und Verteilung von Wissen in Organisationen angesehen.
Wie verändert Enterprise 2.0 die Unternehmenskultur?
Der Einsatz erfordert eine Kultur der Offenheit und des Teilens, führt aber oft auch zu einer Demokratisierung der Kommunikation und flacheren Hierarchien.
Was sind die Risiken von Enterprise 2.0?
Zu den Risiken gehören Informationsüberflutung, mangelnde Kontrolle über Inhalte und die Notwendigkeit, bestehende Organisationsstrukturen grundlegend anzupassen.
Welchen Nutzen hat die externe Sichtweise von Social Software?
Extern eingesetzt können Blogs oder soziale Netzwerke die Kundenbindung stärken, das Marketing verbessern und den direkten Dialog mit der Zielgruppe ermöglichen.
- Citar trabajo
- Sven Dembski (Autor), 2012, Enterprise 2.0. Potenziale und organisationale Herausforderungen für das Wissensmanagement, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203403