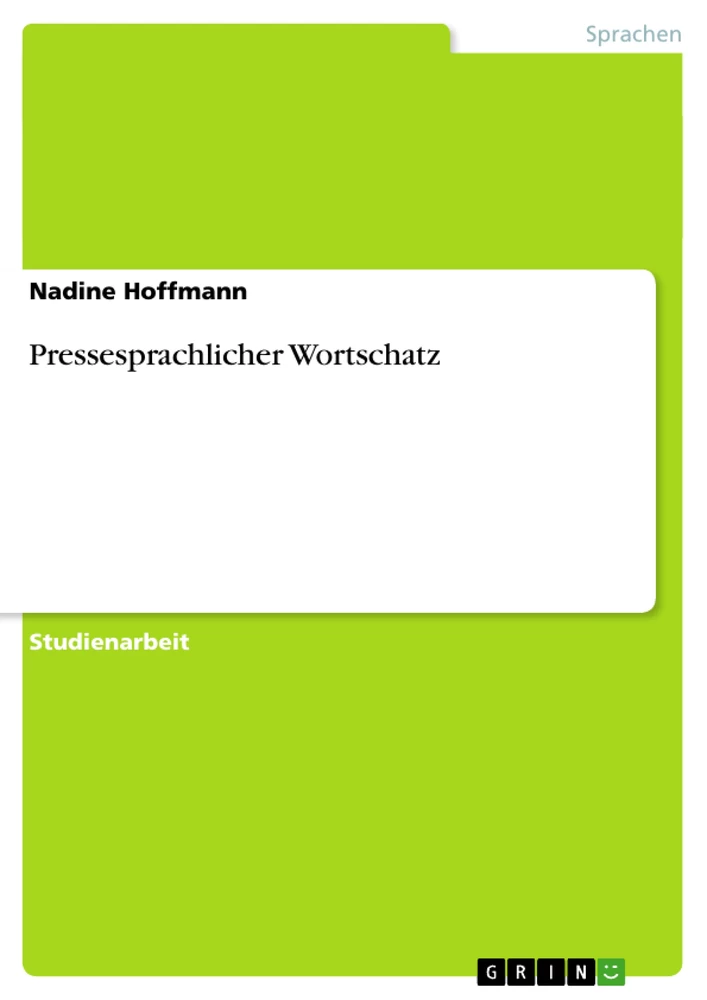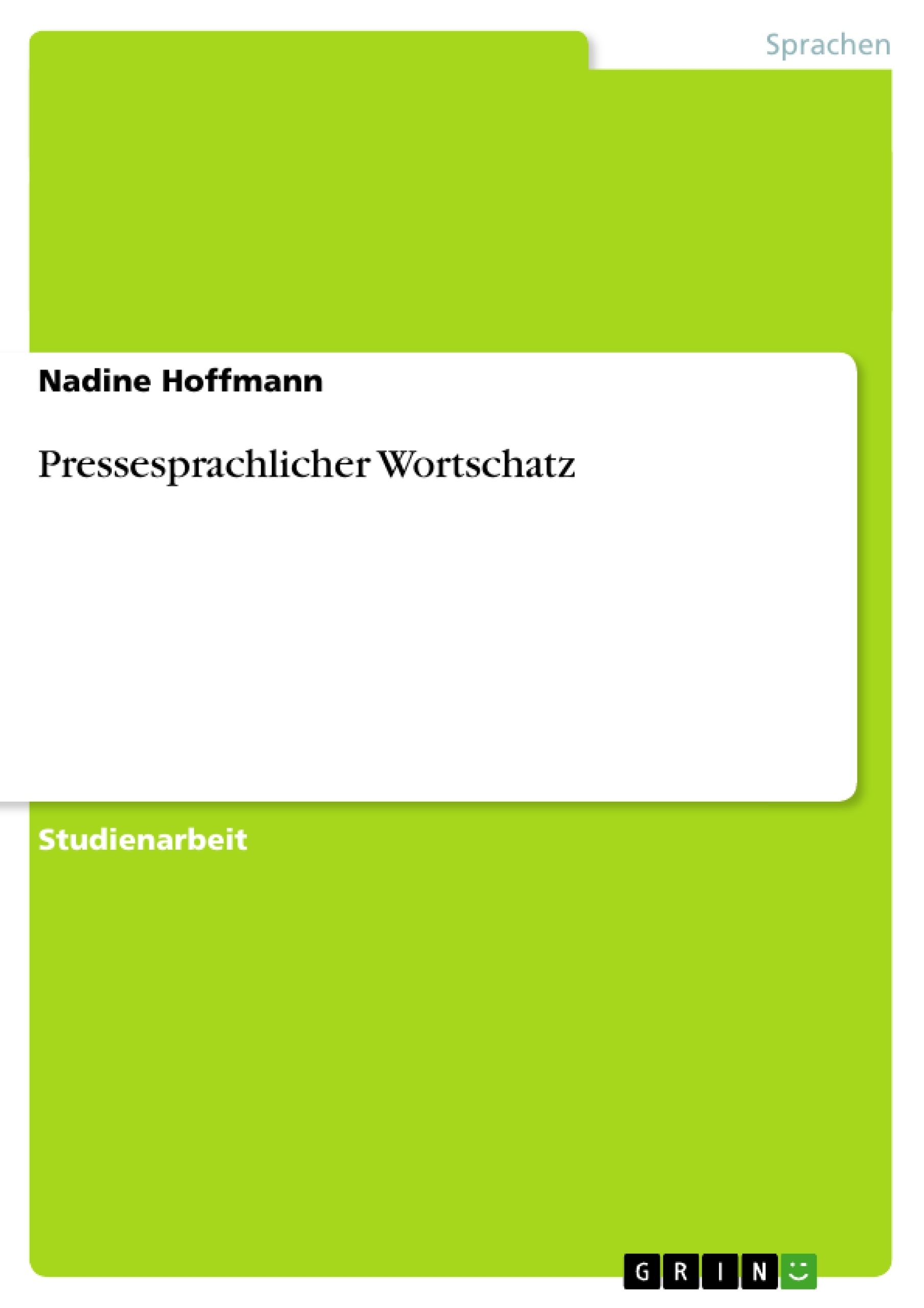Pressesprachlicher Wortschatz
[...]
Einleitung
Seit der Entstehung der Printmedien wettern Philosophen und Sprachpfleger, Lehrer und Dichter gegen den Sprachgebrauch der Journalisten. Schopenhauer wendet sich beispielsweise in seinem Werk „Parerga und Paralipomena“ (1851) erbittert gegen die „Zeitungsschreiberei“ und deren „Sprachverhunzungen“, die er in der Verwendung des ein oder anderen „nicht bei guten Schriftstellern anzutreffenden Wortes“ entdeckt. Ein halbes Jahrhundert zuvor hatte Goethe 1801 bereits moniert, dass Wörter, „mit denen nur das Beste bezeichnet werden sollte als Phrasen“ angewendet werden, „um das Mittelmäßige oder wohl gar das Geringe zu maskieren.“
Derartige Äußerungen lassen auf die Existenz einer speziellen Pressesprache schließen, was im folgenden zu prüfen ist. Wie könnte sie entstehen und wo liegen gegebenenfalls ihre Besonderheiten? Aus diesen Überlegungen wird daraufhin eine geeignete Vorgehensweise erarbeitet, um sich den Besonderheiten eines pressesprachlichen Wortschatzes – hier insbesondere dem der spanischen Presse – anzunähern und dessen Auswirkungen auf die Umgangs- bzw. Normsprache zu untersuchen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Problematik der Bezeichnung „Pressesprache“
- Die Heterogenität des Begriffs „Presse“
- Die Entstehung einheitlicher Tendenzen in der Pressesprache
- Untersuchungsansätze zum pressesprachlichen Wortschatz
- Tendenzen des pressesprachlichen Wortschatzes im Spanischen
- Neologismen
- Wortentlehnung
- Definition
- Extern-Entlehnungen – Wege und Arten der Hispanisierung
- Wortschatzbereiche und ihre wichtigsten Spendersprachen
- Komposita
- Präfigierung und Suffigierung
- Substantivierung
- Neuwortbildung durch Verkürzung
- Apokopenbildung
- Sigelwörter
- Aufnahme von (Gebrauchs-) Fehlern in die Sprachnorm
- Wortentlehnung
- Wortschatzverbreitung
- Verschiebung in der relativen Häufigkeit von Wörtern
- Regionale Varianten – Intern-Entlehnungen
- Eindringen fachsprachlicher Ausdrücke „tecnicismos“
- Verschiebung in der relativen Häufigkeit von Wörtern
- Weitere Auffälligkeiten in der Ausdrucksweise
- „Seudocultismo/semicultismo“
- Drastische Ausdrucksweise und emotionale Färbung des Wortschatzes
- Poetische Wörter, Wortspiele, Sprichwörter
- Bildhafte Ausdrucksweise
- Fazit
- Neologismen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem pressesprachlichen Wortschatz im Spanischen. Ziel ist es, die Besonderheiten dieses Wortschatzes zu untersuchen und dessen Auswirkungen auf die Umgangs- bzw. Normsprache zu analysieren.
- Heterogenität des Begriffs "Presse" und die damit verbundene Schwierigkeit einer homogenen Pressesprache
- Tendenzen zur Wortentlehnung aus Fremdsprachen und fachfremden Bereichen
- Untersuchung verschiedener Neologismenbildungsverfahren im Spanischen
- Einfluss von Zeitdruck, Informationsvermittlung und Wettbewerb auf den Sprachgebrauch der Presse
- Analyse von sprachlichen Auffälligkeiten und deren Auftreten in verschiedenen thematischen Bereichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die historischen Wurzeln der Debatte um den Sprachgebrauch der Journalisten. Es wird die Problematik einer einheitlichen Pressesprache angesprochen und die Heterogenität des Begriffs „Presse“ erläutert. Außerdem werden die Produktionsbedingungen der Presse und deren Einfluss auf die Sprache beleuchtet.
Kapitel 1 befasst sich mit der Problematik der Bezeichnung „Pressesprache“. Es werden die unterschiedlichen Facetten des Begriffs „Presse“ sowie die Entstehung einheitlicher Tendenzen in der Pressesprache besprochen. Weiterhin werden die verschiedenen Untersuchungsansätze zum pressesprachlichen Wortschatz vorgestellt.
Kapitel 2 widmet sich den Tendenzen des pressesprachlichen Wortschatzes im Spanischen. Es werden die Neologismenbildungsverfahren im Detail beleuchtet, insbesondere die Wortentlehnung, die verschiedenen Formen der Hispanisierung, die wichtigsten Spendersprachen und die Wortbildung durch Komposita, Präfixierung, Suffigierung und Substantivierung.
Kapitel 3 analysiert die Verbreitung des pressesprachlichen Wortschatzes, einschließlich der Verschiebung der Häufigkeit bestimmter Wörter, regionaler Variationen und des Eindringens fachsprachlicher Ausdrücke. Außerdem werden Auffälligkeiten in der Ausdrucksweise wie „Seudocultismo/semicultismo“, drastische Ausdrucksweise, emotionale Färbung und Bildsprache näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Pressesprache, Spanisch, Neologismen, Wortentlehnung, Hispanisierung, Komposita, Präfigierung, Suffigierung, Substantivierung, Wortschatzverbreitung, regionale Variationen, Fachsprache, „Seudocultismo/semicultismo“, drastische Ausdrucksweise, emotionale Färbung, Bildsprache.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine spezifische „Pressesprache“?
Die Arbeit untersucht, ob durch Zeitdruck und Informationszwang ein eigener Wortschatz und Stil der Presse entstanden ist, der von der Normsprache abweicht.
Wie entstehen Neologismen in der Presse?
Häufig durch Wortentlehnungen aus dem Englischen, Komposita, Präfixe/Suffixe oder Verkürzungen (z. B. Sigelwörter).
Welche Rolle spielen Anglizismen in der spanischen Presse?
Sie dringen massiv in Fachbereiche wie Wirtschaft und Technik ein und werden oft durch "Hispanisierung" an die spanische Sprache angepasst.
Was sind „tecnicismos“?
Es handelt sich um Fachbegriffe, die aus Spezialgebieten in die allgemeine Berichterstattung übernommen werden und dort den Wortschatz erweitern.
Beeinflusst die Presse die allgemeine Sprachnorm?
Ja, durch die weite Verbreitung von journalistischen Ausdrücken und sogar Fehlern können diese langfristig in die Umgangssprache und Norm übergehen.
- Quote paper
- Nadine Hoffmann (Author), 2000, Pressesprachlicher Wortschatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20349