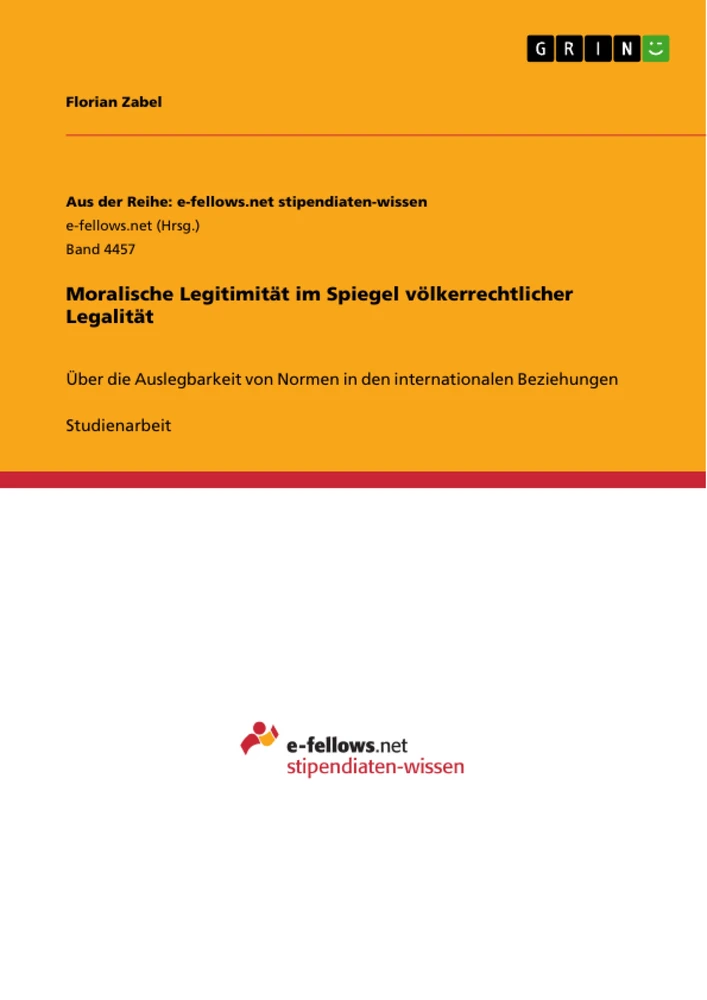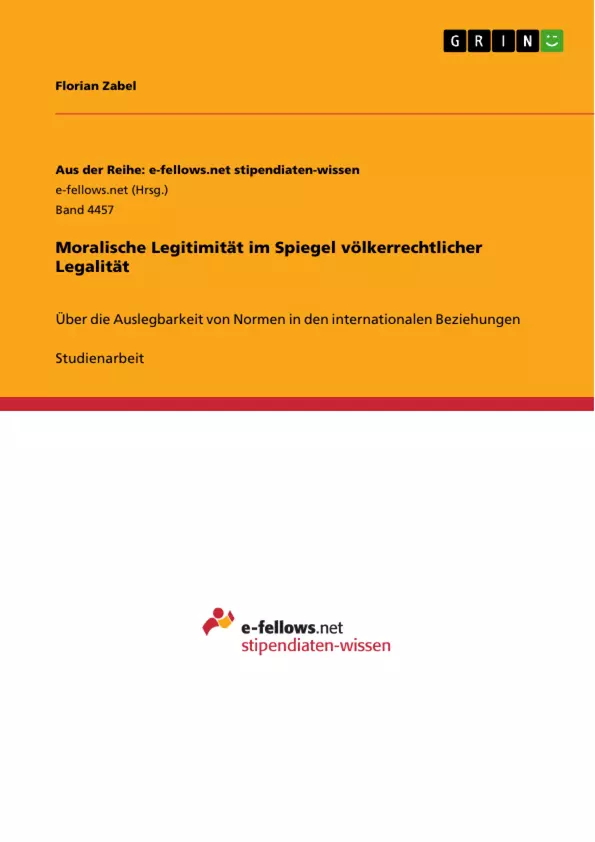Betrachtet man Normen in den internationalen Beziehungen so stellt sich heraus, dass der Umgang mit ihnen in Krisensituation aufgrund ihrer Auslegbarkeit oft problematisch ist. Das aktuellste Beispiel in diesem Kontext ist der innerstaatliche Konflikt in Syrien. Obwohl es eine moralische Grundhaltung und ein Bedürfnis der internationalen Gemeinschaft ist diesen Konflikt zu klären, gibt keine verbindliche Regelung, die diesen Konflikt erfassen und lösen kann. Effiziente Lösungen durch konstituierte Normen können daher im Konfliktfall selten alle Akteure zufriedenstellen, obwohl es ihnen ein dringendes Anliegen ist. Die Kernfrage der vorliegenden Hausarbeit lautet daher: Kann sich moralische Legitimität zu völkerrechtlichen Legalität wandeln? Wenn ja wie?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung - Fragestellung - Vorhaben
- 2. Die Theorie: „Normen sind, was Akteure daraus machen.“
- 3. Das Folterverbot - Ein Paradebeispiel?
- 3.1 Status Quo
- 3.2 Das Paradox des Folterverbots
- 4. Perspektivlos oder vorbildlich? Die Humanitäre Intervention
- 4.1 Historischer Exkurs und Handlungsoptionen
- 4.2 Zielkonflikt
- 4.3 Ein historischer Wendepunkt?
- 4.4 Zwischenfazit
- 5. Ein Ausblick - Die Praxis der Responsibility to Protect
- 5.1 Die drei Säulen
- 5.2 Eine Frage der Umsetzung
- 5.3 Die Wirkung als Norm
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Beziehung zwischen moralischer Legitimität und völkerrechtlicher Legalität im Kontext internationaler Beziehungen. Sie konzentriert sich auf die Interpretation und Anwendung von Normen in Krisensituationen und stellt die Frage, ob und wie sich moralisches Empfinden in verbindliche völkerrechtliche Regelungen umsetzen lässt.
- Auslegbarkeit von Normen in der internationalen Politik
- Die Rolle von Akteuren bei der Konstitution und Anwendung von Normen
- Das Verhältnis von formalen Normen und sozialer Akzeptanz
- Beispiele des Folterverbots und der humanitären Intervention
- Die Responsibility to Protect als möglicher Ansatz für eine stärkere normative Legitimität
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Kernfrage der Arbeit dar: Kann sich moralischer Legitimität zu völkerrechtlicher Legalität wandeln? Die Arbeit soll diese Frage anhand des theoretischen Ansatzes von Wiener und Puetter und anhand praktischer Beispiele diskutieren.
- Kapitel 2: Die Theorie von Wiener und Puetter, „Normen sind, was Akteure daraus machen", wird vorgestellt. Die Autoren argumentieren, dass die Auslegbarkeit und Interpretierbarkeit von Normen in Krisensituationen zu Problemen führt, da Normen oft von verschiedenen Akteuren unterschiedlich verstanden werden.
- Kapitel 3: Das Folterverbot wird als Beispiel für die Problematik der Auslegbarkeit von Normen analysiert. Der Text von Andrea Lieses, „How Liberal Democracies Contest the Prohibition of Torture and III-Treatment when Countering Terrorism“, liefert wichtige Einblicke in die komplexe Beziehung zwischen Normen und praktischer Umsetzung.
- Kapitel 4: Der Artikel von Nicholas J. Wheeler, „Reflections on the Legality and Legitimacy of NATO's Intervention in Kosovo", dient als Grundlage für die Untersuchung der humanitären Intervention als Beispiel für ein mögliches Spannungsverhältnis zwischen moralischer Legitimität und völkerrechtlicher Legalität.
- Kapitel 5: Der Text von Alex J. Bellamy, „The Responsibility to Protect Five Years On", bietet einen Ausblick auf die Praxis der Responsibility to Protect als möglicher Ansatz für eine stärkere normative Legitimität in internationalen Beziehungen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der internationalen Beziehungen wie Normen, Moral, Legitimität, Völkerrecht, Konfliktlösung, humanitäre Intervention, Responsibility to Protect. Sie analysiert die Entstehung, Auslegbarkeit und Anwendung von Normen und untersucht die Rolle von Akteuren, sozialen und kulturellen Faktoren bei der Gestaltung und Umsetzung von Normen in der internationalen Politik.
Häufig gestellte Fragen
Kann moralische Legitimität zu völkerrechtlicher Legalität werden?
Die Arbeit untersucht diesen Wandlungsprozess und stellt die Frage, wie moralische Bedürfnisse der Weltgemeinschaft in verbindliche völkerrechtliche Regeln überführt werden können.
Was besagt die Theorie von Wiener und Puetter?
Die Theorie „Normen sind, was Akteure daraus machen“ besagt, dass die Auslegung von Normen in Krisensituationen stark von den beteiligten Akteuren abhängt.
Was ist das „Paradox des Folterverbots“?
Es beschreibt die Diskrepanz zwischen der formalen Ächtung von Folter und der tatsächlichen Praxis einiger Staaten, die das Verbot im Rahmen der Terrorismusbekämpfung umgehen oder uminterpretieren.
Was versteht man unter der „Responsibility to Protect“ (R2P)?
R2P ist ein völkerrechtliches Konzept, das die internationale Gemeinschaft verpflichtet, einzugreifen, wenn ein Staat seine Bevölkerung nicht vor schweren Menschenrechtsverletzungen schützt.
Welcher Zielkonflikt besteht bei humanitären Interventionen?
Es besteht oft ein Spannungsverhältnis zwischen dem völkerrechtlichen Gebot der staatlichen Souveränität und der moralischen Pflicht zum Schutz von Menschenleben.
- Citar trabajo
- Florian Zabel (Autor), 2012, Moralische Legitimität im Spiegel völkerrechtlicher Legalität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203640