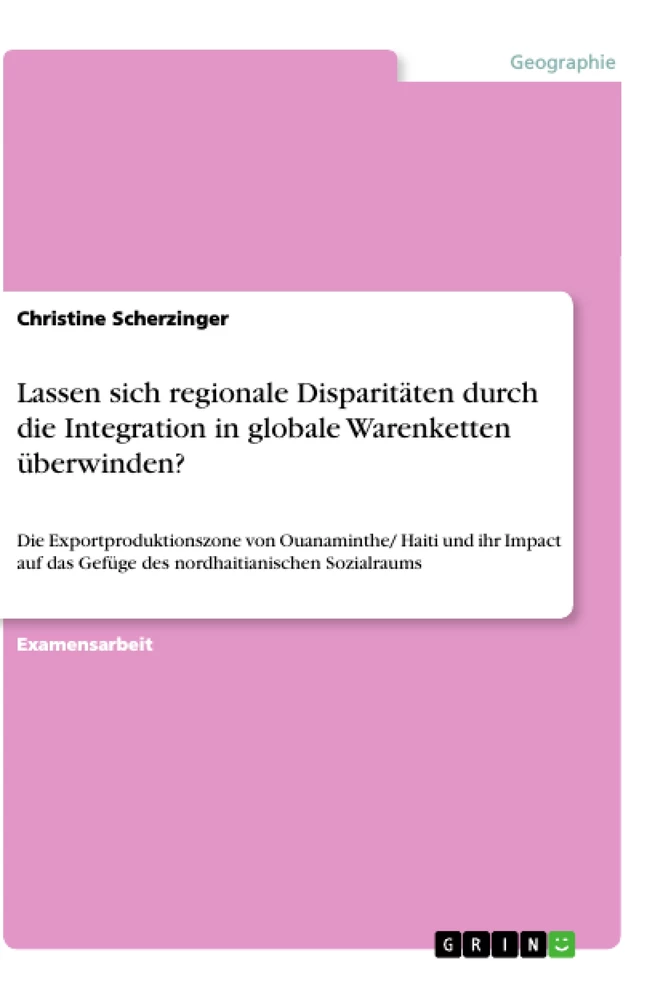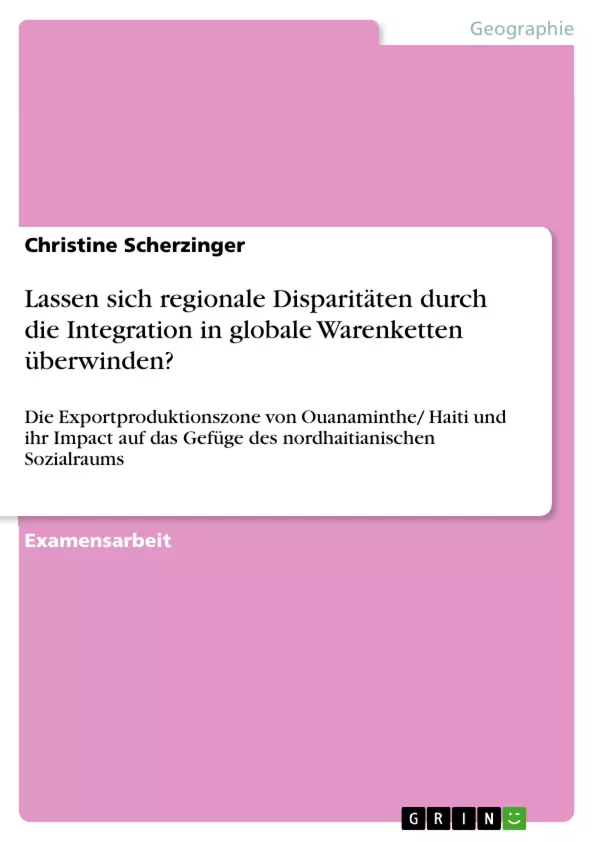Das dynamische Wachstum des Welthandels während der letzten 30 Jahre ging mit
strukturellen, politischen und technologischen Veränderungen einher, die eine Reorganisation
der globalen Produktion zur Folge hatten. Eines der Kennzeichen dieser Reorganisation
ist die vertikale Desintegration transnationaler Unternehmen. Im Zuge der
Globalisierung, die durch die rasante Entwicklung und Verbreitung kostengünstiger
Transport- und Kommunikationsmittel gekennzeichnet ist, wurde die räumliche Zerlegung
der Produktionsprozesse, insbesondere die Auslagerung von arbeitsintensiven
und wertschöpfungsgeringen Produktionsschritten in Niedriglohnländer zur Erhöhung
der Gewinnmargen befördert. Produktion findet seither zunehmend in globalen Warenketten
statt, die sich über den ganzen Globus spannen.
Die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen internationalen Institutionen zur Regulierung
des Welthandels- und Weltfinanzsystems (WHO, GATT, Weltbank, IWF) verfolgten
vor allem in den 80er und 90er Jahren die Strategie, wirtschaftliche Stagnation
und regionale Disparitäten durch eine verstärkte Integration der Volkswirtschaften der
südlichen Länder in den Weltmarkt zu überwinden, und schufen auf diese Weise die
ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, die die Globalisierung der Warenketten
beförderten. Zentrale Elemente dieser Strategie waren: Deregulierung und Öffnung der
Volkswirtschaften für private, vor allem ausländische, Investoren, Liberalisierung des
Handels (insbesondere Abbau von Schutzzöllen) und exportorientierte Wirtschaftspolitik
(World Bank 1992).
Dadurch, dass die Unternehmen die Warenproduktion immer mehr in Teilfertigungen
aufspalten, können sie diese jeweils der günstigsten Kombination von Kapital und Arbeitskräften
räumlich zuordnen (Schamp 2000). Seitens der Politik geschaffene Voraussetzungen
erleichtern die internationalen Interaktionen und erlauben den Unternehmen
eine optimale Nutzung vorhandener Ressourcen (global sourcing) mit dem
Ziel der Kosteneinsparung und Gewinnmaximierung (Kulke 2005).
Vor allem arbeitsintensive Produktionsschritte, in denen keine Größeneffekte erzielt
werden, wurden aus den Industrieländern in Exportproduktionszonen der Niedriglohnländer
verlagert. Die Ausfuhr von teilgefertigten Produkten zur arbeitsintensiven Bearbeitung
in den Niedriglohnländern und die anschließende Wiedereinfuhr in die Industrieländer
werden als passive Lohnveredelung beschrieben (Fröbel et al. 1977).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Einführung in das Thema und Forschungsstand
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Forschungsstand und Relevanz
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Der theoretische Bezugsrahmen
- 2.1 Netzwerkperspektivische Theorien
- 2.1.1 Global Commodity Chain Ansatz
- 2.1.2 Global Production Network Ansatz
- 2.1.3 Ansatz der Industriedistrikte
- 2.2 Entwicklungs- und Wachstumstheorien
- 2.2.1 Ausgleich oder Polarisierung regionaler Disparitäten
- 2.2.2 Fragmentierende Entwicklung
- 2.3 Exportproduktionszonen in der wissenschaftlichen Diskussion
- 2.3.1 Definition der Exportproduktionszonen
- 2.3.2 Zielsetzung von Exportproduktionszonen
- 2.3.3 Diskussion: Wohlfahrtsgewinne durch Exportproduktionszonen?
- 2.3.4 Linkages und spillover effects in der Diskussion um Exportproduktionszonen
- 2.3.5 Voraussetzungen für die Entstehung von Rückkopplungs- und Ausstrahlungseffekten
- 2.3.6 Kontroverse Diskussion
- 2.4 Synthese aus Theorien und empirischen Modellen und Kriterien für die eigene empirische Forschung
- 3. Die Bekleidungsindustrie in Haiti und der Dominikanischen Republik
- 3.1 Bekleidungs- und Textilindustrie in globalen Warenketten
- 3.1.1 Entwicklung der internationalen Arbeitsteilung und räumliche Verlagerung in der Textilindustrie
- 3.1.2 Die Warenkette in der Bekleidungsindustrie
- 3.1.3 Mögliche industrielle Entwicklung in der Bekleidungsindustrie
- 3.2 Handelsabkommen zur Förderung der exportorientierten Textilindustrie im Karibischen Raum – Schaffung von neuen regionalen Integrationsräumen
- 3.3 Die Fertigungsindustrie in den Exportproduktionszonen in der Dominikanischen Republik und Haiti
- 3.3.1 Exportproduktionszonen in der Dominikanischen Republik: Herausforderungen und Umstrukturierung
- 3.3.2 Exportproduktionszonen in Haiti: am unteren Ende der Warenkette
- 3.4 Zwischenresümee
- 4. Der regionale Kontext: Haiti und die Dominikanische Republik und ihre gemeinsame Grenzregion
- 4.1 Sozial- und wirtschaftsräumliche Disparitäten zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik und innerhalb der Länder
- 4.1.1 Disparitäten in der sozialen Entwicklung
- 4.1.2 Disparitäten in der wirtschaftlichen Entwicklung
- 4.1.3 Disparitäten im Raumgefüge
- 4.2 Gründe der Entwicklung von regionalen Disparitäten, unterschiedliche Industrialisierungspfade
- 4.2.1 Historischer Rückblick auf eine ungleiche Entwicklung
- 4.2.2 Von der Import-Substitution zur Exportorientierung
- 4.3 Die Rahmenbedingungen für Wirtschaftswachstum und Entwicklung
- 4.4 Untersuchungsraum Ouanaminthe/Dajabon
- 4.4.1 Methodische Vorgehensweise
- 4.4.2 Der Grenzraum in der geographischen Diskussion
- 4.4.3 Die Grenzregion Ouanaminte/Dajabon
- 4.4.4 Wirtschaftliche und soziale Aktivitäten im Grenzraum Ouanaminthe und Dajabon und soziokultureller Kontext
- 5. Die Exportproduktionszone in Ouanaminthe
- 5.1 Vergünstigungen für Unternehmen in den Exportproduktionszonen
- 5.2 Ortsbegehung: CODEVI
- 5.3 Das niedergelassene Unternehmen: CODEVI/Grupo M
- 5.3.1 Industrietyp und Produktionssystem von Grupo M
- 5.3.2 CODEVI als Ergebnis von Auslagerungsprozessen
- 5.3.3 CODEVI als Teil von Entwicklungsstrategien
- 5.4 Auswirkungen der Implementierung der EPZ auf den Sozialraum Ouanaminthe/Dajabon
- 5.4.1 Konflikte vor der Implementierung der EPZ
- 5.4.2 Arbeitnehmerrechte und gewerkschaftliche Aktivitäten
- 5.4.3 Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen der Exportproduktionszone
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob die Integration Haitis in globale Warenketten durch Exportproduktionszonen (EPZs) zur Überwindung regionaler Disparitäten beiträgt. Der Fokus liegt auf der EPZ in Ouanaminthe/Haiti und deren Einfluss auf den nordhaitianischen Sozialraum. Die Arbeit analysiert die Rolle der EPZ im Kontext globaler Produktionsnetzwerke und untersucht, unter welchen Bedingungen solche Zonen zu nachhaltiger Entwicklung beitragen können.
- Regionale Disparitäten zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik
- Rolle von EPZs in der globalen Warenkette der Bekleidungsindustrie
- Auswirkungen der EPZ Ouanaminthe auf den lokalen Sozialraum
- Linkages und Spillover-Effekte von EPZs
- Handelsabkommen und deren Einfluss auf regionale Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Einführung in das Thema und Forschungsstand: Die Einleitung skizziert den Kontext des globalisierten Welthandels und die damit verbundene Reorganisation globaler Produktionsprozesse. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Überwindbarkeit regionaler Disparitäten durch Integration in globale Warenketten heraus und beschreibt den bisherigen Forschungsstand zu diesem Thema, wobei kritische Auseinandersetzungen mit den Auswirkungen von Exportproduktionszonen (EPZs) im Vordergrund stehen. Der Aufbau der Arbeit wird kurz erläutert.
2. Der theoretische Bezugsrahmen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene theoretische Ansätze zur Analyse der Forschungsfrage, darunter Netzwerkperspektiven (Global Commodity Chain, Global Production Network), Entwicklungs- und Wachstumstheorien (Gleichgewichts- und Polarisationstheorien, Neue Endogene Wachstumstheorie) sowie die wissenschaftliche Diskussion um den Impact von EPZs. Es werden Kriterien für die empirische Forschung abgeleitet.
3. Die Bekleidungsindustrie in Haiti und der Dominikanischen Republik: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Bekleidungsindustrie in globalen Warenketten, die Entwicklung der internationalen Arbeitsteilung und die räumliche Verlagerung von Produktionsschritten. Es beleuchtet verschiedene Handelsabkommen (CBI, NAFTA, DR-CAFTA, HOPE Act) und deren Einfluss auf die Textil- und Bekleidungsindustrie in Haiti und der Dominikanischen Republik, sowie die Herausforderungen und Umstrukturierungen in der dominikanischen und haitianischen EPZ-Landschaft.
4. Der regionale Kontext: Haiti und die Dominikanische Republik und ihre gemeinsame Grenzregion: Das Kapitel beschreibt die sozioökonomischen Disparitäten zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik und innerhalb der Länder. Es analysiert die historischen Gründe für diese ungleiche Entwicklung, die unterschiedlichen Industrialisierungspfade und die Rahmenbedingungen für Wirtschaftswachstum. Der Fokus liegt auf dem Untersuchungsraum Ouanaminthe/Dajabón, der methodischen Vorgehensweise und den Besonderheiten von Grenzregionen.
5. Die Exportproduktionszone in Ouanaminthe: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die EPZ in Ouanaminthe, die Vergünstigungen für Unternehmen, die Ortsbegehung und das Unternehmen CODEVI/Grupo M. Es analysiert CODEVI als Ergebnis von Auslagerungsprozessen, dessen Rolle in Entwicklungsstrategien und die Auswirkungen der EPZ auf den Sozialraum, inklusive Konflikten, Arbeitnehmerrechten und wirtschaftlichen sowie sozialen Auswirkungen.
Schlüsselwörter
Regionale Disparitäten, globale Warenketten, Exportproduktionszonen (EPZ), Haiti, Dominikanische Republik, Bekleidungsindustrie, Global Commodity Chain, Global Production Network, Handelsabkommen (CBI, DR-CAFTA, HOPE Act), industrielle Entwicklung, Spillover-Effekte, Linkages, soziale Auswirkungen, Arbeitnehmerrechte, Nachhaltige Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Regionale Disparitäten und Exportproduktionszonen in Haiti und der Dominikanischen Republik
Was ist der Gegenstand der Forschungsarbeit?
Die Arbeit untersucht, ob die Integration Haitis in globale Warenketten durch Exportproduktionszonen (EPZs) zur Überwindung regionaler Disparitäten beiträgt. Der Fokus liegt dabei auf der EPZ in Ouanaminthe/Haiti und deren Einfluss auf den umliegenden Sozialraum.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Netzwerkperspektiven (Global Commodity Chain, Global Production Network), Entwicklungs- und Wachstumstheorien (Gleichgewichts- und Polarisationstheorien, Neue Endogene Wachstumstheorie) sowie die wissenschaftliche Diskussion um den Impact von EPZs. Es wird eine Synthese aus verschiedenen Theorien und empirischen Modellen gebildet, um Kriterien für die eigene empirische Forschung abzuleiten.
Welche Rolle spielt die Bekleidungsindustrie?
Die Bekleidungsindustrie dient als Fallbeispiel, um die Integration in globale Warenketten und die räumliche Verlagerung von Produktionsschritten zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Handelsabkommen (CBI, NAFTA, DR-CAFTA, HOPE Act) und deren Einfluss auf die Textil- und Bekleidungsindustrie in Haiti und der Dominikanischen Republik.
Welche regionalen Disparitäten werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die sozioökonomischen Disparitäten zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik und innerhalb der Länder. Es werden die historischen Gründe für diese ungleiche Entwicklung und die unterschiedlichen Industrialisierungspfade untersucht.
Welche Bedeutung hat die Grenzregion Ouanaminthe/Dajabón?
Die Grenzregion Ouanaminthe/Dajabón ist der Untersuchungsraum der Arbeit. Die Besonderheiten von Grenzregionen, die methodische Vorgehensweise und die wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten in diesem Raum werden detailliert analysiert.
Welche Rolle spielt die EPZ in Ouanaminthe?
Die Arbeit untersucht die EPZ in Ouanaminthe im Detail, inklusive der Vergünstigungen für Unternehmen, einer Ortsbegehung bei CODEVI/Grupo M und einer Analyse der Auswirkungen auf den Sozialraum. Dies beinhaltet die Betrachtung von Konflikten, Arbeitnehmerrechten und den wirtschaftlichen sowie sozialen Folgen.
Welche zentralen Fragestellungen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die folgenden Fragestellungen: Beitrag von EPZs zur Überwindung regionaler Disparitäten, Rolle von EPZs in globalen Warenketten, Auswirkungen der EPZ Ouanaminthe auf den lokalen Sozialraum, Linkages und Spillover-Effekte von EPZs und Einfluss von Handelsabkommen auf die regionale Entwicklung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Regionale Disparitäten, globale Warenketten, Exportproduktionszonen (EPZ), Haiti, Dominikanische Republik, Bekleidungsindustrie, Global Commodity Chain, Global Production Network, Handelsabkommen (CBI, DR-CAFTA, HOPE Act), industrielle Entwicklung, Spillover-Effekte, Linkages, soziale Auswirkungen, Arbeitnehmerrechte, nachhaltige Entwicklung.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretischer Bezugsrahmen, Bekleidungsindustrie in Haiti und der Dominikanischen Republik, Regionaler Kontext und Exportproduktionszone in Ouanaminthe.
- Citation du texte
- Christine Scherzinger (Auteur), 2008, Lassen sich regionale Disparitäten durch die Integration in globale Warenketten überwinden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203670