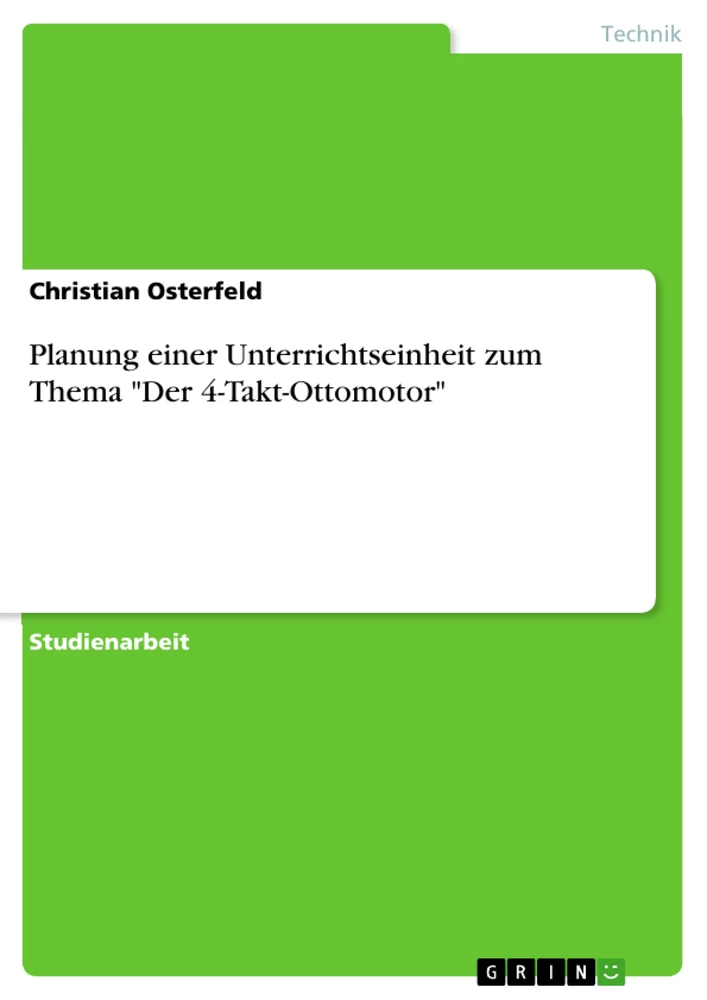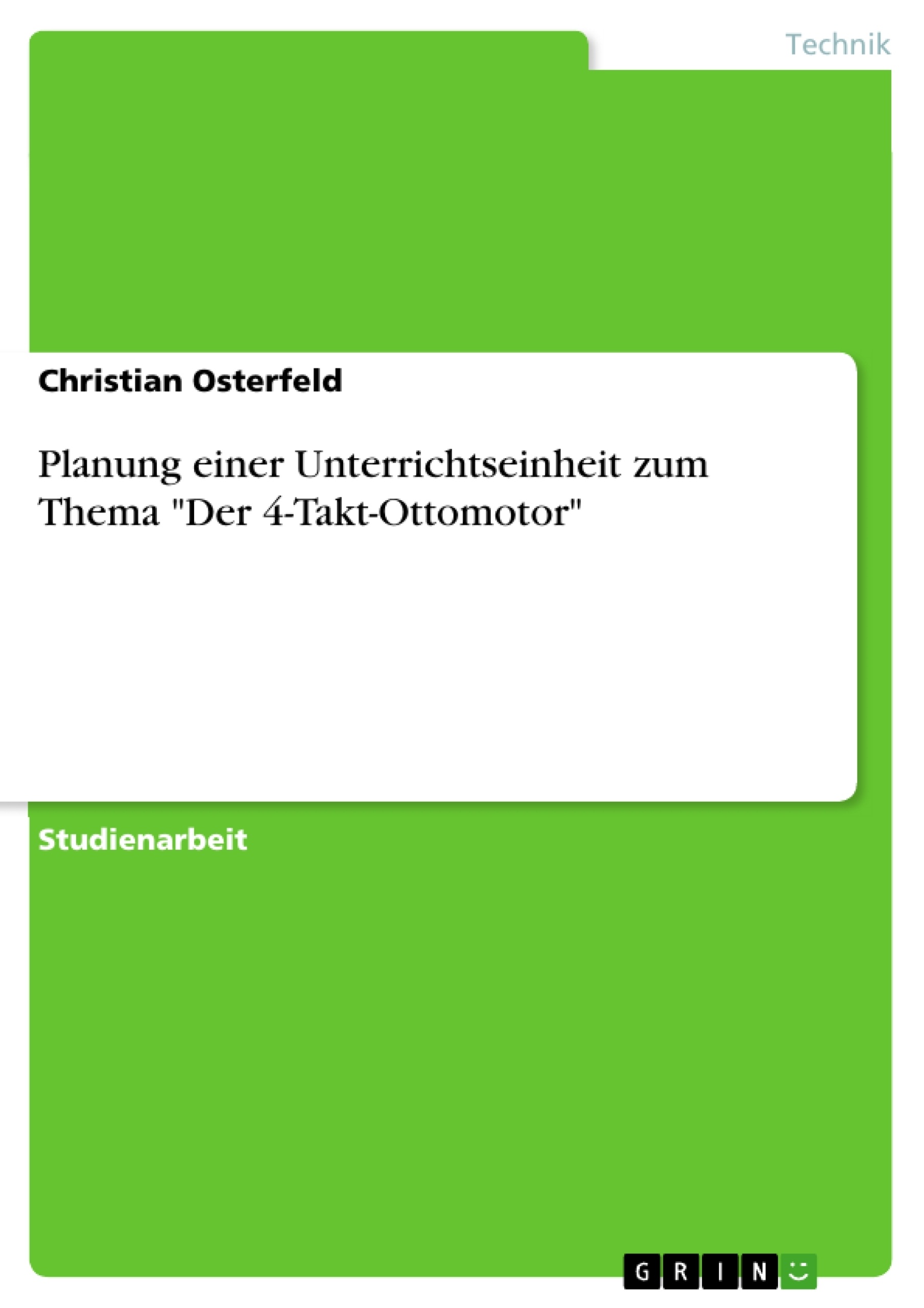Die vorliegende Arbeit entstand nach der Unterrichtssequenz zum Ottomotor und dessen Aufbau in einer 8. Klasse Realschule. Die dreistündige Unterrichtssequenz macht einen Teil der gesamten Unterrichtseinheit zu Kraftmaschinen aus, die auch den eventuellen späteren beruflichen Weg der SchülerInnen in Form von Werksbesichtigung usw. nicht ausspart, ebenso wenig wie neue Techniken und Umweltschutz/-probleme durch den Verkehr.
Nachfolgende Ausarbeitung bezieht sich hauptsächlich und ausführlich auf den Bereich des Ottomotors und seine didaktische Umsetzung im Unterricht in Form einer Fertigungs-/Konstruktionsaufgabe.
Ausschnitt aus Kap. 2:
2. Sachanalyse
2.1. Aufbau eines Zylinders und Zusammenspiel wichtiger Bauteile
Abbildung 1 zeigt die wichtigsten Bauteile eines Ottomotors, deren Funktion und Zusammenspiel in der Unterrichtseinheit vergegenwärtigt werden sollen. Die wichtigsten Zusammenhänge sollen beschrieben werden:
Der Kolben läuft im Zylinder auf und ab, dabei sorgen die Kolbenringe für eine Abdichtung zur Zylinderwand hin. Beim Auf- und Abgleiten des Kolbens im Zylinder erreicht der Kolben in seinen Endlagen abwechselnd den oberen Totpunkt (OT) und den unteren Totpunkt (UT). Das Pleuel ist unten im Kolben befestigt und verbindet den Kolben mit der Kurbelwelle. Es setzt die lineare Auf- und Ab-Bewegung des Kolbens in die Drehbewegung der Kurbelwelle um. Diese leitet die Drehbewegung über das Schwungrad als Antriebskraft an das Getriebe weiter und ist über eine Steuerkette mit einem oder zwei Steuerrädern oberhalb des Zylinders verbunden. Die Steuerräder treiben die Nockenwelle an, die oberhalb des Zylinderkopfs die Ein- und Auslassventile betätigen. Pro Drehung schließen bzw. öffnen die Nocken die Ventile ein Mal. Das Einlassventil ist für frisches Kraftstoff-Luft-Gemisch zuständig, durch das Auslassventil können die Verbrennungsabgase aus dem Zylinder abgeführt werden. Der Kompressionsraum/Verbrennungsraum ist der Zylinderraum oberhalb des Kolbens, der immer frei bleibt. Die Zündkerze zündet das komprimierte Gemisch durch Funken. Die bei der Explosion entstehende Kraft wird über die Pleuelstange auf die Kurbelwelle übertragen.
Die Aufeinanderfolge von Ansaugen, Verdichten, Verbrennen (Arbeiten) und Ausstoßen nennt man das Arbeitsspiel oder den Motorzyklus. Dieser Vorgang kann sich in vier Kolbenhüben (= zwei Kurbelwellenumdrehungen) abspielen; dann spricht man vom Viertaktverfahren, das im nächsten Abschnitt genau beschrieben wird.
Inhaltsverzeichnis
1. Anthropogene Voraussetzungen
2. Sachanalyse
2.1. Aufbau eines Zylinders und Zusammenspiel wichtiger Bauteile
2.2. Die vier Takte
2.3. Arbeitsdiagramm
2.4. Die Ventilsteuerung
3. Didaktische Analyse
3.1. Richtungen und Ansätze der Technikdidaktik
3.1.1 Der allgemeintechnologische Ansatz (AtA)
3.1.2 Der arbeitsorientierte Ansatz (AoA)
3.1.3 Der mehrperspektivische Ansatz (MpA)
3.2. Bildungsplanbezug und Richtziele
3.2.1 Die Handlungsperspektive
3.2.2 Die Kenntnis- und Strukturperspektive
3.2.3 Die vorberufliche Orientierungsperspektive
3.3. Kompetenzerwerb
3.3.1 Fachkompetenz
3.3.2 Methodenkompetenz
3.3.3 Personale Kompetenz
3.3.4 Soziale Kompetenz
3.4. Die didaktische Analyse nach Klafki
3.4.1 Exemplarische Bedeutung
3.4.2 Gegenwartsbedeutung
3.4.3 Zukunftsbedeutung
3.4.4 Struktur des Inhalts
3.4.5 Zugänglichkeit
4. Methodische Überlegungen
4.1. Möglichkeiten der Methoden
4.2. Die Fertigungsaufgabe
4.2.1 Planungsphase
4.2.2 Ausführungsphase
4.2.3 Auswertung- und Bewertungsphase
5. Planung der Einheit
5.1. Unterrichtsabschnitt 1: Erarbeitung technischer Funktionszusammenhänge (ca. 2-3 Std.)
5.2. Abschnitt 2: Fertigungsaufgabe à ca. 7Std
5.3. Abschnitt 3: Erkunden der Verwendungszusammenhänge (Betriebserkundung)
6. Medien in der Unterrichtseinheit
6.1. Realmodell als Präsentationsmedium
6.2. Tafel und Tageslichtprojektor
6.3. Visuell-auditives Medium (Beamer)
6.4. Arbeitsblätter und Schulbuch
7. Fazit und Reflexion:
8. Abbildungsverzeichnis
9. Literaturverzeichnis
9.1. Primärliteratur
9.2. Zeitschriften
9.3. Internet-Quellen
10. Anhang
10.1. Mindmap der Unterrichtseinheit
10.2. Arbeitsauftrag zur Fertigungsaufgabe
10.3. Fotos von möglichen Schülermodellen
10.4. Ansichtsmodelle für die Schüler mit Kunststoffzylindern
10.5. Arbeitsblätter (mit Lösungen)
Vorbemerkung
Diese Unterrichtseinheit soll als Anschlusseinheit an bereits zuvor durchgenommene weitere Themenkomplexe für eine 8. Klasse Realschule gesehen werden, das heißt, die Schülerinnen und Schüler[1] haben bereits Kenntnisse zu den Bereichen „Geschichte des Automobils“, von „Dieselmotoren und Zweitaktern“ sowie „Umwelteinflüssen“ (implizit alternative Antriebssysteme und Kraftstoffe, Umweltbelastungsproblematiken), welche vorausgesetzt werden. Dies zur Verdeutlichung, wenn in den Ausführungen nach Klafki später von „Mofa/Moped“ gesprochen wird, diese Fahrzeuge natürlich nicht mit 4-Takt-Ottomotoren bewegt werden.
Die im Anhang angefügte Übersicht des Gesamtthemengebietes zeigt die Gebiete, die Gegenstand der nachfolgenden Unterrichtseinheit sind, in roter Schrift. Ebenso sind dort Arbeitsblätter, die in dieser Einheit verwendet werden, zu finden.
1. Anthropogene Voraussetzungen
Es ist davon auszugehen, dass in der Methodenkompetenz zum Ende der 8. Klasse hin noch einige Defizite zu erkennen sein werden, da sie bislang nicht viel mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet haben. Deshalb möchte ich, dass die SuS in Zweier-Teams arbeiten, in denen sie weitgehend auf sich selbst gestellt sind, also ohne Einwirken der Lehrkraft. Dies wird die soziale Zusammenarbeit verbessern. Einige der SuS haben bereits mehr Vorwissen im Bereich von Kraftfahrzeugen, da sie selber Mofas o.ä. besitzen oder die Väter in Automobilsektor arbeiten. Daher tendiert das Leistungsniveau stark auseinander. Die SuS mit größerem Vorwissen sollen mit leistungsschwächeren SuSn zusammenarbeiten. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass alle SuS zu Wort kommen. Verschiedene Varianten der möglichen zu fertigenden Funktionsmodelle sollen eine Binnendifferenzierung ermöglichen.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert ein 4-Takt-Ottomotor?
Der Motor arbeitet in vier Phasen: Ansaugen, Verdichten, Arbeiten (Verbrennen) und Ausstoßen, verteilt auf zwei Kurbelwellenumdrehungen.
Was ist die Aufgabe des Kolbens im Zylinder?
Der Kolben bewegt sich zwischen dem oberen und unteren Totpunkt auf und ab und überträgt die Explosionskraft über das Pleuel auf die Kurbelwelle.
Welche Rolle spielen die Ventile bei der Motorsteuerung?
Das Einlassventil lässt das Kraftstoff-Luft-Gemisch ein, während das Auslassventil die verbrannten Abgase aus dem Zylinder leitet.
Was versteht man unter dem „Arbeitsspiel“?
Das Arbeitsspiel umfasst den kompletten Zyklus aller vier Takte, nach dem der Prozess von vorne beginnt.
Wie wird das Thema im Technikunterricht vermittelt?
Durch eine Kombination aus Sachanalyse, didaktischer Reduktion nach Klafki und praktischen Fertigungsaufgaben, bei denen Schüler Funktionsmodelle bauen.
- Citar trabajo
- Christian Osterfeld (Autor), 2012, Planung einer Unterrichtseinheit zum Thema "Der 4-Takt-Ottomotor", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203716