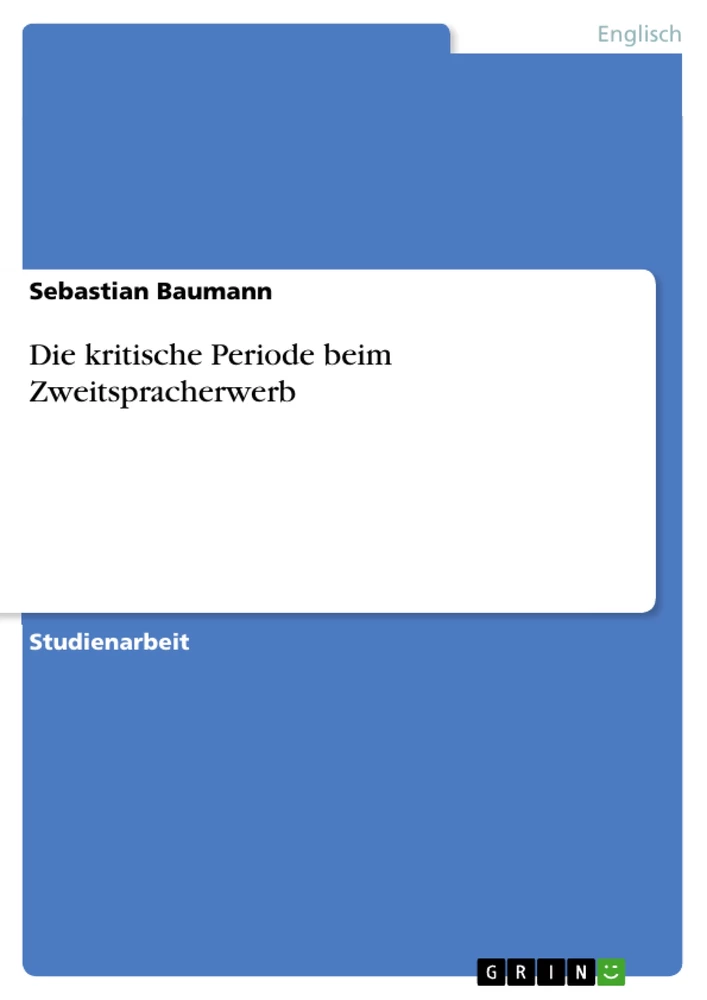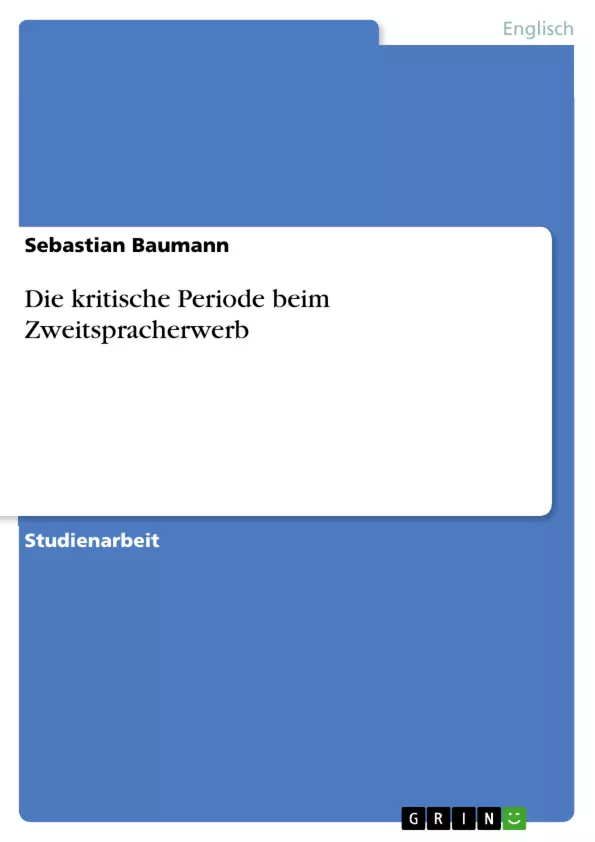Die Hypothese der kritischen Periode im Spracherwerb wurde in den letzten 45 Jahren umfassend diskutiert. Sie geht zurück auf Penfield und Roberts (1959), wurde von dem Linguisten und Neurologen Eric Lenneberg (1967) aufgegriffen und besagt, dass der Erstspracherwerb nur innerhalb eines gewissen Zeitraums, welcher von der frühen Kindheit bis zur Pubertät reicht, möglich sei bzw. zu einem Muttersprachlerniveau führt. Zahlreiche Studien haben sich diesem Thema vor allem im Bereich des Zweitspracherwerbs gewidmet und dabei sehr kontroverse Ergebnisse geliefert, die entweder für oder gegen die Hypothese der kritischen Periode sprechen.
Trotz dieser Widersprüche stellt die Untersuchung der kritischen Periode im Zweitspracherwerb noch immer ein interessantes Thema in der Forschung dar und greift entweder Aspekte bereits durchgeführter Studien auf oder setzt neue Schwerpunkte in der Forschungsmethodik. Doch nicht nur in der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch im Bereich der schulischen (und außerschulischen) Sprachausbildung besteht großes Interesse an Ergebnissen zum Einfluss des Spracherwerbsalters, um zum Beispiel Hinweise darauf zu erhalten, wo der geeignete Zeitpunkt zum Beginn des Sprachunterrichts liegt und in welcher Art und Weise ein späterer Spracherwerb die Gesamtperformanz beeinflusst. Ferner besteht politisches Interesse, da Auskunft darüber gesucht wird, wann Immigrantenkinder mit einer Fremdsprache konfrontiert werden sollten.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob es einen abrupten Grenzwert („Cut-Off Point“) gemäß der Hypothese der kritischen Periode gibt, nach der der Zweitspracherwerb stark beeinträchtigt ist, oder ob vielmehr eine kontinuierliche graduelle Abnahme der Sprachperformanz mit zunehmend späterem Beginn des Spracherwerbs einhergeht. Im Zuge dessen erfolgt an erster Stelle eine detaillierte, chronologische Darstellung vier ausgewählter, im Kontext der kritischen Periode häufig zitierter Studien. Diese werden jeweils im Bezug auf die untersuchten Teilnehmer, das methodische Vorgehen und ihre Forschungsergebnisse präsentiert. In einem nächsten Schritt sollen jene Studien einander gegenübergestellt und dabei ihr Forschungsdesign und ihre Methodik kritisch analysiert und verglichen werden, um letztlich die oben formulierte Kernfrage dieser Arbeit exemplarisch zu diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Bisherige Studien zur kritischen Periode
2.1 Johnson und Newport (1989)
2.1.1 Teilnehmer
2.1.2 Vorgehen
2.1.3 Ergebnisse
2.2 Flege, Munro und MacKay (1995)
2.2.1 Teilnehmer
2.2.2 Vorgehen
2.2.3 Ergebnisse
2.3 DeKeyser (2000)
2.3.1 Teilnehmer
2.3.2 Vorgehen
2.3.3 Ergebnisse
2.4 Hakuta, Bialystok und Wiley (2003)
2.4.1 Teilnehmer
2.4.2 Vorgehen
2.4.3 Ergebnisse
2.5 Zusammenfassung
3 Diskussion
4 Zusammenfassung/Fazit
Literaturverzeichnis
- Citar trabajo
- Sebastian Baumann (Autor), 2011, Die kritische Periode beim Zweitspracherwerb, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203724