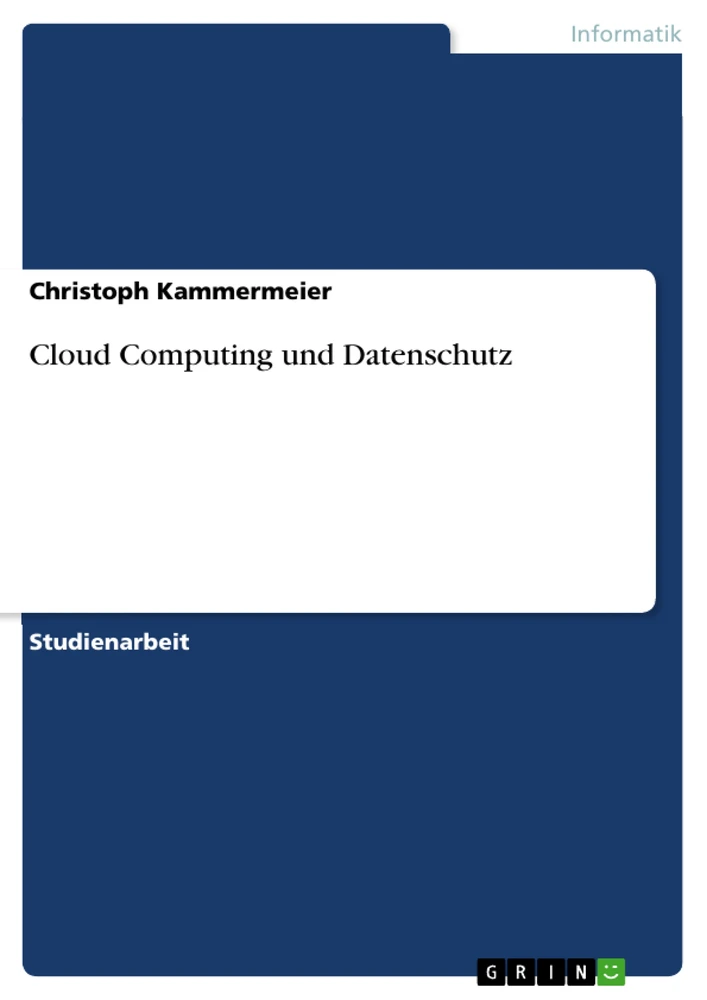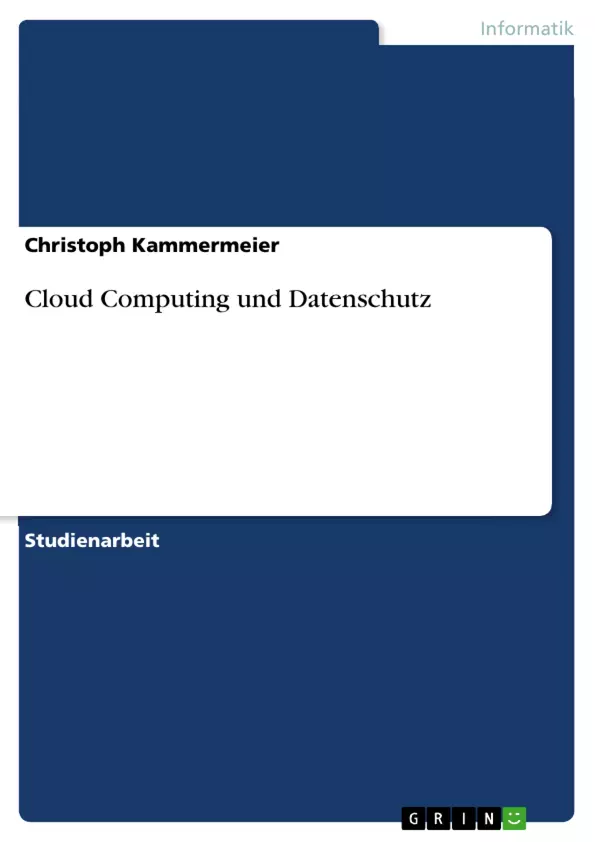Gerade weil der Begriff Cloud Computing sich derzeit im Vormarsch und aller Munde befindet, behandle ich in dieser Hausarbeit dieses Thema. Im ersten Teil wird der Begriff erklärt und die verschiedenen Arten von Clouds erörtert. Anschließend werden die technischen Konzepte geschildert. Im zweiten Teil wird auf das Thema Datenschutz genauer eingegangen, schwerpunktmäßig mit den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes und dessen Schwierigkeiten im Ausland. Im vierten und fünften Kapitel werden die Vorteile/Chancen bzw. die Nachteile/Gefahren von Cloud Computing behandelt. Abschließend ziehe ich mein Fazit und fasse die Arbeit kurz zusammen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Cloud Computing
2.1 Begriffserklärung
2.2 Arten von Clouds
2.2.1 Public Cloud
2.2.2 Private Cloud
2.2.3 Hybrid Cloud
2.2.4 Weitere Arten
2.3 Technische Konzepte
2.3.1 Infrastructure as a Service
2.3.2 Platform as a Service
2.3.3 Software as a Service
2.3.4 weitere Architekturen
3. Datenschutz
3.1 Risiken mit Datensicherheit
3.2 Anforderungen an den Datenschutz (BDSG)
3.2.1 Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung (ADV)
3.2.2 Datenübermittlung außerhalb der EU/EWR, speziell USA
4. Vorteile/Chancen von Cloud Computing
5. Nachteile/Gefahren von Cloud Computing
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
8. Abbildungsverzeichnis
- Quote paper
- Christoph Kammermeier (Author), 2020, Cloud Computing und Datenschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/998135