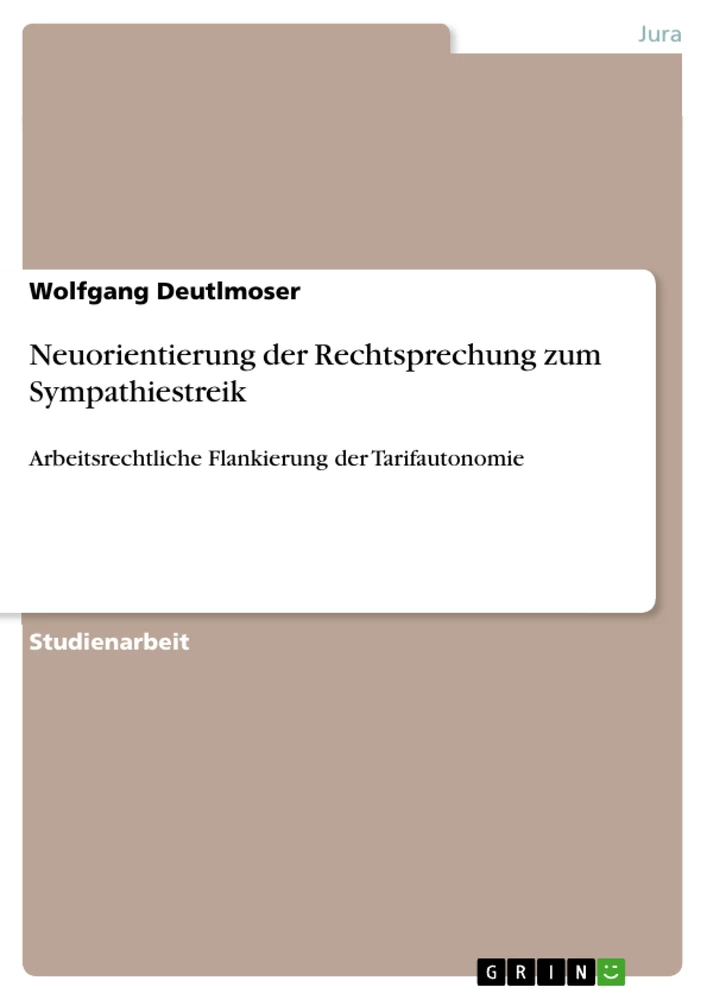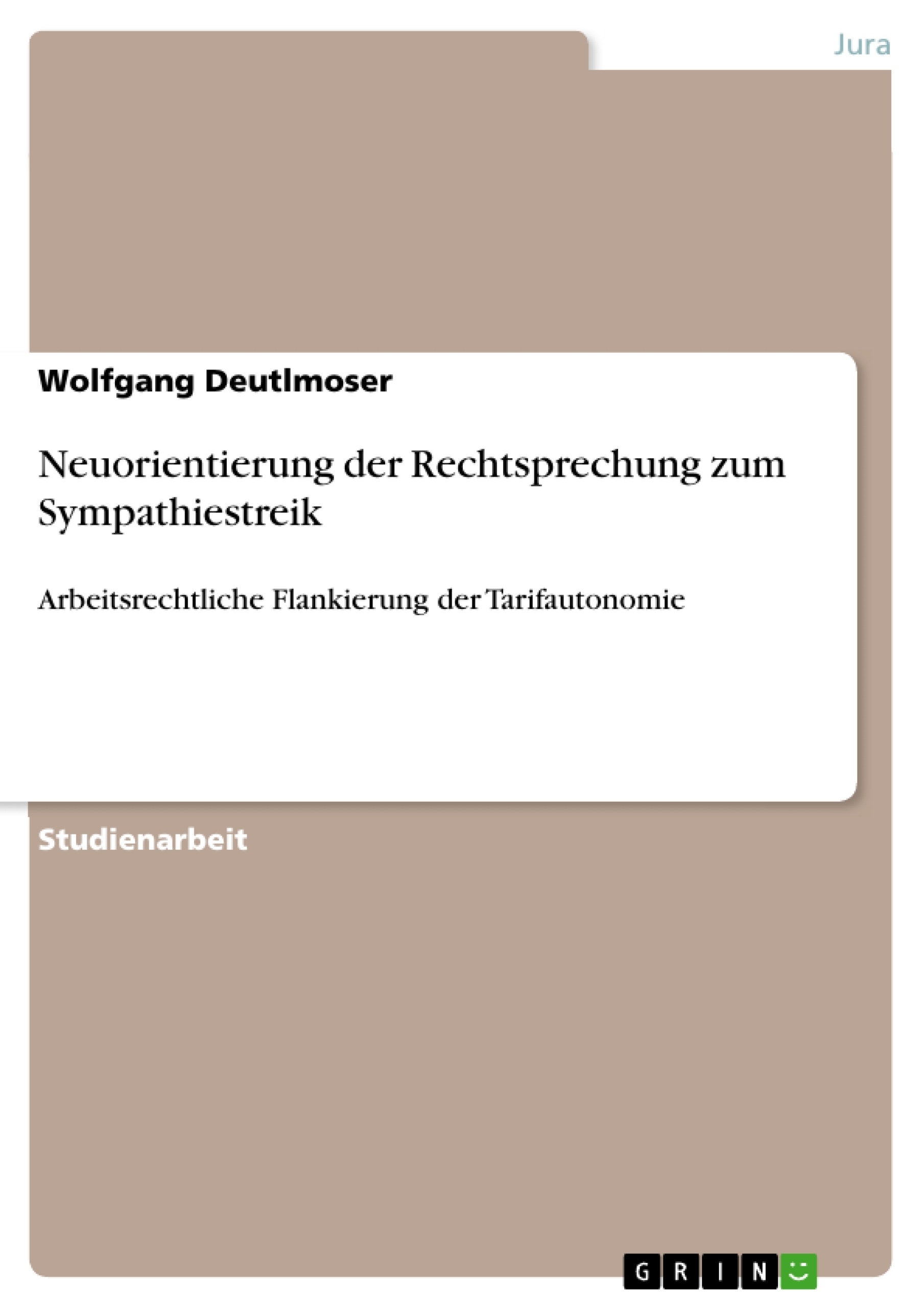Im Rahmen dieser Darstellung wird erörtert, wie sich die Rechtslage von Unterstützungsstreiks durch die neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts verändert hat.
Dabei wird zunächst herausgearbeitet, dass das Streikrecht nur innerhalb des Grundrechts auf Koalitionsfreiheit gewährt ist. Außerdem, dass sich die Zulässigkeit von Streikunterstützung durch Dritte im Rahmen der grundgesetzlichen Güterabwägung letztlich dort entscheidet, wo die Rechtsordnung das arbeitnehmerseitige Unterstützungsinteresse gegenüber dem Schutzinteresse des Unternehmers überwiegen lässt.
Vor diesem Hintergrund wird die bisherige Position des Bundesarbeitsgerichts verdeutlicht, die Unterstützungsstreiks als grundsätzlich unzulässig einstufte und gewärtigte, dass das Streikrecht im Rahmen des Art. 9 Abs. 3 GG nur als notwendiges Übel einer funktionsfähigen Tarifautonomie geschützt war.
Abschließend wird die Neuorientierung der Rechtsprechung zum Unterstützungsstreik beleuchtet, mit der das Bundesarbeitsgericht die bisher von ihm gesehene Regel der grundsätzlichen Unzulässigkeit in die grundsätzliche Zulässigkeit von Unterstützungsstreiks verwandelte - dies unter der neuen Prämisse, dass Streiks generell unter die von Art. 9 III GG geschützte Betätigungsfreiheit der Koalitionen zu subsumieren seien.
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
A. Einleitung
B. Die Rechtslage von Unterstützungsstreiks
I. Die Rechtsgrundlagen des Streikrechts
1. Art. 9 III GG
2. Höchstrichterliche Grundsätze
3. Zwischenergebnis
II. Die alte Rechtslage von Unterstützungsstreiks
1. Abgrenzung in begrifflicher Hinsicht
2. Abgrenzung in rechtlicher Hinsicht
a. Kriterien
b. Konsequenzen
(1) Identität der Kampfsubjekte/ -objekte
(2) Beteiligung von Außenseitern
(3) Zwischenergebnis
c. Komplemente
(1) Boykott
(2) Verweigerung von Streikarbeit
(3) Demonstrationsstreik
(4) Zwischenergebnis
3. Resümee der Rechtsprechung
a. Grundsatz der Unzulässigkeit
b. Ausnahmetatbestände
c. Zwischenergebnis
4. Resümee der Rechtsliteratur
a. Kritik grundsätzlicher Art
(1) Erfüllbarkeit der Streikforderung
(2) Tarifbezug des Unterstützungsstreiks
(3) Grundsatz der Parität
(4) Drittbetroffenheit
(5) Zwischenergebnis
b. Kritik der Ausnahmetatbestände
(1) Fehlendes Bedürfnis für Ausnahmen
(2) Fremdnützige Neutralitätsverletzung
(3) Eigennützige Neutralitätsverletzung
(4) Arbeitgeberidentität
(5) Grenze der Ausnahmetatbestände
(6) Zwischenergebnis
III. Die neue Rechtslage von Unterstützungsstreiks
1. Entscheidung
2. Sachverhalt
3. Begründung
a. Art. 9 III GG
b. Rechtmäßigkeit
(1) Friedenspflicht
(2) Grundsatz der Parität
(3) Verhältnismäßigkeit
4. Zwischenergebnis
C. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungen zum Seminarvortrag
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Neuorientierung der Rechtsprechung zum Unterstützungsstreik [1]
A. Einleitung
Nachdem das Bundesarbeitsgericht einen von Arbeitnehmern durchgeführten Unterstützungsstreik kürzlich als rechtmäßig beurteilt hat,[2] unterstellte die Seite der Arbeitgeber dem Gericht in einer Pressemitteilung, dass es das überkommene Arbeitskampfrecht mit diesem Urteil grundlegend in Gefahr bringen würde.[3]
Abgesehen davon, dass es sich dabei um eine medienwirksame, politische Zuspitzung handeln dürfte, transportiert die getroffene Aussage inhaltlich eine relativ steile These, die in sachlicher Hinsicht zumindest die Frage aufwirft, inwieweit das Bundesarbeitsgericht die Rechtslage von Unterstützungsstreiks durch diese Entscheidung tatsächlich verändert hat. Dies soll hier anhand der zur Thematik vorliegenden Rechtsprechung und Literatur genauer untersucht werden, um die Fragestellung schließlich beantworten zu können.
Folgendermaßen ist das Vorgehen: erst wird die Rechtslage von Streiks grundsätzlich erörtert, dann der Rechtsstand der Sonderform des Unterstützungsstreiks; und zwar zunächst dessen bisherige Beurteilung, anschließend zum Vergleich die neuorientierte Rechtsauffassung des Bundesarbeitsgerichts.
B. Die Rechtslage von Unterstützungsstreiks
I. Die Rechtsgrundlagen des Streikrechts
Das Streikrecht ergibt sich im Kern aus dem Grundrecht der Koalitionsfreiheit gemäß Art. 9 III GG und außerdem aus den allgemeinen Grundsätzen, anhand derer die höchstrichterliche, bundesgerichtliche Rechtsprechung das Streikrecht im Einzelfall konkretisiert hat.
1. Art. 9 III GG
Im Unterschied zur Weimarer Reichsverfassung war im Entwurf des GG zwar ursprünglich ein Streikrecht vorgesehen, allerdings verlangte die SPD dessen Streichung wegen der von der CDU geforderten Ausnahmen vom Streikrecht und, um eine Kasuistik der Beschränkungen zu verhindern.[4]
Vermutlich wegen den mächtigen, politischen Gegensätzen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden hat das Streikrecht deshalb auch danach und bis heute keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage mehr erhalten.[5]
Die Koalitionsfreiheit, die Art. 9 III GG gewährt, gilt daher seit jeher als zentrale Norm des Streikrechts. Allerdings nimmt sie vom Wortlaut her in keiner Weise Bezug auf irgendeine Form des (Unterstützungs-) Streiks.[6] Auch Art. 9 III S.3 GG enthält nach wohl h.M. kein solches Grundrecht auf Streik. Dieser Absatz sichert lediglich die Arbeitskampffreiheit im Notstandsfall.
2. Höchstrichterliche Grundsätze
Das Arbeitskampfrecht ist daher (fast) ausschließlich durch verschiedene höchstrichterliche Grundsätze bestimmt. Der Richter ist der eigentliche Herr über das Schicksal des Arbeitskampfrechts.[7] Hat das BAG einmal gesprochen, wirkt sein Urteil so, als hätte der Gesetzgeber selbst gesprochen.[8]
Sowohl das BAG als auch das BVerfG hielten sich mit einer Einlassung in Bezug auf die in Art. 9 III GG enthaltene verfassungsrechtliche Garantie des Streikrechts jedoch ziemlich lange zurück.[9] Hier stimmt die Metapher, Recht ist Rechtsprechung; aber das Wort sagt mehr, und sagt es richtig: Recht wird gesprochen, ohne Rechtsprechung kein Recht.[10]
Bis 1980 musste gewartet werden, ehe das BAG das Streikrecht als einen notwendigen Bestandteil einer freiheitlichen Ausgleichsordnung darstellte, die durch Art. 9 III GG im Kern gewährleistet sei.[11] Das BVerfG erklärte sich sogar noch später. Erst 1991, mehr als vierzig Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes, entschloss es sich, den Schutz dieses Arbeitskampf-mittels in den Dienst einer nicht bloß funktionsfähigen, sondern funktionierenden Tarifautonomie zu stellen:[12]
„[Die Tarifautonomie ist darauf angelegt,] die strukturelle Unterlegenheit der einzelnen Arbeitnehmer beim Abschluss von Arbeitsverträgen durch kollektives Handeln auszugleichen und damit ein annähernd gleichgewichtiges Aushandeln der Löhne und Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Soweit Arbeitskämpfe zu einem Ungleichgewicht führen, wird die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie beeinträchtigt.“[13]
Zwar setzte das BVerfG in diesem Urteil nicht die formale Gleichbehandlung des Streikrechts voraus, aber immerhin wollte es das Streikrecht verfassungsrechtlich garantiert sehen, weil es dieses Recht logisch voraussetzte: die damals verhandelte Abwehraussperrung ergibt nämlich nur dann Sinn, wenn auch das dazugehörige Angriffsmittel Streik geschützt werden würde.[14]
3. Zwischenergebnis
Auch die h.M. in der Literatur folgt heute der Auffassung, das Streikrecht allein auf den tariflichen Bereich zu beziehen. Im Rahmen dieser Auffassung werden Streiks also als Hilfsmittel der Tarifautonomie verstanden, das Gewerkschaften dazu einsetzen können, die strukturelle Überlegenheit des Arbeitgeberlagers zu überwinden.
Streiks sind demnach nur dann zulässig, wenn sie sich auch auf den Abschluss eines Tarifvertrags richten.[15] Insbesondere an diesem Merkmal der Tarifbezogenheit müssen sich daher auch Unterstützungsstreiks messen lassen. Selbst, wenn es die von Dieterich befürchteten, aber nicht näher begründeten, Schwierigkeiten bereiten mag.[16]
Wegen der Schäden, die Arbeitsniederlegungen bei dem betroffenen Arbeitgeber wie auch bei der Allgemeinheit verursachen können, verlangt die Rechtsprechung für die Zulässigkeit eines Streiks aber nicht nur, dass dieser um ein tariflich regelbares Ziel geführt wird. Er muss ferner von einer Gewerkschaft getragen werden, die tarifliche Friedenspflicht muss eingehalten werden und der Zeitpunkt sowie die Art der Durchführung dürfen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht verletzen.[17]
II. Alte Rechtslage
Im Folgenden soll daher zunächst die bisherige Rechtslage, d.h. die rechtliche Diskussion des (bis zur jüngsten Entscheidung) einzigen, wesentlichen BAG-Urteils zum Unterstützungsstreik zusammengefasst werden.[18]
Bevor jedoch das Urteil und die wesentliche Kritik daran resümiert wird, soll zunächst noch dargestellt werden, was unter der Bezeichnung des Unterstützungsstreik genau zu verstehen ist.
1. Abgrenzung in begrifflicher Hinsicht
Die deutsche Rechtswissenschaft hat die Form des unterstützenden Streiks bislang weder einheitlich typisiert noch einen einheitlichen Begriff verabredet.[19] Selbst das BAG musste sich so den Vorwurf gefallen lassen, dass die eigene Begriffswahl „etwas weltfremd“ gewesen wäre.[20]
Solange aber von einem wesentlich gleichen Sachverhalt gesprochen wird,[21] bleibt die begriffliche Etikettierung des Unterstützungsstreiks eine (nicht) streitbare Geschmacksfrage. Praktisch kommt es ohnehin oft weniger darauf an, wie der Begriff des Unterstützungsstreiks zu bestimmen ist, sondern wer ihn bestimmen darf: quis iudicabit?[22]
Dass die Subsumtion unter die meistens verwendeten Begriffe „Sympathiestreik“, „Solidaritätsstreik“ oder „Unterstützungsstreik“ nicht immer einheitlich ist, muss ohnehin in Kauf genommen werden.[23] Das Reich der Begriffe ist weitgespannt und vage, jedoch genauso sozial: Juristen sind nicht Sklaven der Wörter, gerade sie sind Herren der Texte.[24]
Kissel beispielsweise versteht unter dem Sympathiestreik mehr als eine schlichte Sympathiebekundung, auf Basis eines mehrfach funktionalen Verständnisses bekommt er sogar den Sympathie- und den Solidaritätsarbeitskampf unter demselben Begriff zu fassen.[25] Gamillscheg gewährt dem Unterstützungsstreik und dem Sympathiestreik dagegen jeweils einen eigenen Gliederungspunkt. Den Solidaritätsstreik unterscheidet er zusätzlich.[26]
2. Abgrenzung in rechtlicher Hinsicht
Damit ein Streik von Arbeitnehmern als Unterstützungsstreik qualifiziert werden kann, müssen die Arbeitnehmer eines anderen Unternehmens ebenfalls streiken. Deren Streik wird dann auch als Ur- oder Primärstreik bezeichnet, mehrheitlich wird er jedoch Hauptstreik genannt.
Für die rechtliche Abgrenzung des unterstützenden Streiks von diesem Hauptstreik fehlt (bislang) ein als herrschende Meinung qualifizierbares Ergebnis.[27] Der Grund dafür könnte allerdings in der bisher recht oberflächlichen Bearbeitung dieses Themenkomplexes liegen.[28]
Selbst das ausführliche Werk von Kissel behandelt die Thematik nur auf 12 von ca. 1000 Seiten. Gar 6 Seiten genügen dem großen Gamillschegg „Arbeitsrecht“.
a. Kriterien
Unter Rückgriff auf das oben entwickelte Kriterium der Tarifbezogenheit wird im Fortgang daher hauptsächlich die von Dietrich gewählte Abgrenzung des Unterstützungsstreiks zu Grunde gelegt. Diese geht auf eine erhellende Beobachtung des BAG zu dem Verhältnis von Sympathie- und Solidaritätsstreiks zurück:
„Dem damals entschiedenen Sympathiestreik und dem hier zu beurteilenden Solidaritätsstreik ist gemeinsam, dass eine Gewerkschaft ihre Mitglieder zu einem Streik aufgerufen hat, um den Arbeitskampf einer anderen Gewerkschaft um den Abschluss eines Tarifvertrags zu unterstützen, ohne dass die zum Sympathiestreik aufgerufenen Arbeitnehmer und die dadurch bestreikten Arbeitgeber vom Geltungsbereich des von der anderen Gewerkschaft umkämpften Tarifvertrags erfasst wurden.“[29]
Ein Unterstützungsstreik im Sinne der von Dietrich geprägten, rechtlichen Definition liegt demnach dann vor, wenn
- Arbeitnehmer
- sich an einem Streik beteiligen,
- der von einer Gewerkschaft geführt wird
- der einen anderen Streik unterstützt und
- der in einem anderen Tarifgebiet stattfindet.[30]
Ziel des Streiks muss also die Änderung eines Tarifvertrags sein, dessen Regelungsgehalt die Streikenden nicht unterworfen sind und auch gar nicht unterworfen werden können.
Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Geltungsbereich dieses Tarifvertrags diejenigen Arbeitnehmer, die zur Unterstützung streiken, entweder in persönlicher, fachlicher, betrieblicher oder in räumlicher Hinsicht nicht erfasst.[31]
Unnötigerweise fordert Dietrichs Definition zusätzlich den Zweck der Unterstützung. Dabei stellte er bereits selbst vorher fest: Der Unterstützungszweck ändert nichts an den (...) Folgen des Streiks.[32]
Gemeint ist evtl. die Akzessorietät bzw. die zeitliche Akzessorietät des Unterstützungsstreiks zum Hauptstreik: lehnt sich ersterer nicht an letzteren an, so handelt es sich um einen selbständigen Hauptstreik.[33]
Zeitlich gesehen kann ein Unterstützungsstreik also frühestens zu dem Zeitpunkt beginnen, in dem bereits ein Hauptstreik vorliegt. Auch kann er nicht nach Beendigung des Hauptstreiks andauern.
Ebenfalls nicht übernommen werden hier die von Gumnior – allerdings unter dem Begriff des Sympathiestreiks – geforderten und schwerlich objektivierbaren Merkmale des „Unterstützungs-willens“ bzw. des „Fehlenden eigenen unmittelbaren Interesses“.[34]
Auch das Merkmal der Einhaltung der „Friedenspflicht“ halte ich für verzichtbar. Hierbei handelt es sich um ein Rechtmäßigkeitskriterium, nicht um ein Abgrenzungsmerkmal.
b. Konsequenzen
Wenn die Abgrenzung des Unterstützungsstreiks auf diese Weise vorgenommen wird, wie das eben geschehen ist, so hat dies Konsequenzen für die Unterscheidung zwischen dem Unterstützungs- und dem Hauptstreik, weil diese Definition ja im Wesentlichen alleine auf den „Unterstützungscharakter“ eines Streiks abstellt.[35]
Andererseits sollte die begriffliche Abgrenzung eines rechtlichen Tatbestands für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit eines Sachverhalts (möglichst) folgenlos bleiben.[36]
Es wäre etwa bedauerlich, wenn die Praxis durch den Eindruck eines bemerkenswerten Einzelfalls eine Rechtmäßigkeitsprüfung mit extensiver / restriktiver Begriffsauslegung vorwegnehmen würde.[37] Bei einer Gleichsetzung der Zulässigkeitsgrenze eines Streiks mit der Tarifgebietsgrenze, wäre die Frage der Zulässigkeit des Unterstützungsstreiks schon beantwortet.[38]
(1) Identität der Kampfsubjekte/ -objekte
Bei der Beurteilung, ob ein Unterstützungsstreik vorliegt oder nicht, ist die Frage nach der Identität der Kampfsubjekte und der Kampfobjekte damit überhaupt nicht mehr relevant.
Da die Grenze zwischen Hauptstreik und Unterstützungsstreik an Hand des Geltungsbereichs des Tarifvertrags gezogen wird, ist es für die begriffliche Zuordnung letztlich gleichgültig, ob an der Aktion zwei (Identität der Arbeitskampf-Gegner), drei (Auseinanderfallen auf einer Kampf-Seite) oder vier (Auseinanderfallen auf beiden Kampf-Seiten) unterschiedliche Akteure beteiligt sind.
Aus dem gleichen Grund (Grenze Tarifvertrag = Grenze Hauptstreik) spielt es auch keine begriffswesentliche Rolle, ob der Arbeitgeber auf den Abschluss des Tarifvertrags Einfluss hat oder nicht. Die Grenze zwischen dem Hauptstreik und einem Unterstützungsstreik kann durch einen einheitlichen Betrieb laufen – sie muss es aber nicht.[39]
(2) Beteiligung von Außenseitern
Ebenso wenig macht die Beteiligung von Außenseitern einen Streik zu einem Unterstützungsstreik.[40]
In Bezug auf einen Außenseiterarbeitgeber gilt das selbst dann, falls eine Gewerkschaft einen Firmen-Tarifvertrag abgeschlossen hat und dieselbe Belegschaft des Außenseiterarbeitgebers für die Auseinandersetzung um den Verbandstarifvertrag streikt.[41]
Dieser Streik muss rechtlich dem Hauptstreik zugeordnet werden. Der Firmen-Tarifvertrag schafft nämlich keine „Enklave“ in den Grenzen des Verbands-Tarifvertrags, innerhalb der die dem Firmen-Tarifvertrag unterworfenen Arbeitnehmer als vom Verbands-Tarifvertrag ausgegrenzt angesehen werden könnten.
Das sieht auch das BAG schon immer so: „Anders als bei den Sympathiearbeitsarbeitkämpfen kann der Außenseiter in diesem Fall den Forderungen nachkommen, da er tariffähig ist und mit der Gewerkschaft einen Firmen-Tarifvertrag abschließen oder erklären kann, dass er sich dem Ergebnis anschließt, das bei den Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgeberverband und Gewerkschaft erreicht wird.“[42]
In Bezug auf Außenseiterarbeitnehmer ist die Zuordnung zum Hauptstreik ohnehin allgemeine Auffassung[43] und bei Bezugnahme bzw. Allgemeinverbindlichkeitserklärung sogar unstreitig.[44]
Liegt ein entsprechender gewerkschaftlicher Streikbeschluss vor, können sich an einem Streik nach ganz herrschender Auffassung alle angesprochenen Arbeitgeber beteiligen – also nicht nur die in der streikenden Gewerkschaft organisierten, sondern auch die nichtorganisierten und die andersorganisierten Arbeitnehmer.[45]
Das Ergebnis eines Arbeitskampfs kommt zumindest faktisch auch den sog. "Außenseitern" zugute, die gleichfalls um ihre Arbeitsbedingungen kämpfen, soweit sie dem Streikbeschluss folgen und die Arbeit niederlegen.[46]
In diesen Fällen bleibt es dabei, dass es darum geht, dass der Arbeitskampf zu Gunsten eigener Tarifziele geführt wird.
Denn, selbst wenn den Außenseitern die Normen des Tarifvertrags nicht unmittelbar und zwingend zugutekommen, partizipieren sie am Tariferfolg, weil Arbeitgeber die Außenseiter individualrechtlich regelmäßig gleichstellen, um nicht auch noch Gewerkschaftseintritte zu fördern.[47]
Das BAG hat außerdem angedeutet, dass die Differenzierung zwischen Gewerkschaftsmitgliedern und Außenseitern im Arbeitskampf auch gegen die positive Koalitionsfreiheit verstoßen kann, z.B. bei einer Selektivaussperrung.[48]
Das heißt mit klaren Worten: Arbeitgeber dürfen Außenseiter bei einer Aussperrung nicht verschonen. Um Wertungswidersprüche zu vermeiden, ist eine Gleichstellung beider Gruppen daher auch im Fall der Streikberechtigung angezeigt.[49]
Gumnior weist allerdings zu Recht darauf hin, dass ein Gleichlaufen von Streik und Aussperrung nicht selbstverständlich sein muss. Es kann aus einem Streikrecht nicht reflexartig darauf geschlossen werden, dass der Arbeitgeber spiegelbildlich zur Aussperrung befugt ist.[50]
(3) Zwischenergebnis
Die eben vorgenommene Abgrenzung lässt erkennen, dass es arbeitskampfrechtlich stimmig bleibt, wenn die Grenze zwischen Haupt- und Unterstützungsarbeitskampf entlang des Geltungsbereichs eines Tarifvertrags gezogen wird.
Die Streikbeteiligung von Außenseitern und das Phänomen des Unterstützungsstreiks stehen dabei nicht in einem Verhältnis von Mehr oder Weniger, sondern sie differieren qualitativ:
„Ein einfacher Erst-Recht-Schluss (...) in der Weise, dass man sagen würde, wenn schon die Außenseiter sich unterstützend (...) beteiligen können, dann (...) erst recht (...) Gewerkschaftsmitglieder, die der persönliche Geltungsbereich eines Tarifvertrags nicht erfasst, ist aus diesem Grund nicht möglich.“[51]
c. Komplemente
Vom Unterstützungsstreik abzugrenzen sind auch verschiedene, ihm ähnliche, gewissermaßen komplementäre Erscheinungen, mittels derer die Arbeitnehmerschaft ebenfalls versucht, fremde Ziele zu unterstützen. Im Einzelnen zählen dazu der sog. Boykott, die Verweigerung von Streikarbeit und der Demonstrationsstreik.
(1) Boykott
Wenn ein Boykott ausgerufen wird, handelt es sich dabei um den Versuch, den geschäftlichen Verkehr des Kampfgegners zu schädigen, indem entweder nur die eigenen geschäftlichen Kontakte mit ihm abgebrochen werden oder, indem auch (zusätzlich) Dritte zu einem solchen Verhalten aufgefordert werden.[52]
In der dem Unterstützungsstreik verwandtesten Konstellation ruft eine Gewerkschaft ihre Mitglieder zum Boykott gegen einen im Hauptstreik befindlichen Arbeitgeber auf. Der Boykott richtet sich dabei nicht gegen den eigenen Arbeitgeber, selbst wenn es ihn irgendwie wirtschaftlich treffen würde. Der Boykott richtet sich gegen einen fremden Arbeitgeber, der sich im Hauptarbeitskampf befindet und der Vertragspartner des eigenen Arbeitgebers ist.
Die Arbeitsverweigerung wird aber deshalb nicht als Streik qualifiziert, weil nicht schlechterdings jede Arbeit verweigert wird, sondern nur diejenige „für“ das boykottierte Unternehmen.[53]
(2) Verweigerung von Streikarbeit
Unter der Verweigerung von Streikarbeit versteht man eine Einschränkung des arbeitgebereigenen Direktionsrechts, nach der ein arbeitswilliger Arbeitnehmer nicht gegen seinen Willen auf Arbeitsplätzen eingesetzt werden kann, die durch die Streikteilnahme anderer Arbeitnehmer unbesetzt sind.[54]
Der Arbeitgeber muss hier den Gewissenskonflikt seiner Arbeitnehmer zwischen ihrer Solidarität mit den Streikenden und der vertraglich vereinbarten Arbeitspflicht beachten.[55]
Die wichtige Gemeinsamkeit zwischen dem Verweigern von Streikarbeit und einem Unterstützungsstreik besteht daher darin, dass sich ihre Legitimation in beiden Fällen aus einem fremden Hauptstreik ableitet.[56]
Die eine Aktion spielt sich jedoch im Individualrecht ab, die andere im Kollektivrecht. Selbst wenn der Entschluss eines Arbeitnehmers, in beiden Fällen durch eine Gewerkschaft hervorgerufen werden sollte, üben Verweigerer von Streikarbeit im Grunde nur ein individuelles Leistungsverweigerungsrecht aus.[57]
Die Verweigerer von Streikarbeit wollen sich lediglich in Bezug auf Streikarbeit (passiv) neutral verhalten. Unterstützungsstreikende setzen den betroffenen Unternehmer dagegen auf die gesamte Arbeit bezogen unter Druck, d.h. „aktiv“.
Zusätzlich dürften sich auch die Rechtsfolgen grundsätzlich unterscheiden:
Während bei einer individualrechtlich zulässigen Verweigerung von Streikarbeit den Arbeitgeber eine Lohnzahlungspflicht über § 615 BGB trifft,[58] führt ein Streik zur Suspendierung der Lohnzahlungspflicht.[59]
Obwohl Rüthers keinen Raum für Unterstützungsstreiks erkennt, ist dem von ihm gesehenen Exklusivitätsverhältnis zwischen den beiden Instrumenten doch zuzustimmen.[60] Eine Gewerkschaft stellt die Verweigerung von Streikarbeit mit einem Unterstützungsstreik gerade nicht auf eine zweite rechtliche Grundlage:[61] entweder wird das Arbeitsverhältnis suspendiert oder nicht, entfällt die Lohnfortzahlungspflicht oder nicht.[62]
(3) Demonstrationsstreik
Bei Demonstrationsstreiks geht es den Streikenden allein um den Hinweis auf soziale oder politische Meinungen i.S.v. Art. 5 GG. Hierbei fehlt ihnen im Unterschied zum Unterstützungsstreik vielfach die Tarifbezogenheit.
Die streikende Gewerkschaft greift damit in das geschützte Recht des Unternehmers auf den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ein.[63] Dieser Typus von Arbeitskämpfen ist somit unzulässig.[64]
(4) Zwischenergebnis
Daraus, dass der Boykott und die Verweigerung von Streikarbeit in bestimmten Fällen zulässig sein können, der Demonstrationsstreik dagegen nicht, ist erkennbar, dass sich die Zulässigkeit von Streikunterstützung durch dritte Arbeitnehmer daran entscheidet, welches Interesse der Rechtsordnung in dem konkreten Fall bedeutender erscheint:
- die Durchsetzung des arbeitnehmerseitigen Unterstützungsinteresses oder (Boykott, Verweigerung von Streikarbeit)
- der Schutz vor Eingriffen in das eingerichtete und ausgeübten Gewerbe
3. Resümee der Rechtsprechung
Auf historische Entscheidungen zum Sympathiestreik wird in dieser Darstellung nicht eingegangen, weil von der Rechtmäßigkeit des Hauptstreiks nicht mehr einfach auf die Rechtmäßigkeit des Sympathiestreiks geschlossen werden kann, nach der Arbeitskampf durch die Verzahnung mit dem Tarifvertrag über Art. 9 III GG nunmehr einer ganz anderen rechtlichen Bewertung unterliegt.[66]
Auch die ältere, allerdings tw. bis heute vertretene Lehre, die unter Rückgriff auf Erwägungen der sozialen Adäquanz voraussetzte, dass der Unterstützungsstreik grundsätzlich zulässig sei, kann für die Zwecke dieser Untersuchung nahezu verlustfrei übergangen werden.[67]
Die Rechtsprechung hatte sich die sog. soziale Adäquanz in diesem Zusammenhang einst zu eigen gemacht, später aber kommentarlos fallen gelassen – sie war ein griffiges Fremdwort, über das sich trefflich streiten ließ, wo die eigenen Beweggründe nicht klar waren oder sein sollten.[68] Hätte man statt sozialadäquat „akzeptiert“ gesagt, ohne Fremdwort wäre es wahrscheinlich nicht gegangen, die Folgen wären keine anderen gewesen.[69]
Während das BAG in der neueren Zeit die Entscheidung zur Zulässigkeit von Unterstützungs-streiks dann zunächst offen lässt,[70] stellt es in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Grundsatz auf, dass Unterstützungsstreiks in der Regel unzulässig sind.[71]
a. Grundsatz der Unzulässigkeit
Das BAG geht dabei davon aus, dass die Funktion des Arbeitskampfs die Grenzen seiner Zulässigkeit bestimmt. Es hält den Arbeitskampf daher bloß für ein Hilfsmittel der Tarifautonomie, das nur zur Durchsetzung tariflich regelbarer Kampfziele eingesetzt werden darf.[72]
Da der Unterstützungsstreik nicht „unmittelbar“ dieser Hilfsfunktion dient, hält ihn das BAG deshalb im Grundsatz für verfassungsrechtlich nicht schutzwürdig.[73]
Der vom Unterstützungsstreik betroffene Arbeitgeber könnte die Forderungen der streikenden Arbeitnehmer ja nicht einmal erfüllen. Er bedürfe daher eines größeren Schutzes als ein unmittelbar von einem Arbeitskampf betroffener Arbeitgeber, der zwischen Kampf und Nachgeben wählen kann.
Auch aus Art. 6 Nr. 2 und 4 ESC würde sich nichts anderes ergeben, weil das Streikrecht danach offenbar nur in Bezug auf Kollektivverhandlungen gewährt ist.[74]
b. Ausnahmetatbestände
Das BAG erkennt in seiner ersten Entscheidung zum Unterstützungsstreik jedoch eine nicht abschließende Zahl von Fällen an, in denen vom Grundsatz der Unzulässigkeit eine Ausnahme gemacht werden könnte:
So ließe sich ein Sympathiestreik rechtfertigen, wenn der betroffene Arbeitgeber zuvor seine „Neutralität“ im Hauptarbeitskampf verletzt hätte, etwa durch die Übernahme der Produktion des ursprünglich bestreikten Arbeitgebers.[75]
Die Rechtmäßigkeit des Sympathiestreiks könnte auch anders zu beurteilen sein, wenn der betroffene Arbeitgeber zwar rechtlich selbständig, aber mit dem anderen bestreikten Arbeitgeber wirtschaftlich so eng verflochten wäre, dass es sich um denselben Gegenspieler handeln würde und er nicht mehr als außenstehender Dritter angesehen werden könnte.[76]
c. Zwischenergebnis
Diese Argumentation des BAG wird verständlich, wenn man sich noch einmal vergegenwärtigt, dass das Streikrecht nicht um seiner selbst willen geschützt ist,[77] sondern nur im Rahmen des Grundrechts auf Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG).[78]
Auch innerhalb der Koalitionsfreiheit ist das Streikrecht wiederum nur eines von mehreren „Instrumenten“ des Arbeitskampfs, die als notwendiges Übel toleriert werden, um das relative Verhandlungsgleichgewicht der widerstreitenden Akteure zu gewährleisten und eine funktionierende Tarifautonomie aufrecht zu erhalten.[79]
Ergo dient ein Streik dem Ausgleich sonst nicht lösbarer tariflicher Interessenkonflikte und ist deshalb auch nur zu diesem Zweck legitimiert.[80] Auf der den Streikenden gegenüberliegenden Seite stehen schließlich die Grundrechte der Berufs- und Eigentumsfreiheit des bestreikten Unternehmers aus Art. 12, 14 GG.
Der Eingriff in dessen Rechte wird rechtlich nur deshalb hingenommen, weil der Arbeitgeber im Arbeitskampf der soziale Gegenspieler der Arbeitnehmer ist, der es in der Hand hat, dem Druck der Streikenden durch Nachgeben und Zugeständnisse zu entgehen.[81]
Diese Kollision der Kampfparteien beschränkt die Wahl ihrer Mittel allerdings gleichzeitig auch auf solche, die wirklich erforderlich sind, um diese Tarifauseinandersetzung zu beeinflussen.[82] Genau diese Erforderlichkeit konnte das BAG jedoch nicht erkennen, als es sein Regel-Ausnahme-Verhältnis konstruierte.
Die damals zu beurteilenden Unterstützungsstreiks richteten sich ja gerade nicht gegen den direkten, tariflich Gegenspieler, sondern gegen einen anderen Arbeitgeber, der Zugeständnisse machen sollte, die er gar nicht erfüllen können konnte.[83]
Damit machte das BAG die Frage der Erfüllbarkeit der im Unterstützungsstreik erhobenen Forderungen zum Dreh- und Angelpunkt für die (Un-)Zulässigkeit des Unterstützungsstreiks.[84]
Typisierbare Ausnahmetatbestände bzw. deren Anwendungsbereiche, wie sie vom BAG aufgezeigt wurden, blieben mangels Sachverhaltsreferenz unscharf.[85]
4. Resümee der Rechtsliteratur
Die soeben vorgestellte Position, die das BAG zum Unterstützungsstreik bislang eingenommen hatte wurde von unterschiedlichen Seiten der Rechtsliteratur mit verschiedenen wesentlichen Argumenten kritisiert.
Dies ist nichts Ungewöhnliches im Arbeits(kampf)recht, welches nun einmal so stark interessenorientiert ist, dass nahezu jede Entscheidung des BAG mit Vehemenz positiv oder negativ interpretiert werden kann, abhängig von dem Standpunkt, den der Beobachter einnimmt.[86]
Im Folgenden sollen nun die einzelnen Argumente, die dem BAG entgegen gehalten wurden, etwas ausführlicher diskutiert werden, wobei die grundsätzlicher Kritik und die Kritik an den Ausnahmetatbeständen getrennt behandeln werden.
a. Kritik grundsätzlicher Art
(1) Erfüllbarkeit der Streikforderung
Lieb bestritt, dass das Kriterium, eine Streikforderung müsse erfüllbar sein, eine Aussage über die Erforderlichkeit eines Unterstützungsstreiks zulässt.
Es würde sich dabei zwar um eine richtige tatsächliche, aber nicht um eine richtige rechtliche Beobachtung handeln, da ungeachtet der Unerfüllbarkeit immerhin mittelbare Einflussmöglichkeiten bestehen würden.[87]
Darauf kam es dem BAG, das auf die Schutzbedürftigkeit des „in Geiselhaft genommenen Arbeitgebers“[88] abstellte, jedoch gar nicht an, weil grundsätzlich jeder unmittelbar streikbedingte Angriff in die Rechte eines Arbeitgebers ausgeschlossen werden sollte, wenn dieser nicht Tarifgegner ist.[89]
Dem allerdings ist wiederum entgegen zu halten, dass die Prägnanz der Metapher, die das BAG verwendete die Konstellation überzeichnet. Denn in der Lage „wehrloser Geiseln“ befinden sich die Arbeitgeber schon deshalb nicht, weil sie auf derartige Streiks mit Entgeltminderungen reagieren im Falle eines Verbandstarifvertrags die Solidarität des Arbeitgeberverbandes – etwa in Gestalt von Zahlungen aus dem Kampffonds – in Anspruch nehmen können.[90]
(2) Tarifbezug des Unterstützungsstreiks
Von Plander wird dem BAG ferner entgegengehalten, der Unterstützungsstreik würde sich – durch die Unterstützung des Hauptstreiks – ja ohnehin (mittelbar) auf einen Tarifvertrag beziehen und so unter den Schutz von Art. 9 III GG fallen.[91] Da der Unterstützungsstreik begriffsnotwendig (nur) unterstütze, dürfe das BAG dessen Unzulässigkeit nicht mit seinem Wesen begründen.[92]
Das machte das BAG allerdings auch nicht. Solche unterstützenden Wirkungen und die Tarifbezogenheit hatte das BAG durchaus erkannt,[93] es sah jedoch einen relevanten Unterschied zwischen mittelbarem und unmittelbarem Tarifbezug.[94]
Planders Position, die im Kern ironischer Weise Gleichbehandlung wegen Ungleichheit fordert, war für das BAG daher nicht hinreichend, um die Zulässigkeit des Unterstützungsstreiks zu erkennen, denn es genügt ihm nicht, dass dieser irgendwie und irgendwo im Schutzbereich des Art. 9 III GG liegt.[95]
[...]
[1] Das BAG verwendet neuerdings einheitlich (und ausschließlich) die Bezeichnung des Unterstützungsstreiks. Dem schließt sich der Verf. aus pragmatischen Erwägungen vorläufig an, da der Ausdruck in der Regel mit derselben semantischen Abgrenzung verwendet wird wie die Namen Solidaritäts- und Sympathiestreik. Für eine genauere Abgrenzung siehe später unter II.
[2] BAG v. 19. Juni 2007, 1 AZR 396/06, BAG-Pressemitteilung Nr. 48/07.
[3] Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Presse-Information Nr. 49/2007.
[4] Vgl. Protokoll der 17. Sitzung des Parlamentarischen Rates v. 03.12.1948, zit. n. Brox / Rüthers, S. 32.
[5] Ausführlicher dazu z.B. Ruhland, S. 5-10.
[6] Mü-Hb/Otto, § 284 Rn. 18.
[7] Gamillscheg „Grundrechte“, S. 445.
[8] Junker, S. 102.
[9] Ruhland, S. 6.; Blanke, S. 210.
[10] Grasnick, FAZ v. 04.01.2008, S.36 in allgemeinerem Zusammenhang.
[11] BAG v. 10.06.1980, 1 AZR 331/79.
[12] BVerfG v. 26.06.1991, 1 BvR 779/85. Ruhland, S. 8.
[13] BVerfG v. 26.06.1991, 1 BvR 779/85, C. I. 3. b. aa.
[14] Vgl. zum Ganzen Mü-Hb/Otto, § 277 Rn. 5f.
[15] Ausführlich und m.w.N. dazu Ruhland, S. 9ff., der auch die Gegenposition darstellt. Diese konzipiert Art. 9 III GG als bloßes Arbeitnehmergrundrecht und argumentiert letztlich mit einem Verstoß gegen die Menschenwürde (Art. 1 I GG), da die einzelnen Arbeitnehmer durch Aussperrungen zu Objekten des Arbeitgeberhandelns gemacht würden.
[16] ErfK/Dieterich, Rn. 115.
[17] S. zum Ganzen: Gumnior, S. 39-42.
[18] BAG v. 05.03.1985, 1 AZR 468/83, bestätigt durch BAG v. 12.01.1988, 1 AZR 219/86.
[19] Dietrich, S.4.
[20] Däubler/Bieback, Rn. 372, zit. n. ErfK/Dieterich, Rn. 115
[21] Dietrich, S.6.
[22] Lege, S. 5, III.
[23] Gumnior, S. 24-26 m.w.N..
[24] Vgl. Weinrich, S. 24.
[25] Kissel, § 24 Rn. 16.
[26] Gamillscheg „Arbeitsrecht“, 1135ff.
[27] Dietrich, S. 6.
[28] Gumnior, S.21
[29] BAG v. 05.03.1985, 1 AZR 468/83.
[30] Dietrich, S. 10.
[31] A.A. Konzen, S. 11-13. Dieser geht zwar davon aus, dass das Tarifgebiet den Hauptstreik vom Sympathiestreik trennt, allerdings macht er eine Ausnahme beim Kriterium des persönlichen Geltungsbereichs. Dort entscheidet er sich dazu, die Belegschaft als Einheit zu betrachten, um – im Einklang mit BAG v. 21.04.1991, BAGE 23, 292 (310) – die Beteiligung von Außenseitern am Streik zu rechtfertigen. Damit korrigiert er den Widerspruch, der sich für ihn ergeben würde, wenn Außenseitern ein Streikrecht zugesprochen würde, das Andersorganisierten, die (bloß) nicht dem persönlichen Geltungsbereich des umkämpften Tarifvertrags unterfallen, verwehrt bleibt.
[32] Dietrich, S. 2.
[33] Gumnior, S. 65f.
[34] Gumnior, S. 65-69.
[35] In dieser Richtung vgl. nur Brox/Rüthers, Arbeitsrecht, Rn. 303. Aber auch: Gumnior, S. 66f., m.w.N.
[36] Dietrich, S. 28.
[37] Dietrich, S. 28.
[38] Dietrich, S. 166.
[39] Dietrich, S.27.
[40] Gebhardt, Außenseiter im Arbeitskampf in Deutschland und im Ausland, S. 262, zit. n. Dietrich, S. 23.
[41] Dieser Sachverhalt wird unterstellt bei LAG Hamm v. 24.10.2001 – 18 Sa 1981/00, zit. n. Dietrich, S.13.
[42] BAG v. 09.04.1991, 1 AZR 332/90. Mit BVerfG v. 10.09.2004, 1 BvR 1191/03 wurde die Rechtsprechung des BAG bestätigt, wonach ein Außenseiter-Arbeitgeber in einen Verbandsarbeitskampf einbezogen werden kann, wenn er an dem Ergebnis der Tarifauseinandersetzung partizipiert.
[43] Konzen, S.6, m.w.N..
[44] ErfK/Dieterich, Rn. 160.
[45] BAG v. 22.03.1994, 1 AZR 622/93.
[46] BAG v. 22.03.1994, 1 AZR 622/93.
[47] Dietrich, S. 23.
[48] BAG v. 10.06.1980, 1 AZR 331/79.
[49] Dietrich, S. 25.
[50] Gumnior, S. 111.
[51] Dietrich, S.26.
[52] ErfK/Dieterich, Rn. 274f., kehrt auch die Synonymität des Streiks mit einem „Primärboykott“ hervor.
[53] Zum Ganzen: Dietrich, S. 29ff.
[54] ErfK/Dieterich, Rn. 169. Das gilt auch für Leiharbeitnehmer, falls diese bei einem unmittelbar von einem Arbeitskampf betroffenen Entleiher tätig sind (§ 11 V AÜG).
[55] Mü-Hb/Blomeyer, § 46 Rn. 34. Für Dietrich, S. 136, spielt hier noch der klassenkämpferische Ansatz des Arbeitskampfs hinein, der alle AN in ein gemeinsames Interessenlager einordnet.
[56] Dietrich, S.34.
[57] Rüthers/Berghaus, Bl. 1112, II. Kritisch dazu Mü-Hb/Blomeyer, § 47 Rn. 63, für den aus Arbeitgebersicht Transparenz bedeutend ist, um entsprechende Reaktionen zu ermöglichen. Diese wäre allerdings umständlich zu erreichen, wenn sich die Arbeitnehmer individuell auf ihr Leistungsverweigerungsrecht berufen müssten, um dem Vorwurf eines wilden Streiks inkl. Abmahnung/ Kündigung zu entgehen.
[58] Mü-Hb/Blomeyer, § 47 Rn. 63.
[59] BAG v. 22.03.1994, 1 AZR 622/93.
[60] Rüthers „Medien“, S. 4f.
[61] Däubler/Bieback, Rn. 393.
[62] Dietrich, S. 145.
[63] Differenziert dazu Sibben, S. 453f. m.w.N.. A.A. Blanke, S. 212 m.w.N., der in Bezug auf den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb pauschal von einem „Legendenrecht“ spricht.
[64] ErfK/Dieterich, Rn. 117.
[65] Dietrich, S.36.
[66] Gumnior, S. 53-60.
[67] Dietrich, S. 37-51.
[68] Gamillscheg „Arbeitsrecht“, S. 1130.
[69] Gamillscheg „Arbeitsrecht“, S. 1130.
[70] BAG v. 20.12.1963, 1 AZR 429/62. Mü-Hb/Otto, § 279, Rn. 43: Wegen der wirtschaftlichen Verflechtung der betroffenen Arbeitgeber sieht das BAG letztere gar nicht als Dritte an und verwendet deshalb auch nicht den Begriff des Unterstützungsstreiks.
[71] BAG v. 05.03.1985, 1 AZR 468/83, bestätigt durch BAG v. 12.01.1988, 1 AZR 219/86.
[72] BAG v. 05.03.1985, 1 AZR 468/83, II 3 b.
[73] BAG v. 05.03.1985, 1 AZR 468/83, II 3 c.
[74] BAG v. 05.03.1985, 1 AZR 468/83, II 3 d. Zum Ganzen: Gumnior, S.61.
[75] BAG v. 05.03.1985, 1 AZR 468/83, II 4.
[76] BAG v. 05.03.1985, 1 AZR 468/83, II 4.
[77] M.M. Blanke, S. 210.
[78] BVerfG v. 26.06.1991, 1 BvR 779/85, C I 3.
[79] Dietrich, S. 57.
[80] BAG v. 12.01.1988, 1 AZR 219/86, IV 2 a.
[81] Dietrich, S. 58.
[82] Dietrich, S. 59.
[83] Dietrich, S. 60. Rüthers, BB 1964, 312ff.: „nicht erfüllen kann und nicht erfüllen soll“.
[84] Dietrich, S. 64.
[85] BAG v. 05.03.1985, 1 AZR 468/83, II 4. BAG v. 12.01.1988, 1 AZR 219/86, IV 2 c. Gumnior, S. 63.
[86] Gumnior, S.62.
[87] Lieb, S. 64, II.
[88] Mü-Hb/Otto, § 286 Rn. 44.
[89] Dietrich, S. 64.
[90] Plander, S. 139, C.
[91] Plander, S. 136 A 3, A 4 und C 3.
[92] Plander, S. 136 A 3, A 4 und C 3.
[93] BAG v. 12.01.1988 1 AZR 219/86, IV 2 b aa.
[94] BAG v. 12.01.1988 1 AZR 219/86, IV 2 b aa.
[95] Dietrich, S. 68.
- Citation du texte
- Wolfgang Deutlmoser (Auteur), 2008, Neuorientierung der Rechtsprechung zum Sympathiestreik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203797