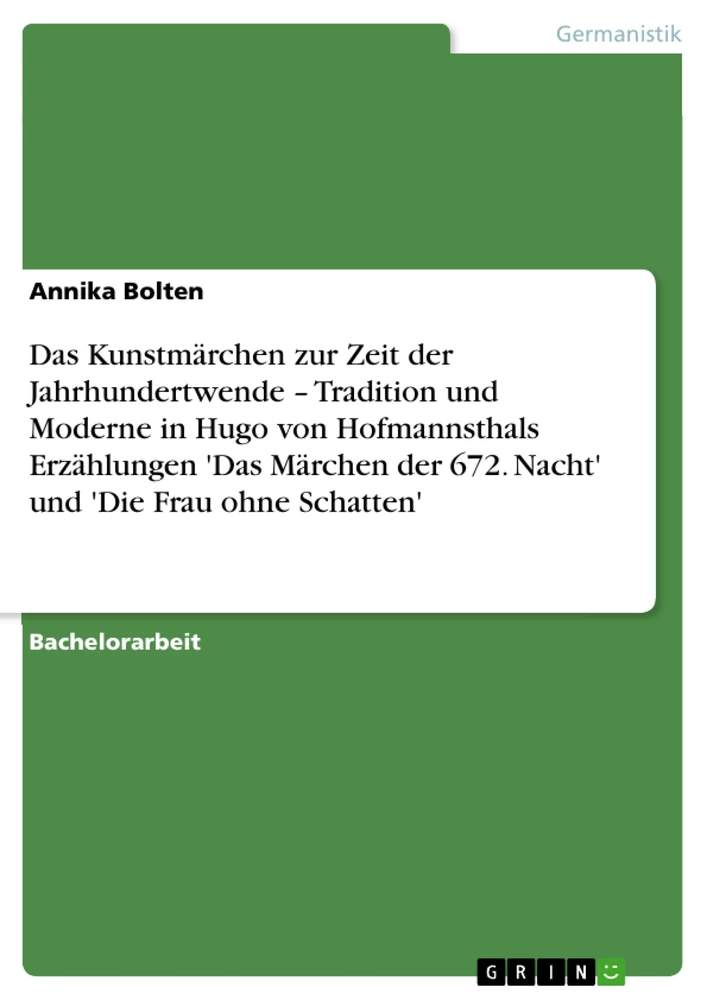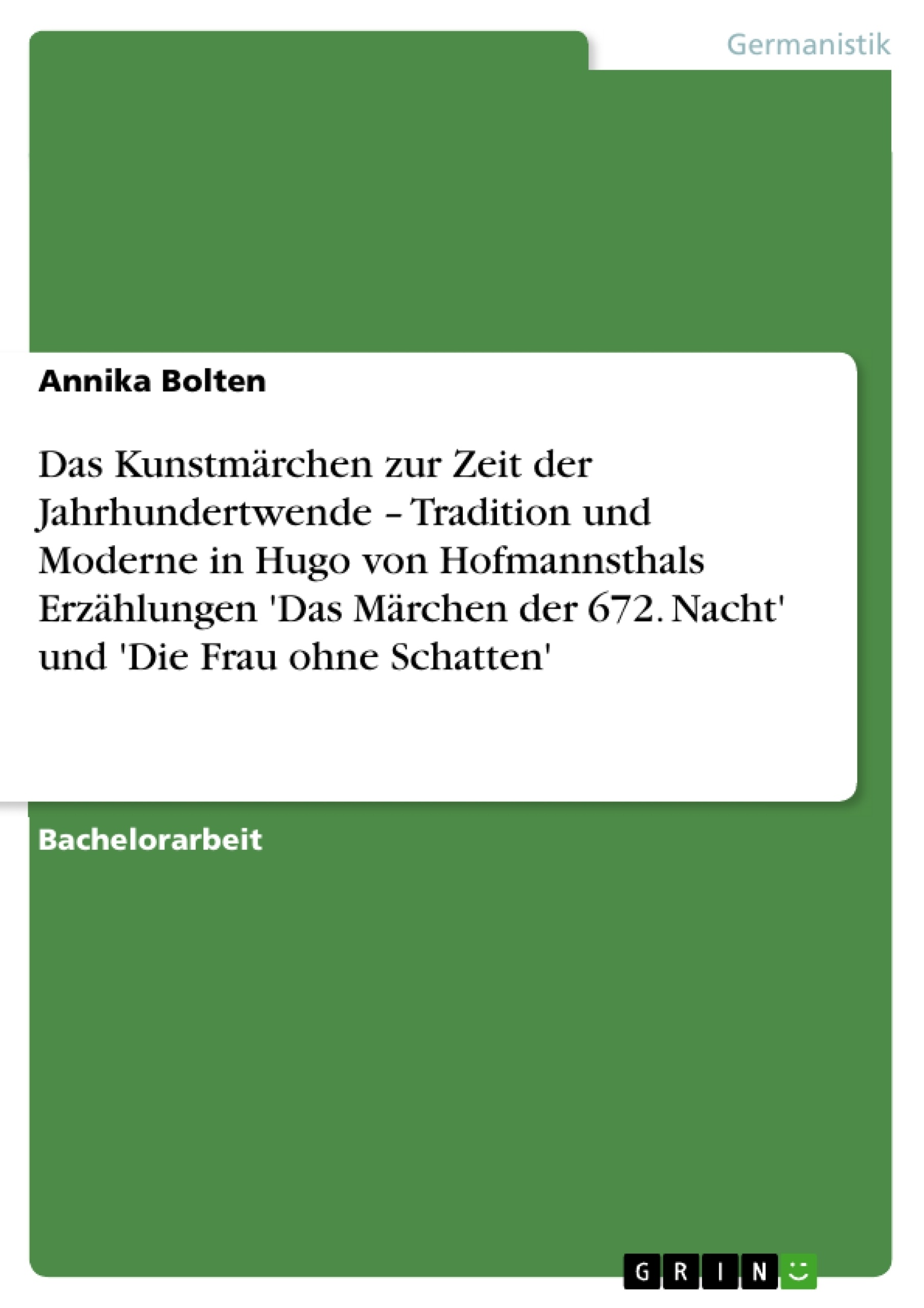Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es nur noch wenige Erzählungen, die in ihrem Anspruch und Umfang den bekannten Märchen der Romantik gleich kamen. Deshalb scheint es nicht zu verwundern, dass es nur wenige nennenswerte literaturwissenschaftliche Untersuchungen über das Kunstmärchen zur Zeit der Moderne gibt.
Gegen diese Behauptung spricht jedoch, dass auch noch in der Moderne Erzählungen veröffentlicht wurden, die in ihrer Form und Symbolik, wenn nicht als reines Kunstmärchen, dann doch als eine Art Mischform gewertet werden könnten. Zu diesen Erzählungen gehört Hugo von Hofmannsthals 'Das Märchen der 672. Nacht', welches er selbst als Märchen betitelte. Und auch das spätere Werk 'Die Frau ohne Schatten' weist märchenhafte Züge auf und erinnert stellenweise an die Vorbilder der Romantik und den orientalischen Märchenzyklus Geschichten aus tausendundeiner Nacht. Warum hat Hugo von Hofmannsthal in einer Zeit literarischer, kultureller und sozialer Umbrüche auf diese alte Form zurückgegriffen? Handelt es sich bei diesen Erzählungen überhaupt um richtige Märchen? Wie definiert sich die Literatur der Jahrhundertwende und welche Rolle spielte das Kunstmärchen zu dieser Zeit? Wie entwickelte sich dieses seit der Hochzeit der Romantik bis zur Moderne? Welche märchentypische Motive und welche Symbole und Elemente der Moderne lassen sich in den Erzählungen 'Das Märchen der 672. Nacht' und 'Die Frau ohne Schatten' finden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Literatur der Jahrhundertwende
- Von der frühen zur klassischen Moderne
- Das Subjekt in der Krise
- Die Wiener Moderne
- Hermann Bahr und der Beginn der Wiener Moderne
- Hugo von Hofmannsthal und der Kreis des Jungen Wien
- Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief- Die Sprachkrise des Lord
- Das deutsche Kunstmärchen
- Das Kunstmärchen in der Romantik
- Orientalische Tradition: Geschichten aus Tausendundeiner Nacht
- Die Wiederbelebung des Kunstmärchens in der Wiener Moderne
- Das Märchen der 672. Nacht und Die Frau ohne Schatten: Zwei moderne Märchen?
- Hugo von Hofmannsthals Das Märchen der 672. Nacht
- Intertextuelle Bezüge
- Typische Märchenelemente
- Atypische Märchenelemente
- Die Frau ohne Schatten
- Intertextuelle Bezüge
- Typische Märchenelemente
- Atypische Märchenelemente
- Das Kunstmärchen am Ende
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie das Kunstmärchen zur Zeit der Jahrhundertwende eine Renaissance erlebte. Im Fokus stehen dabei die Erzählungen „Das Märchen der 672. Nacht“ und „Die Frau ohne Schatten“ von Hugo von Hofmannsthal. Die Arbeit untersucht, inwiefern sich diese Werke an den traditionellen Elementen des Kunstmärchens orientieren und welche modernen Einflüsse in ihnen erkennbar sind.
- Die Entwicklung der Literatur der Jahrhundertwende
- Die Wiener Moderne als eigenständige Strömung
- Das Kunstmärchen in der Romantik und seine Verbindung zum Orientalischen Märchenzyklus
- Die Analyse der beiden Erzählungen von Hugo von Hofmannsthal im Hinblick auf ihre märchenhaften Elemente und ihre modernen Aspekte
- Die Frage nach dem Ende des Kunstmärchens zur Zeit der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Leitfragen der Arbeit vor und skizziert den groben Forschungsrahmen. Sie beleuchtet die Problematik der Definition des Begriffs 'Moderne' und verdeutlicht die Relevanz der Untersuchung des Kunstmärchens in dieser Epoche.
Kapitel 2 widmet sich der Literatur der Jahrhundertwende. Es werden die wichtigsten Merkmale der frühen und klassischen Moderne herausgearbeitet, wobei die Krise des Subjekts in der modernen Welt einen besonderen Fokus erhält.
Kapitel 3 befasst sich mit der Wiener Moderne, die sich als eigenständige Strömung innerhalb der Moderne entwickelte. Die Essays von Hermann Bahr, der die „aktive Kreation einer Moderne" forderte, werden ebenso beleuchtet wie der Einfluss des Kreises des Jungen Wien auf Hugo von Hofmannsthal.
Kapitel 4 untersucht das deutsche Kunstmärchen, seine Entwicklung vom Volksmärchen zur Romantik und die Bedeutung des orientalischen Märchens. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Kunstmärchen in der Moderne eine Renaissance erlebte.
Die Kapitel 6 und 7 analysieren die beiden Erzählungen von Hugo von Hofmannsthal: „Das Märchen der 672. Nacht“ und „Die Frau ohne Schatten“. Es werden die intertextuellen Bezüge, die typischen und atypischen Märchenelemente sowie die modernen Aspekte der Werke beleuchtet.
Kapitel 8 beschäftigt sich mit dem Ende des Kunstmärchens in der Moderne und stellt die Frage nach der Relevanz der Gattung im 20. Jahrhundert.
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf die weitere Märchenforschung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Kunstmärchen, die Jahrhundertwende, die Wiener Moderne, Hugo von Hofmannsthal, „Das Märchen der 672. Nacht“, „Die Frau ohne Schatten“, Romantik, Orientalisches Märchen, Dekadenz, Subjektkrise, Ästhetizismuskritik, Intertextualität, Symbole, Traumsequenz, Mischform, Gattungsmerkmale.
Häufig gestellte Fragen
Gilt Hofmannsthals "Das Märchen der 672. Nacht" als echtes Kunstmärchen?
Die Arbeit untersucht dies kritisch und kommt zu dem Schluss, dass es eine Mischform ist, die zwar märchenhafte Elemente nutzt, aber stark von der modernen Subjektkrise geprägt ist.
Was kennzeichnet die Wiener Moderne in der Literatur?
Die Wiener Moderne ist geprägt von Ästhetizismus, der Analyse der Sprachkrise (wie im Chandos-Brief) und der Auseinandersetzung mit der psychologischen Tiefe des Individuums.
Welche Rolle spielt der Orient in Hofmannsthals Märchen?
Hofmannsthal greift auf Traditionen wie "Tausendundeine Nacht" zurück, um eine exotische und symbolträchtige Atmosphäre zu schaffen, die typisch für die Neuromantik war.
Was ist die "Sprachkrise" bei Hugo von Hofmannsthal?
Thematisiert im "Lord-Chandos-Brief", beschreibt sie das Unvermögen, die Welt und das Ich mit herkömmlichen Worten adäquat zu erfassen.
Welche atypischen Märchenelemente finden sich in "Die Frau ohne Schatten"?
Atypisch sind die komplexe psychologische Symbolik, die soziale Realität der Färberleute und die Abkehr von der einfachen Gut-Böse-Struktur klassischer Märchen.
- Quote paper
- Annika Bolten (Author), 2011, Das Kunstmärchen zur Zeit der Jahrhundertwende – Tradition und Moderne in Hugo von Hofmannsthals Erzählungen 'Das Märchen der 672. Nacht' und 'Die Frau ohne Schatten', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203878