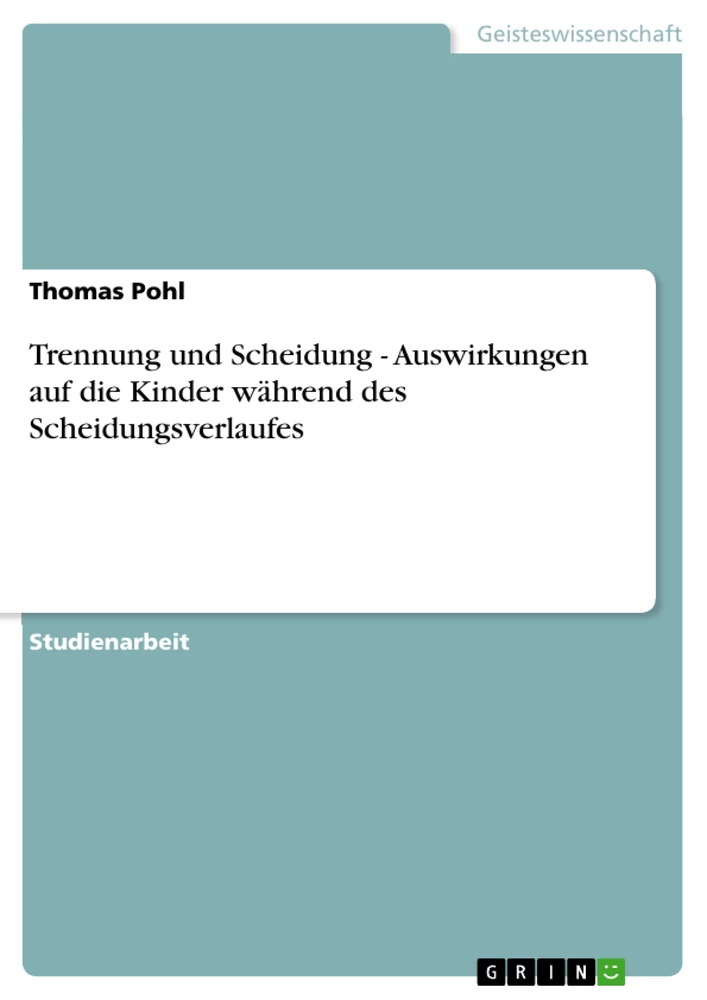Kinder und Jugendliche sind immer öfter Opfer eines Scheidungskrieges.
In dieser Hausarbeit sollen die Folgen in der ödipalen Phase verdeutlicht werden die bei den Kinder durch eine Scheidung entstehen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Scheidungsphasen
- 2.1. Vorscheidungsphase
- 2.1.1 Auswirkungen der Vorscheidungssituation für die intrapsychische Entwicklung der Kinder in der ödipalen Phase
- 2.2. Trennungsphase
- 2.3. Scheidungsphase
- 2.3.1 Auswirkungen einer Trennung auf die intrapsychische Entwicklung der Kinder in der ödipalen Phase
- 2.4. Nachscheidungsphase
- 2.4.1 Auswirkungen der Entwicklungsbedingungen in der Nachscheidungsphase auf die psychische Entwicklung
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf die kindliche Entwicklung, insbesondere während der ödipalen Phase. Ziel ist es, die Folgen einer Scheidung auf die intrapsychische Entwicklung von Kindern zu beleuchten.
- Auswirkungen der Scheidungsphasen auf Kinder
- Intrapsychische Entwicklung in der ödipalen Phase im Kontext von Scheidung
- Loyalitätskonflikte bei Kindern aus geschiedenen Familien
- Entwicklung psychischer Probleme bei Kindern aufgrund von Scheidung
- Die Rolle der Kinder während der Vorscheidungsphase
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Ideal der dauerhaften Ehe und der hohen Scheidungsrate in Deutschland. Sie führt in die Thematik ein, indem sie auf die gesellschaftliche Veränderung der Werte und die Folgen von Scheidung für Kinder eingeht. Der Fokus der Arbeit wird auf die Auswirkungen der Scheidung auf die intrapsychische Entwicklung von Kindern in der ödipalen Phase gelegt. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Auswirkungen einer Scheidung oder Trennung auf Kinder während des Scheidungsverlaufes.
2. Scheidungsphasen: Dieses Kapitel gliedert den Scheidungsprozess in vier Phasen: Vorscheidungsphase, Trennungsphase, Scheidungsphase und Nachscheidungsphase. Es betont, dass es sich um einen ganzheitlichen Prozess handelt, bei dem die Anpassungsleistungen von Kindern und Eltern im Vordergrund stehen. Jede Phase ist durch spezifische Ereignisse und Belastungen gekennzeichnet.
2.1. Vorscheidungsphase: Die Vorscheidungsphase, auch Ambivalenzphase genannt, ist durch zunehmende Eheprobleme und Distanzierung der Partner gekennzeichnet. Sie beginnt mit Unzufriedenheit und kann Monate bis Jahre dauern, endend mit der räumlichen Trennung. Die Probleme werden zunächst verdrängt, führen aber zu Streitigkeiten und reduzierter Kommunikation. Kinder erleben diese Phase als stark belastend und verunsichernd, da sie die Ungewissheit aushalten müssen. Sie entwickeln Ängste, fühlen sich für den Konflikt verantwortlich und können in Loyalitätskonflikte geraten oder in die Rolle des Partnerersatzes schlüpfen. Der elterliche Streit wirkt sich negativ auf die intrapsychische Entwicklung aus.
2.1.1 Auswirkungen der Vorscheidungssituation für die intrapsychische Entwicklung der Kinder in der ödipalen Phase: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Auswirkungen der Vorscheidungsphase auf die intrapsychische Entwicklung während der ödipalen Phase. Verfeindete Eltern können Loyalitätskonflikte bei Kindern erzeugen, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen, in Dreierbeziehungen zu funktionieren. Die Ablehnung eines Elternteils durch den anderen kann die sexuelle Identitätsentwicklung gefährden. Die Kinder können neurotische Symptome entwickeln, wie Phobien, Bettnässen oder Aggressivität.
Schlüsselwörter
Scheidung, Trennung, Kinder, ödipale Phase, intrapsychische Entwicklung, Loyalitätskonflikt, psychische Entwicklung, Familiensoziologie, Ehekrise.
Häufig gestellte Fragen zu: Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf die kindliche Entwicklung
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf die kindliche Entwicklung, insbesondere während der ödipalen Phase. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der intrapsychischen Entwicklung von Kindern im Kontext des Scheidungsprozesses, der in verschiedene Phasen unterteilt wird.
Welche Phasen des Scheidungsprozesses werden behandelt?
Der Scheidungsprozess wird in vier Phasen gegliedert: die Vorscheidungsphase (auch Ambivalenzphase), die Trennungsphase, die Scheidungsphase und die Nachscheidungsphase. Jede Phase wird separat beschrieben und ihre spezifischen Auswirkungen auf Kinder werden analysiert.
Wie wirkt sich die Vorscheidungsphase auf Kinder aus?
Die Vorscheidungsphase ist durch zunehmende Eheprobleme und Distanzierung der Partner gekennzeichnet. Kinder erleben diese Phase als stark belastend und verunsichernd aufgrund der Ungewissheit. Sie können Ängste entwickeln, sich für den Konflikt verantwortlich fühlen und in Loyalitätskonflikte geraten oder in die Rolle des Partnerersatzes schlüpfen. Der elterliche Streit wirkt sich negativ auf die intrapsychische Entwicklung aus.
Welche Auswirkungen hat die Vorscheidungsphase auf die intrapsychische Entwicklung in der ödipalen Phase?
In dieser Phase können verfeindete Eltern Loyalitätskonflikte bei Kindern erzeugen, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen, in Dreierbeziehungen zu funktionieren. Die Ablehnung eines Elternteils durch den anderen kann die sexuelle Identitätsentwicklung gefährden. Kinder können neurotische Symptome wie Phobien, Bettnässen oder Aggressivität entwickeln.
Welche Themenschwerpunkte werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Auswirkungen der Scheidungsphasen auf Kinder, die intrapsychische Entwicklung in der ödipalen Phase im Kontext von Scheidung, Loyalitätskonflikte, die Entwicklung psychischer Probleme und die Rolle der Kinder während der Vorscheidungsphase.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Scheidung, Trennung, Kinder, ödipale Phase, intrapsychische Entwicklung, Loyalitätskonflikt, psychische Entwicklung, Familiensoziologie, Ehekrise.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf die kindliche Entwicklung, insbesondere während der ödipalen Phase. Ziel ist es, die Folgen einer Scheidung auf die intrapsychische Entwicklung von Kindern zu beleuchten.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist strukturiert mit einer Einleitung, die den Kontext und die Forschungsfrage darstellt. Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Scheidungsphasen mit ihren Auswirkungen auf Kinder. Der Text schließt mit einem Fazit (obwohl der Inhalt des Fazits nicht im Preview enthalten ist) und einer Zusammenfassung der Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Thomas Pohl (Author), 2011, Trennung und Scheidung - Auswirkungen auf die Kinder während des Scheidungsverlaufes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203992