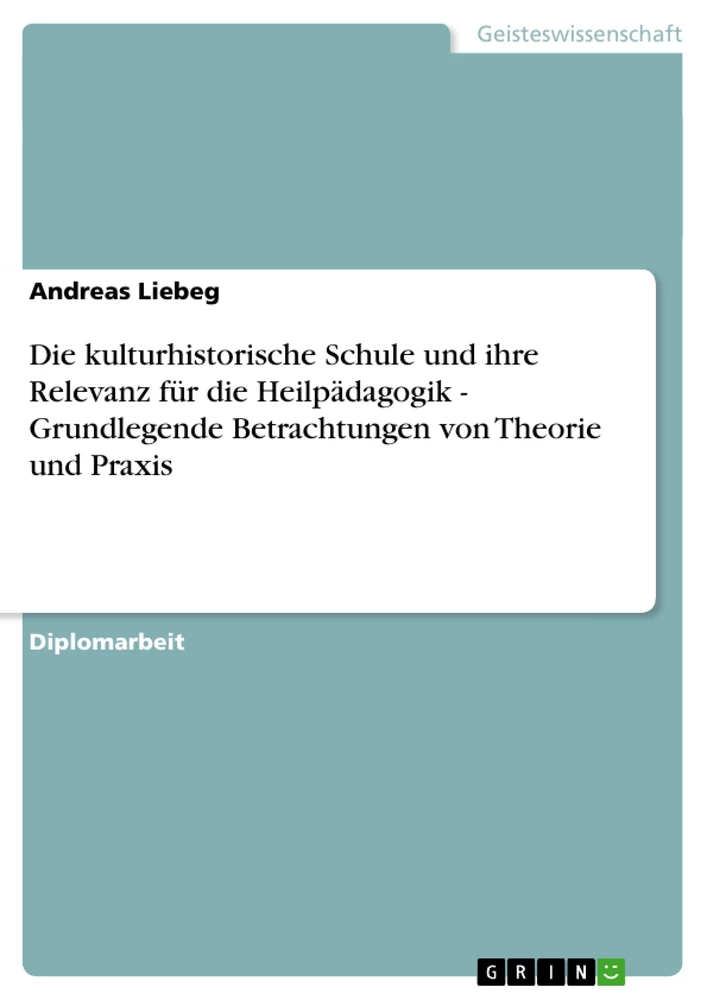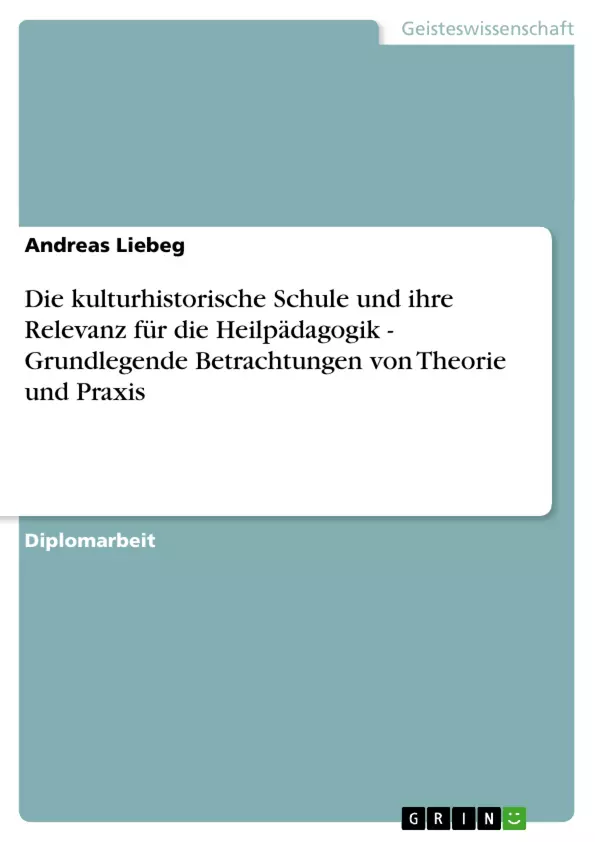[...] Ich sah meine Aufgabe aber nicht darin, die Errungenschaften und Gedanken kulturhistorisch forschender Wissenschaftler aufzulisten. Vielmehr will ich in dieser
Arbeit ein Menschenbild konstruieren, ein Menschenbild, welches meine heilpädagogische
Tätigkeit leitet. Es ist so wohl eine abstrakte Arbeit, da sie den Versuch
darstellt, ein System aufzubauen, in welchem unterschiedlichste konkrete
Momente meiner vergangenen und zukünftigen Arbeit Platz finden. Beginnen will ich meine Arbeit mit der Offenlegung meiner philosophischen Basis.
Auch wenn ich diesem ersten Teil meiner Arbeit nur wenig Raum biete, ist er
unumgänglich, da in ihm axiomatische Aussagen getroffen werden.
Danach wende ich mich der Aufgabe zu, die Entwicklung des Psychischen im
Menschen zu begreifen. Das Psychische hierbei hervorzuheben, mag irritieren,
wenn der Mensch als bio-psycho-soziale Einheit begriffen wird. Ich will aber gerade
diese Einheit betrachten, allerdings mit dem Ziel, den Zustand des Menschen
in seiner spezifischen psychischen Ausprägung zu verstehen. Um mich diesem
Verstehen zu nähern beginne ich damit, die Entwicklung des Psychischen in seiner
phylogenetischen Geschichte zu durchleuchten. Danach versuche ich zu ergründen,
inwieweit der Mensch sich von den rein phylogenetischen Entwicklungsprinzipien
entfernt hat. Im Anschluss daran betrachte ich die Prinzipien,
nach denen der spezifische Mensch seine konkrete Wirklichkeit differenziert, um
letztlich noch auf die physiologischen Grundlagen der dargestellten Entwicklungstheorie
einzugehen.
Im dritten Teil der Arbeit soll das erarbeitete System in seiner Relevanz für die
heilpädagogische Arbeit bestehen. Die Ausführungen darin sind als konkrete
Form des abstrakten Systems zu verstehen. Ich will folglich in diesem Abschnitt
zeigen, wie die dargestellten Prinzipien in der Auseinandersetzung mit Praxis
Anwendung finden können. Dazu werde ich meine Überlegungen in drei Abschnitten
differenzieren. Beginnen werde ich mit ethischen Betrachtungen, da die
persönliche Ethik m.E. das Fundament von jeglicher Arbeit mit Menschen darstellt.
Danach wende ich mich der diagnostischen Tätigkeit zu, um letzten Endes
in der Intervention den Schluss meiner Arbeit zu finden. In diesem letzten Kapitel
werde ich ein kurzes Beispiel aus meiner praktischen Tätigkeit geben, um auch in
dieser Hinsicht mein theoretisches Fundament zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Philosophische Grundlegung
- 1.1. Monismus als notwendiges Fundament.
- 1.2. Der dialektisch-historische Materialismus
- 1.3 Der Aufstieg vom Abstrakten zum Konkreten
- 1.4. Materialistischer Konstruktivismus...
- 2. Die Entwicklung des Psychischen
- 2.1. Die phylogenetische Entwicklung des Psychischen…........
- 2.1.1. Das vorpsychische Stadium
- 2.1.2. Sensibilität - eine Ausgangsabstraktion des Psychischen.
- 2.1.3. Wahrnehmung.....
- 2.1.4. Intellekt – die Endform des Psychischen beim Tier.
- 2.1.5. Soziale Strukturen.
- 2.1.6. Kultur...
- 2.2. Der Bruch zur Phylogenese in der Entwicklung des Menschen.
- 2.2.1. Die Hominiden
- 2.2.2. Der soziale Werkzeuggebrauch..\n
- 2.3. Die kulturhistorische Entwicklung des Menschen...
- 2.3.1. Das Zeichen als neue Form der Kommunikation
- 2.3.2. Die historische Erhaltung ontogenetischer Erfahrungen
- 2.3.3. Eine empirische Untersuchung zur kulturhistorischen Theorie.
- 2.4. Die ontogenetische Entwicklung des Psychischen......
- 2.4.1. Tätigkeit und Gegenstand..
- 2.4.2. Tätigkeit und Bedürfnis.
- 2.4.3. Der Kreis Tätigkeit - Operation - Handlung..
- 2.4.4. Interiorisierung.
- 2.4.5. Die Zone der nächsten Entwicklung
- 2.5. Physiologische Grundlagen der psychischen Entwicklung.
- 2.5.1. Psychische Tätigkeit und Nervensystem...
- 2.5.2. Der Organismus als funktionelles System...
- 2.5.3. Äußere Komponenten des funktionellen Systems beim Menschen
- 2.1. Die phylogenetische Entwicklung des Psychischen…........
- 3. Konsequenzen für die heilpädagogische Arbeit
- 3.1. Ethik...
- 3.1.1. Die Vorstellung einer einheitlichen Welt.
- 3.1.2. Über Sinn und Unsinn.
- 3.1.3. Die Verantwortung des Heilpädagogen..
- 3.2. Diagnostik.......
- 3.2.1 Historische Aspekte..
- 3.2.2. Die Notwendigkeit empirischer Methoden.
- 3.2.3. Der Dialog als Medium.
- 3.2.4. Vom Syndrom zu den Symptomen.
- 3.3. Intervention.....
- 3.3.1. Diagnostik - Intervention.
- 3.3.2. Die vermittelnde Tätigkeit..
- 3.3.3. Dialog
- 3.3.4. Kooperation.
- 3.3.5. Dialogisch-Kooperative Beziehung - Ein Beispiel..
- 3.1. Ethik...
- Schlusswort..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der kulturhistorischen Schule in der Heilpädagogik und zielt darauf ab, ein Menschenbild zu entwickeln, welches die Praxis in der Behindertenpädagogik bereichert. Die Arbeit untersucht die Prinzipien der kulturhistorischen Schule, insbesondere von Vygotskij, Lurija und Leontjew, und zeigt auf, wie diese Prinzipien die Entwicklung des Psychischen im Menschen beeinflussen und welche Relevanz sie für die heilpädagogische Praxis haben.
- Die philosophischen Grundlagen der kulturhistorischen Schule
- Die phylogenetische und ontogenetische Entwicklung des Psychischen
- Die Bedeutung von Tätigkeit und Interiorisierung für die Entwicklung
- Die Anwendung kulturhistorischer Prinzipien in der heilpädagogischen Arbeit
- Ethische Aspekte der heilpädagogischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die philosophischen Grundlagen der kulturhistorischen Schule. Der zweite Teil beleuchtet die Entwicklung des Psychischen, beginnend mit der phylogenetischen Entwicklung und einschließlich der ontogenetischen Entwicklung, sowie der physiologischen Grundlagen der psychischen Entwicklung. Im dritten Kapitel werden die Konsequenzen für die heilpädagogische Arbeit dargestellt, einschließlich ethischer Betrachtungen, diagnostischer Aspekte und der Intervention.
Schlüsselwörter
Kulturhistorische Schule, Vygotskij, Lurija, Leontjew, Entwicklung des Psychischen, Tätigkeit, Interiorisierung, Zone der nächsten Entwicklung, Heilpädagogik, Diagnostik, Intervention, Ethik, Behindertenpädagogik.
- Quote paper
- Andreas Liebeg (Author), 2003, Die kulturhistorische Schule und ihre Relevanz für die Heilpädagogik - Grundlegende Betrachtungen von Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20408