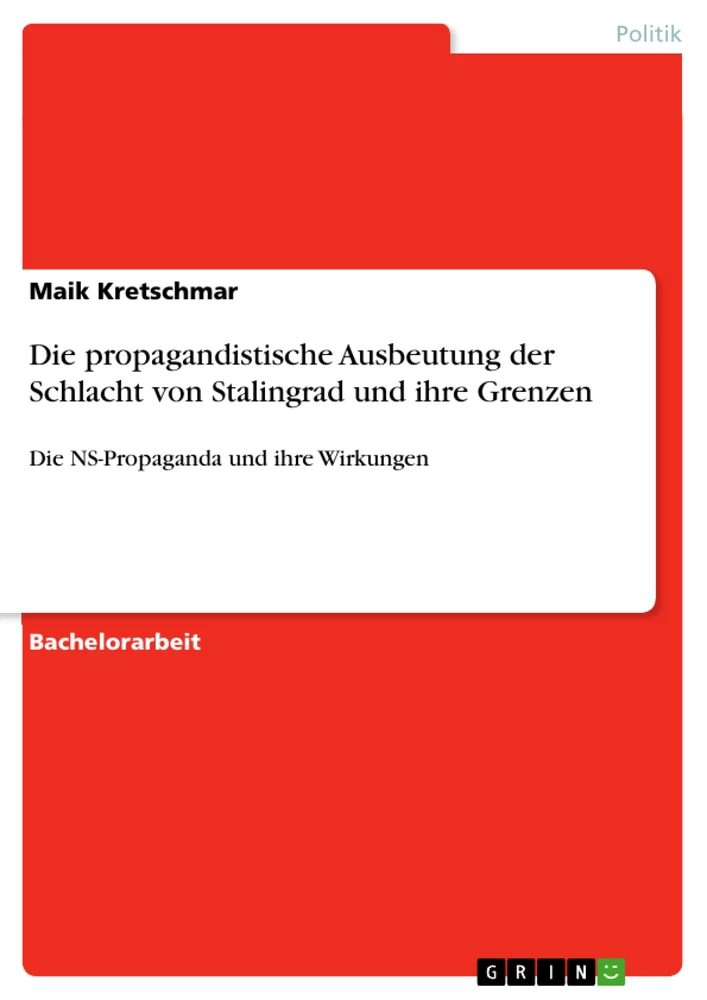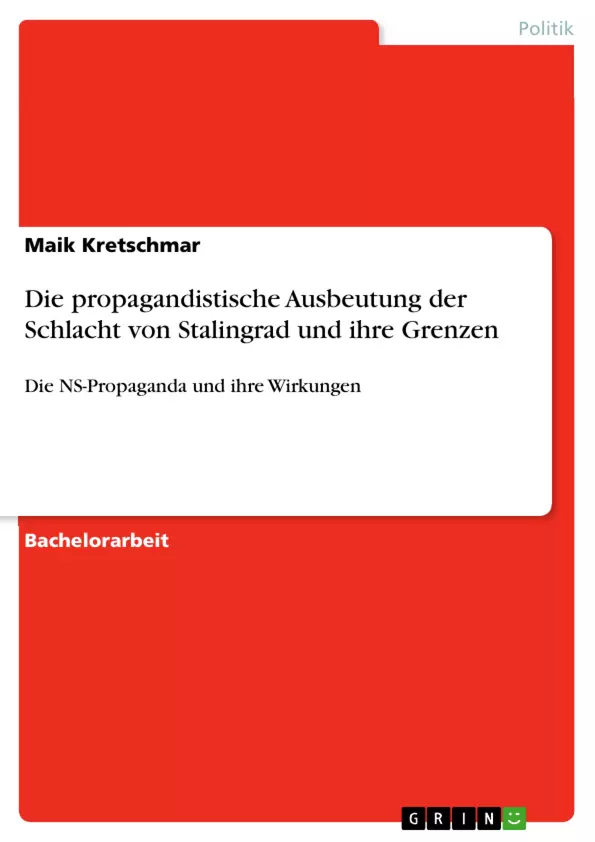In den Morgenstunden des 2. Februar 1943 kapitulierte der nördliche Kessel in Stalingrad.
Damit war auch der letzte deutsche Widerstand , in jener von der Nazi-Propaganda zu „einer der größten militärischen Entscheidungen der Geschichte“ (BI 19.9.42) stilisierten Schlacht, endgültig gebrochen. Und noch vielmehr, denn mit der Niederlage von Stalingrad war faktisch ebenso bereits der Zweite Weltkrieg, welcher jedoch noch mehr als zwei Jahre weiter wüten sollte, für Hitlerdeutschland verloren.
Hatte etwa Generalfeldmarschall Erich von Manstein als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Don (Klee 2008: 390), dem in der Operation „Wintergewitter“ vom Dezember 1942 der Entsatz der eingeschlossenen deutschen Truppen misslang, bis hierhin noch auf ein „Remis“ des Krieges im Osten gehofft (Manstein 1991: 474), so war angesichts der horrenden Verluste an Mensch und Material nun auch für ihn die absolute militärische Unterlegenheit der Wehrmacht offenbart worden. Nie wieder sollte sie in diesem Krieg zu einer erfolgreichen Großoffensive antreten. Vielmehr zogen sich die deutschen Truppen von diesem Zeitpunkt an stetig zurück, bis sie am 9. Mai 1945 bedingungslos kapitulieren mussten.
Viel ist seit jeher über den „Mythos Stalingrad“ (Kumpfmüller 1995), die Ereignisse zwischen September 1942 und Februar 1943 publiziert worden, aus militärhistorischer Perspektive, aus Sicht einzelner Soldaten oder Offiziere, die den „Rattenkrieg“ (BI 9.10.42) von Stalingrad am eigenen Leibe erfahren hatten und natürlich aus belletristischer Sichtweise, die den heroisch verklärten Kampf der Infanterie in den Ruinen der Stadt häufig zum Ausgangspunkt nahm. Stellvertretend für die Fülle an Werken seien dabei an dieser Stelle lediglich Theodor Plieviers „Stalingrad“ aus dem Jahr 1946 oder gleichnamige Werke, etwa von Heinz Schröter 1954 sowie Guido Knopp 2002 genannt. Weitere als Grundlagenliteratur zur Thematik geltende, für vorliegende Arbeit zurate gezogene Quellen, werden stattdessen nachfolgend an geeigneten Stellen eingearbeitet.
Und dennoch hat es trotz jener Flut an Literatur bis zu diesem Zeitpunkt, in dem sich der Angriff auf Stalingrad zum 70. Mal jährt, nach meinem Kenntnisstand noch immer keinen Versuch gegeben, sich aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive, systematisch mit der Propagandanutzung der Schlacht von Stalingrad einerseits sowie ihrer Reichweite und Wirkung innerhalb der deutschen Bevölkerung andererseits auseinanderzusetzen.
...
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Operationalisierung
Stalingrad:
Untersuchungszeitraum:
1.2. Analysiertes Quellenmaterial
Zeitungen:
Reden:
Goebbels-Tagebücher:
Meldungen aus dem Reich:
Feldpostbriefe:
2. Analyse der Stalingrad-Propaganda
2.1. Die Rezeption der Schlacht von Stalingrad in der NS-Presse
2.2. Stalingrad in Reden der NS-Prominenz
Hitler-Rede vom 30. September 1942:
Hitler-Rede vom 8. November 1942:
Goebbels-Rede vom 30. Januar 1943:
Göring-Rede vom 30. Januar 1943:
Goebbels-Rede vom 18. Februar 1943:
2.3. Die Causa Stalingrad in den Goebbels Tagebüchern.
3. Die Wirkung der Stalingrad-Propaganda
3.1. Die SD-Berichte über die Schlacht von Stalingrad.
3.2. Feldpostbriefe über Stalingrad.
3.3. Fallbeispiel „Weiße Rose“
4. Schlussbetrachtung
4.1. Phasen der Stalingrad-Propaganda
Phase 1 - „Siegesgewissheit“:
Phase 2 - „beginnende Zweifel“:
Phase 3 - „das Verschweigen“
Phase 4 - das „Opfer von Stalingrad“:
4.2. Die tatsächliche Wirkung der Propaganda
4.3. Die Folgen der Niederlage
4.4. Fazit
4.5. Grenzen dieser Arbeit / weiterführende Fragen.
5. Literaturverzeichnis
5.1. Quellen
5.2. Sekundärliteratur
6. Selbstständigkeitserklärung
Häufig gestellte Fragen
Welche Phasen der Stalingrad-Propaganda gab es?
Die Propaganda durchlief vier Phasen: 1. Siegesgewissheit, 2. beginnende Zweifel, 3. Verschweigen der Lage und 4. die Stilisierung zum heroischen "Opfer von Stalingrad".
Wie reagierte die deutsche Bevölkerung auf die Niederlage?
SD-Berichte und Feldpostbriefe zeigen, dass die Propaganda an ihre Grenzen stieß und die Bevölkerung zunehmend an der Unbesiegbarkeit der Wehrmacht zweifelte.
Welche Rolle spielten die Goebbels-Tagebücher in dieser Analyse?
Sie dienen als Quelle, um die strategische Planung und die interne Wahrnehmung der Krise durch den Propagandaminister nachzuvollziehen.
Was war das Fallbeispiel „Weiße Rose“ im Kontext von Stalingrad?
Die Niederlage von Stalingrad war ein wichtiger Impuls für den Widerstand der Weißen Rose, die die Sinnlosigkeit des Krieges in ihren Flugblättern thematisierte.
War Stalingrad der Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs?
Militärisch und psychologisch gilt die Schlacht als entscheidender Wendepunkt, nach dem die Wehrmacht endgültig in die Defensive geriet.
Wie wurde Stalingrad in der NS-Presse dargestellt?
Zunächst als bevorstehender Sieg gefeiert, wurde der Kampf später zu einer schicksalhaften, heroischen Abwehrschlacht gegen den "Bolschewismus" umgedeutet.
- Quote paper
- Maik Kretschmar (Author), 2012, Die propagandistische Ausbeutung der Schlacht von Stalingrad und ihre Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204084