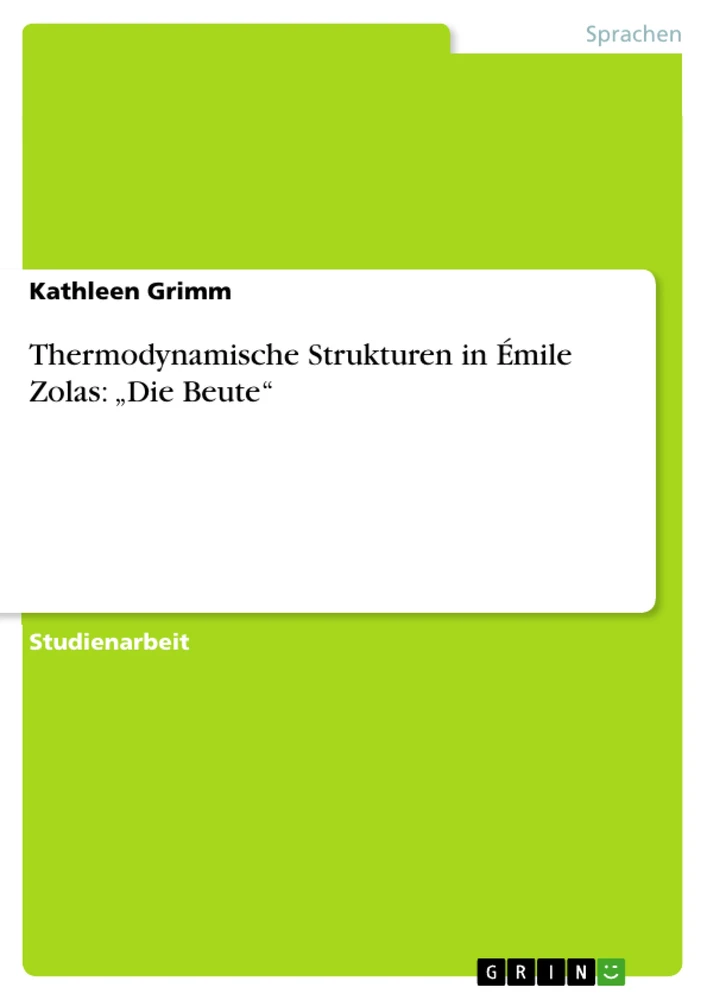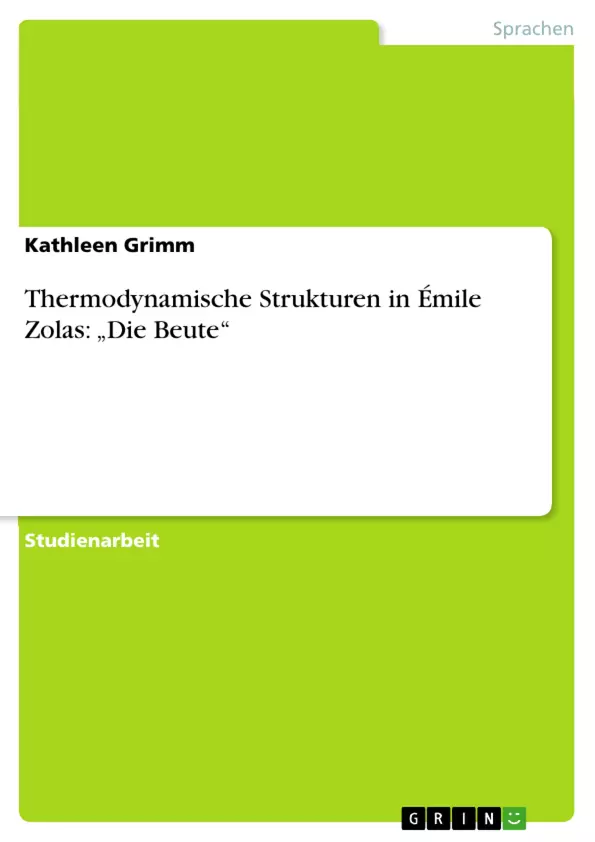Schon im Jahr 1868 legte Zola seinem Verleger Lacroix den ersten Entwurf seiner späteren Rougon-Macquart-Reihe vor. (...)
„Die Beute“ als zweiter Roman der Reihe hat als Rahmen die schmutzigen und zügellosen Spekulationen während der großangelegten Bauarbeiten in Paris, die Baron Haussmann, der 1853 von Napoleon III. eingesetzte Präfekt des Departements Seine, veranlasst hatte. Hauptpersonen sind ein typischer Vertreter der Spekulanten, Aristide Saccard, seine Frau Renée und sein Sohn aus erster Ehe, Maxim. Die Geschäfte und Spekulationen, die dargestellt werden, dienen in diesem Hinblick vor allem der Beschreibung des Milieus, in dem sich die Charakterentwicklung und das Verhalten von Renée und Maxime abspielen.
So gliedert sich auch „Die Beute“ in zwei Ebenen. Die erste Ebene, stellt das Liebesdrama zwischen Renée und Maxime dar. Die zweite Ebene, und vielleicht auch die spannendere, beschreibt den Aufstieg Saccards von einem kleinen städtischen Angestellten zu einem der erfolgreichsten Häuserspekulanten von Paris, dessen Vermögen unerschöpflich zu sein scheint. Die Geschäfte mit Toutin-Laroch, die Manipulationen mit dem Crédit Viticole sowie die Beziehungen der Aktionäre des Crédit Viticole zu den offiziellen Verwaltungs- und Regierungsstellen enthüllen die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zustände im zweiten Kaiserreich. So ist es auch nicht verwunderlich, das der Titel „Die Beute“ sich nicht auf die Zentralfigur -Renée - bezieht, sondern auf die Spekulanten, die sich gierig auf ihren ergaunerten Gewinn stürzen.
Im zweiten Punkt dieser Hausarbeit möchte ich knapp die Grundlage für die Anwendung von thermodynamischen Begriffen und Theorien an Zolas Roman „Die Beute“ darstellen.
In den folgenden Punkten möchte ich mich mit den zwei Ebenen des Romans, den zwischenmenschlichen Beziehungen sowie der Ebene der Spekulationen und Geldströme im Paris im zweiten Kaiserreich beschäftigen. Hier werde ich untersuchen, inwieweit sich die thermodynamischen Literaturtheorien auf den Text anwenden lassen, und welche Erkenntnis man daraus erlangt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Émile Zolas,,Rougon-Macquart\"-Reihe und „Die Beute".
- Thermodynamik als Literaturtheorie.
- Thermodynamische Aspekte in „Die Beute".
- Renée als „überhitze Maschine"
- Paris als offenes System
- Resümee
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die thermodynamischen Strukturen in Émile Zolas Roman „Die Beute" und analysiert, wie die Prinzipien der Thermodynamik im Kontext des Romans verwendet werden können, um die Charakterentwicklung, das soziale Milieu und die Handlung zu verstehen. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung thermodynamischer Konzepte, um die Funktionsweise des Romans als komplexes System zu beleuchten.
- Thermodynamische Prinzipien in der Literatur
- Die Rolle von Renée und Maxime im Roman
- Paris als offenes System und seine Auswirkungen auf die Charaktere
- Die Spekulanten und ihr Einfluss auf die soziale und wirtschaftliche Landschaft
- Der Dualismus zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt zunächst die „Rougon-Macquart"-Reihe und „Die Beute" als Teil dieser Reihe vor, wobei die naturwissenschaftlichen Einflüsse Zolas hervorgehoben werden. Dabei werden die Ziele der Reihe, die Vererbung, das Milieu und die Darstellung des zweiten Kaiserreichs, erläutert. Außerdem wird das Thema der Spekulationen im Kontext von Baron Haussmanns Bauarbeiten in Paris als Rahmen für die Handlung des Romans dargestellt.
Im zweiten Kapitel wird die Anwendung der Thermodynamik als Literaturtheorie erläutert. Die Entwicklung der Thermodynamik im industriellen Zeitalter und ihre Auswirkungen auf anthropologische Ansichten werden hervorgehoben. Dabei wird auch das Modell der Gleichgewichts-Thermodynamik als relevantes Konzept für die Analyse von offenen Systemen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Thermodynamik, Literaturtheorie, Émile Zola, „Die Beute", „Rougon-Macquart", Vererbung, Milieu, Spekulationen, Paris, Baron Haussmann, offenes System, Gleichgewichts-Thermodynamik, Dualismus, Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Anthropologie
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Émile Zolas Roman „Die Beute“?
Der Roman thematisiert die gierigen Spekulationen während der Umgestaltung von Paris unter Baron Haussmann im zweiten Kaiserreich sowie ein familiäres Liebesdrama.
Wie wird die Thermodynamik als Literaturtheorie angewendet?
Begriffe wie „Entropie“, „Energiefluss“ und „offene Systeme“ werden genutzt, um die Charakterentwicklung und die Dynamik der Pariser Gesellschaft als energetische Prozesse zu deuten.
Was symbolisiert die Figur Renée im thermodynamischen Kontext?
Renée wird als „überhitzte Maschine“ analysiert, deren emotionale und soziale Energie sich in einem geschlossenen, moralisch dekadenten Umfeld bis zur Zerstörung staut.
Warum wird Paris als „offenes System“ beschrieben?
Paris fungiert als System, in das ständig Kapital und Menschen hineinströmen, was zu hoher Instabilität, Spekulationsblasen und gesellschaftlichem Wandel führt.
Welche Rolle spielt die Vererbung in Zolas Werk?
Als Teil der Rougon-Macquart-Reihe zeigt der Roman, wie biologische Erbanlagen und das soziale Milieu das Schicksal der Charaktere determinieren.
- Arbeit zitieren
- Kathleen Grimm (Autor:in), 2010, Thermodynamische Strukturen in Émile Zolas: „Die Beute“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204175