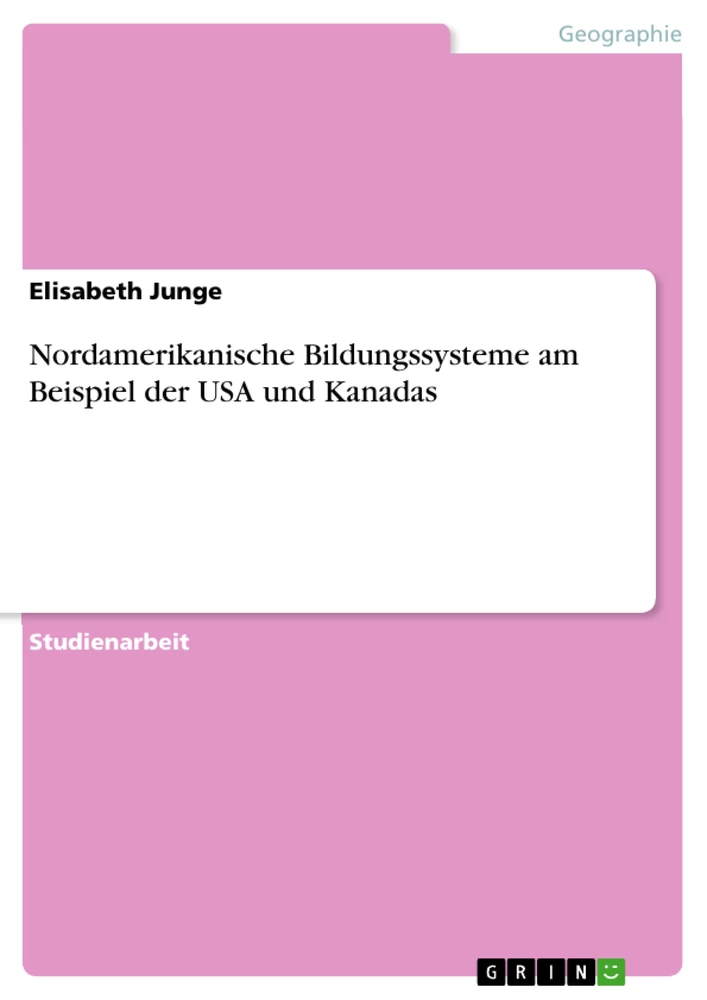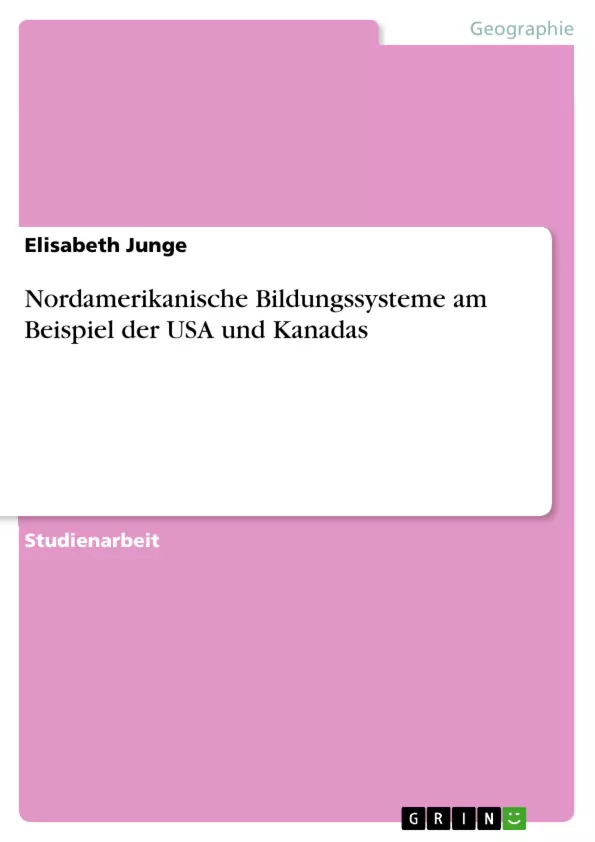In den vergangenen Jahren rücken verschiedene Vergleichstests innerhalb von Schulen, Bundesländern und auch zwischen mehreren Staaten immer mehr in den Vordergrund. So werden Schulvergleichsstudien wie PISA, TIMSS und IGLU nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf internationaler Ebene durchgeführt. Die Ergebnisse werden jedes Jahr gespannt erwartet und publiziert. Regelmäßig wiederkehrend finden dann Diskussionen über die unterschiedlichen Vor- und Nachteile im Bildungssystem der einzelnen Staaten statt. Der Konkurrenzkampf, der auf diese Art und Weise zwischen den teilnehmenden Staaten losgetreten wird, führt zu Diskussionen in der Politik und zu unzähligen weiteren Studien und Änderungsvorschlägen im Bildungsbereich.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit nordamerikanischen Bildungssystemen. Im Vordergrund stehen dabei das sekundare und postsekundare Bildungssystem der USA und Kanadas. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit findet somit eine eingehende Beschäftigung mit den einzelnen „high school“-Typen der einzelnen Länder statt. Im Anschluss daran wird das Universitätswesen der USA und Kanadas betrachtet. Hier wird auch immer wieder Bezug auf die Unterschiede zum deutschen Hochschulbereich genommen. Ziel der Arbeit ist es die unterschiedlichen Bereiche in beiden Ländern eingehend zu durchleuchten und vor allem (v.a.) den strukturellen Aufbau darzustellen. Neben den Zuständigkeiten der einzelnen Bildungsbereiche wird immer wieder auf die eventuell herrschende Flexibilität innerhalb dieser Systeme Bezug genommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sekundares Bildungssystem
- USA
- Allgemeines zum Sekundarschulbereich
- 4-year High Schools
- Junior High Schools und Senior High Schools
- Combined Junior-Senior High Schools
- Kanada
- Allgemeines zum Sekundarschulbereich
- Junior High Schools
- Senior High Schools
- USA
- Postsekundares Bildungssystem
- USA
- Allgemeines zum College
- Allgemeines zur Universität
- Eingangsvoraussetzungen zum Hochschulstudium
- Organisation der Hochschulen
- Finanzierung der Universitäten
- Kanada
- Allgemeines zum College
- Allgemeines zur Universität
- Eingangsvoraussetzungen zum Hochschulstudium
- Organisation der Hochschulen
- Finanzierung der Universitäten
- USA
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sekundären und postsekundären Bildungssysteme der USA und Kanadas, um deren strukturellen Aufbau und Unterschiede zum deutschen System aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der verschiedenen Schul- und Hochschulformen sowie der Zuständigkeiten und Flexibilität innerhalb der Systeme.
- Vergleich des sekundären Bildungssystems der USA und Kanadas
- Analyse verschiedener High-School-Typen in den USA
- Untersuchung des Universitätswesens in den USA und Kanada
- Vergleich der Hochschulsysteme mit dem deutschen System
- Darstellung der Finanzierung und Organisation von Hochschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit im Hinblick auf internationale Schulvergleichsstudien und den daraus resultierenden Diskussionen über Bildungssysteme. Sie führt in die Thematik der nordamerikanischen Bildungssysteme ein und benennt den Fokus auf das sekundäre und postsekundäre Bildungssystem der USA und Kanadas. Die Arbeit zielt darauf ab, die strukturellen Unterschiede und die Flexibilität innerhalb der Systeme zu beleuchten.
Sekundares Bildungssystem: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das sekundäre Bildungssystem der USA und Kanadas. Es werden die verschiedenen High-School-Typen in den USA detailliert beschrieben und verglichen, wobei der Kindergarten, die Vorschule und der primäre Bildungsbereich, sowie der Bereich für Schüler mit speziellem Förderbedarf, ausgelassen werden. Der Fokus liegt auf der Struktur und den verschiedenen Schulformen, ohne auf die inner-schulischen Differenzierungsformen einzugehen.
2.1 USA: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf das sekundäre Bildungssystem der USA und präsentiert eine Grafik, die das Bildungssystem von der Kleinkinderschule bis zur High School darstellt. Er beschreibt die verschiedenen Arten von High Schools, darunter 4-year High Schools, Junior High Schools, Senior High Schools und Combined Junior-Senior High Schools. Der Abschnitt betont die unterschiedlichen Typen wie „academic“, „vocational“ und „technical“ sowie die „Comprehensive High School“, die alle Typen vereint. Die Ausführungen basieren auf den Arbeiten von Reimann (1970) und Buttlar (1992).
Schlüsselwörter
Nordamerikanische Bildungssysteme, USA, Kanada, Sekundarschulsystem, Postsekundarschulsystem, High Schools, Colleges, Universitäten, Schulstrukturen, Hochschulstrukturen, Bildungsfinanzierung, Bildungsvergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Nordamerikanische Bildungssysteme - USA und Kanada
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die sekundären und postsekundären Bildungssysteme der USA und Kanadas. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem strukturellen Aufbau der Systeme und den Unterschieden zum deutschen System.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das sekundäre Bildungssystem (mit detaillierter Betrachtung verschiedener High-School-Typen in den USA), das postsekundäre Bildungssystem (Colleges und Universitäten in den USA und Kanada), die Organisation und Finanzierung von Hochschulen, sowie einen Vergleich der nordamerikanischen Systeme mit dem deutschen System. Die Kindergarten-, Vorschul- und Grundschulstufen sowie der Bereich für Schüler mit speziellem Förderbedarf werden nicht behandelt.
Welche Länder werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf die USA und Kanada. Das deutsche Bildungssystem dient als Referenzpunkt für den Vergleich.
Welche Arten von High Schools werden in den USA beschrieben?
Das Dokument beschreibt 4-year High Schools, Junior High Schools, Senior High Schools und Combined Junior-Senior High Schools. Es werden auch die Unterschiede zwischen „academic“, „vocational“, „technical“ und „Comprehensive High Schools“ erläutert.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in mehrere Abschnitte unterteilt: Einleitung, Sekundares Bildungssystem (mit Unterabschnitten zu USA und Kanada), Postsekundäres Bildungssystem (mit Unterabschnitten zu USA und Kanada), Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die Struktur.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Zusammenfassung des Kapitels zu den USA im sekundären Bildungssystem nennt explizit die Arbeiten von Reimann (1970) und Buttlar (1992) als Quellen. Weitere Quellen werden im Dokument nicht explizit benannt.
Welche Aspekte der Hochschulsysteme werden untersucht?
Die Untersuchung der Hochschulsysteme umfasst Eingangsvoraussetzungen, Organisation der Hochschulen und die Finanzierung der Universitäten in den USA und Kanada.
Für wen ist dieses Dokument bestimmt?
Das Dokument ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Bildungssystemen. Es eignet sich für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für einen Vergleich der nordamerikanischen und deutschen Bildungssysteme interessieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Nordamerikanische Bildungssysteme, USA, Kanada, Sekundarschulsystem, Postsekundarschulsystem, High Schools, Colleges, Universitäten, Schulstrukturen, Hochschulstrukturen, Bildungsfinanzierung, Bildungsvergleich.
- Citation du texte
- Elisabeth Junge (Auteur), 2011, Nordamerikanische Bildungssysteme am Beispiel der USA und Kanadas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204184