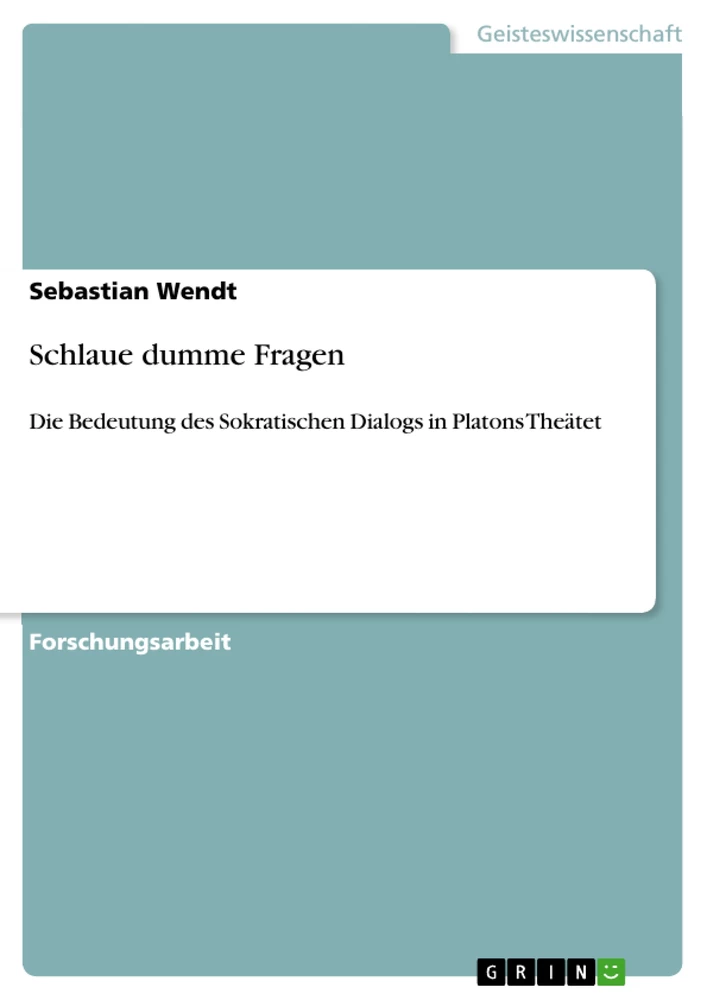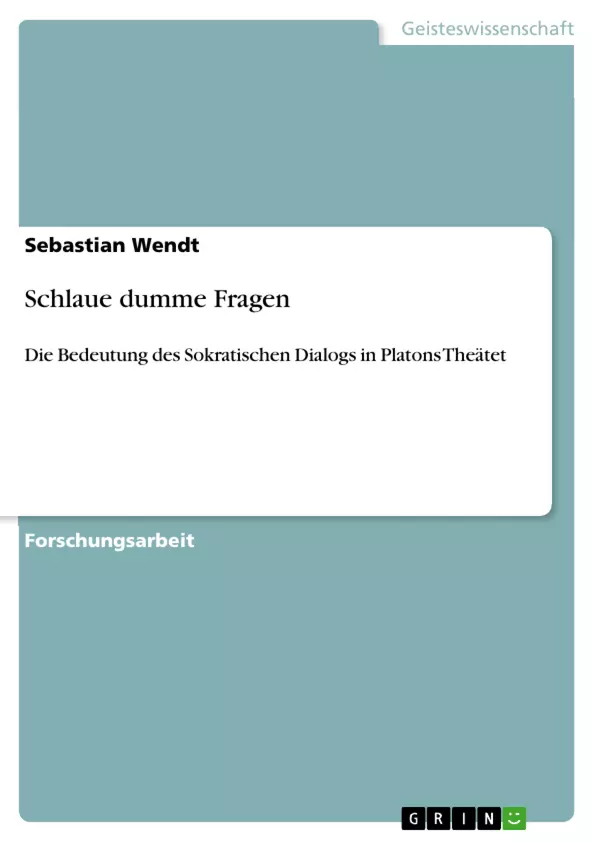Der – bei weitem nicht nur in der Philosophie bekannte – Sokratische Dialog scheint momentan Hochkonjunktur zu haben: Er ist zu einem bewährten Mittel der psychotherapeutischen Praxis geworden, findet Anwendung im schulischen und universitären Unterricht und ist eine anerkannte Weiterbildungsmaßnahme für erfolgreiche Gesprächstechniken von Fach- und Führungskräften. Die vorliegende Forschungsarbeit analysiert den literarischen Charakter von Platons Theätet und arbeitet auf dieser Grundlage die Bedeutung einer "dialogischen Philosophie" heraus. Diese Herangehensweise schafft einen völlig anderen, bisher weitgehend vernachlässigten Zugang zu Platons Meisterwerk.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Unsokratischer Sokratischer Dialog
- Thematik und Methodik
- Textanalyse
- Ein Text unter vielen – Intertextuelle Betrachtung des „Theätet“
- Das Sokratische Gespräch – Intratextuelle Textanalyse
- Setting
- Phasencharakter
- Ein Spiel mit offenen Karten – Das Metagespräch
- Der Gesprächsleiter – Steuermann und Navigator
- „Schlaue dumme Fragen“ – Die Frage als Methode
- Dialogische Philosophie bei Platon – Ein extratextuelles Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des sokratischen Dialogs in Platons „Theätet“, wobei der Fokus auf dem literarischen Charakter des Werkes liegt. Es geht weniger um die im Gespräch gefundenen Lösungen, sondern vielmehr um die Analyse des Dialogs als Methode und Form. Die Arbeit verbindet intra-, inter- und extratextuelle Perspektiven, um ein umfassenderes Verständnis der platonischen Philosophie zu ermöglichen.
- Der sokratische Dialog als literarische Form und seine Charakteristika
- Die Analyse des Dialogs in Platons „Theätet“ aus verschiedenen Perspektiven (intra-, inter-, extratextuell)
- Die Bedeutung der Fragetechnik im sokratischen Dialog
- Der Vergleich des platonischen Dialogs mit dem klassischen griechischen Drama
- Die Rolle Platons als Autor und die historische Kontextualisierung des „Theätet“
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung beleuchtet die weitverbreitete Anwendung des sokratischen Dialogs in verschiedenen Bereichen, von der Psychotherapie bis zur Weiterbildung. Sie betont jedoch, dass die heutige Form des sokratischen Dialogs eine Modifikation des antiken Originals darstellt, welches uns durch Platon überliefert wurde. Die Arbeit von Weierstraß, Nelson und Heckmann wird hervorgehoben, die die „Sokrates-Technik“ für die moderne Praxis adaptierten. Die Einführung stellt die Frage nach dem Verhältnis der modernen Form zum historischen Sokrates und weist auf die Problematik der Interpretation von Platons Werken als literarische Darstellungen, nicht als faktische Biographien, hin. Die literarische Qualität der platonischen Dialoge wird betont, wobei der Vergleich mit dem Dramendreieck von Gustav Freytag die strukturelle Ähnlichkeit verdeutlicht.
Textanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die drei Ebenen der Textanalyse: extratextuell (historischer Kontext), intratextuell (fiktive Welt des Textes) und intertextuell (Vergleich mit anderen Texten). Es wird die Bedeutung der Trennung dieser Ebenen für ein umfassendes Verständnis des „Theätet“ betont. Die extratextuelle Ebene betrachtet Platon als Autor und Sokrates als historischen Hintergrund. Die intratextuelle Ebene fokussiert auf die Figuren und ihre Interaktionen im Dialog, während die intertextuelle Perspektive den „Theätet“ als Text im Kontext anderer literarischer Werke betrachtet, besonders im Bezug auf das klassische griechische Drama. Das Kapitel betont die Gefahr, diese Ebenen zu vermischen und die daraus resultierende Verzerrung der Gesamtaussage.
Schlüsselwörter
Sokratischer Dialog, Platon, Theätet, Textanalyse, Intertextualität, Intratextualität, Extratextualität, Dialogische Philosophie, literarische Form, Fragetechnik, griechisches Drama, Erkenntnisgewinnung.
Platons „Theätet“: Häufige Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den sokratischen Dialog in Platons „Theätet“, wobei der Fokus auf dem literarischen Charakter des Werkes liegt. Es geht nicht primär um die im Gespräch gefundenen Lösungen, sondern um die Untersuchung des Dialogs als Methode und Form. Die Analyse verbindet intra-, inter- und extratextuelle Perspektiven für ein umfassenderes Verständnis der platonischen Philosophie.
Welche Methoden werden in der Analyse verwendet?
Die Arbeit nutzt eine dreistufige Textanalyse: Intratextuell (Analyse des Dialogs selbst, Figuren, Interaktionen), intertextuell (Vergleich mit anderen Texten, insbesondere dem griechischen Drama) und extratextuell (historischer Kontext, Platon als Autor, Sokrates als historische Figur). Die Trennung dieser Ebenen ist zentral für ein unverzerrtes Verständnis.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt den sokratischen Dialog als literarische Form, die Charakteristika dieses Dialogs, die Fragetechnik als Methode, den Vergleich mit dem klassischen griechischen Drama, Platons Rolle als Autor und die historische Kontextualisierung des „Theätet“. Sie beleuchtet auch die Unterschiede zwischen dem antiken sokratischen Dialog und modernen Adaptionen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, eine Textanalyse und ein extratextuelles Fazit. Die Einführung behandelt den sokratischen Dialog im Allgemeinen und seine Adaption in der Moderne. Die Textanalyse konzentriert sich auf die drei Ebenen der Textanalyse (intra-, inter-, extratextuell) und deren Bedeutung für das Verständnis des „Theätet“. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und bietet eine umfassende Perspektive auf die dialogische Philosophie Platons.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Sokratischer Dialog, Platon, Theätet, Textanalyse, Intertextualität, Intratextualität, Extratextualität, Dialogische Philosophie, literarische Form, Fragetechnik, griechisches Drama, Erkenntnisgewinnung.
Welche Werke werden im Zusammenhang mit dem „Theätet“ betrachtet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Werke von Weierstraß, Nelson und Heckmann bezüglich der modernen Adaption der „Sokrates-Technik“. Der Vergleich mit dem klassischen griechischen Drama spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in der intertextuellen Analyse.
Welchen Stellenwert hat der historische Kontext?
Der historische Kontext spielt eine wichtige Rolle in der extratextuellen Analyse. Die Arbeit betrachtet Platon als Autor und Sokrates als historischen Hintergrund, um das Verständnis des „Theätet“ zu erweitern und die Arbeit im historischen Kontext zu verorten.
- Quote paper
- Sebastian Wendt (Author), 2012, Schlaue dumme Fragen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204199