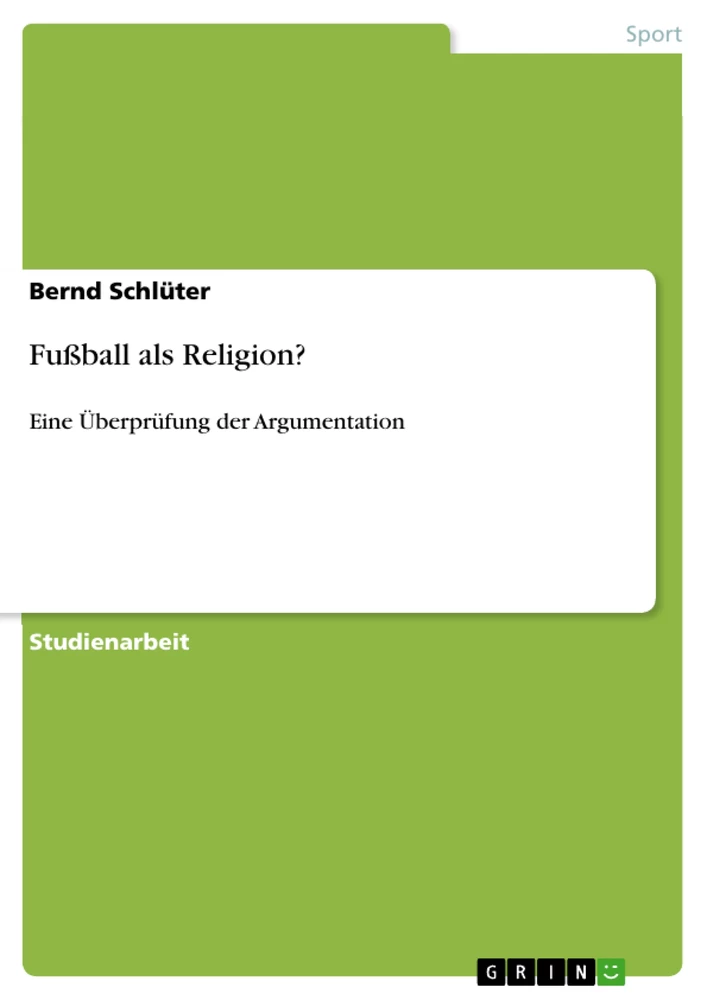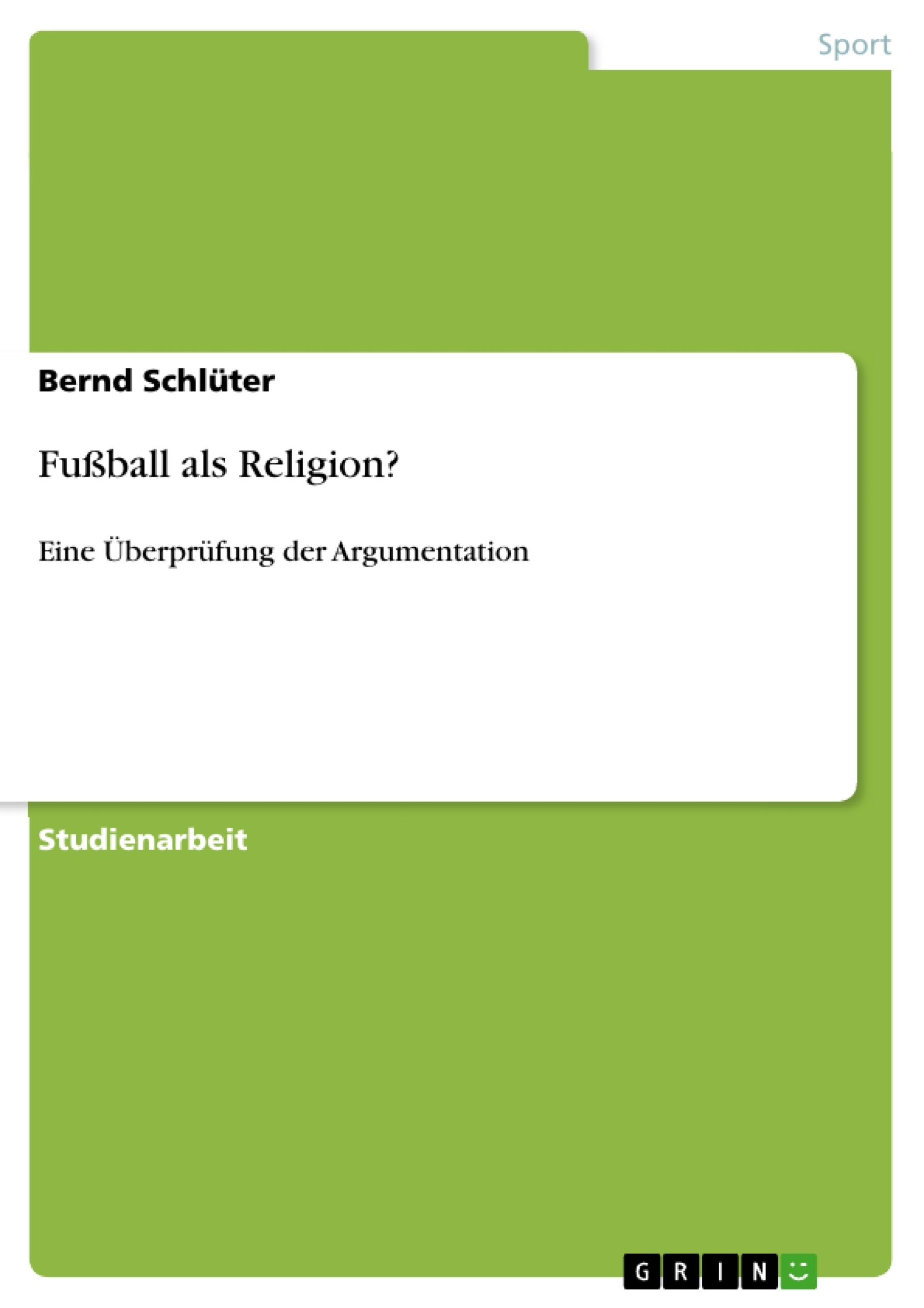„Der FCB ist meine Religion“, „Schalke Unser“ und „Heiliger Rasen“: Von sakralen Begriffen geprägte Gesänge und Anfeuerungen, die nicht in den Stadien der deutschen Fußball-Bundesliga typisch sind, sondern auch in den Medien: So wurde Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß gerade erst am 26. September 2011 in der Talkshow des SWR Fernsehens von Moderator Frank Elstner als „Fußballgott“ tituliert. Der Fan ist im heutigen Sprachgebrauch ein „begeisterter Anhänger“ (Duden 2001: 204). Die Bezeichnung stammt ab vom lateinischen fanaticus, ein Sakralwort, das ursprünglich „von der Gottheit ergriffen und in rasende Begeisterung versetzt“ bedeutete (ebd.). Und die Liebe zum Verein kann sogar über das Leben auf Erden hinausgehen: In Hamburg wurde 2008 neben der Arena ein HSV-Friedhof eröffnet. An Kirche dürften Besucher kaum denken, wenn sie das Gelände betreten: Die Anlage ist einem Stadion nachempfunden, das Gras ist Originalrasen aus dem Stadion und am Eingang müssen Trauernde zunächst durch ein Fußballtor schreiten (focus online 02.11.2008).
Ist Fußball eine Religion? Oder dient dieser Sport zumindest als Religionsersatz, indem er eine religionsähnliche Funktion für die Gesellschaft hat? Etliche Sozialwissenschaftler haben sich seit den 1970er Jahren1, vor allem aber ab Ende der 1990er Jahre mit diesen Fragen beschäftigt und sollen in ihrer Argumentation durch diese Hausarbeit zum Seminar „Im Spiegel der Gegenwart – Soziologie um die Jahrhundertwende“ noch einmal überprüft werden. Grundlage des Vergleichs von Fußball und Religion ist meist das Werk „Die elementaren Formen des religiösen Lebens“ von Émile Durkheim aus dem Jahr 1912, das heutzutage als ein Fundament der Religionssoziologie zu bewerten ist (u.a. Knoblauch 1999: 58, Pickel 2011: 75). Der Autor hat hier der Religion eine Funktion zugeschrieben: Sie dient dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und der Entwicklung kollektiver Identität.
Durkheim prägt in seinen Ausführungen Begriffe wie Clan, Totem, Glaubensvorstellung und Ritus2. Seine Beschreibungen sollen in dieser Arbeit mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen über häufig ritualisierte Abläufe in Fußballstadien verglichen werden. Dazu muss zunächst Religion definiert und dann Durkheims Theorie genauer dargestellt werden, ehe im weiteren Verlauf der Arbeit Erkenntnisse diverser Sozialwissenschaftler in die Diskussion einfließen können. Abschließend wird dann ein eigenes Fazit gezogen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Definition von Religion
3. Durkheims „Die elementaren Formen des religiösen Lebens“
3.1 Trennung der Welt in heilig und profan
3.2 Überzeugungen und Praktiken im Totemismus
3.3 Unterteilung der Riten in „negativen Kult“ und „positiven Kult“
4. Ritual aus Sicht der Wissenschaft
5. Rituale im Fußball: Analogien zu Religion
5.1 Verehrung des Vereinswappens als Totem
5.2 Das Stadion als „heilige Stätte“
5.3 Spielplan und Match-Ablauf als zyklische Lebens-Ordnung
5.4 Anfeuerungen, Gesänge und Choreografien als Götter-Beschwörung
5.5 Prozess der Aufnahme in die Fan-Gruppe als Initiationsritual
5.6 Verehrung von Vereins-Ikonen als Urahnen und Zivilisationshelden
5.7 Bengalische Feuer als Opfergabe
6. Diskussion der Ritual-Analogien
7. Schlussfolgerungen
8. Fazit
Literaturverzeichnis
Internet-Quellen
Häufig gestellte Fragen
Kann Fußball als Religion bezeichnet werden?
Sozialwissenschaftler untersuchen, ob Fußball eine religionsähnliche Funktion (Religionsersatz) erfüllt, indem er Identität stiftet und Gemeinschaft zusammenhält.
Welche Rolle spielt Émile Durkheim in dieser Analyse?
Durkheims Werk über die „elementaren Formen des religiösen Lebens“ dient als Basis, um Begriffe wie Ritus, Totem und die Trennung von Heiligem und Profanem auf den Fußball zu übertragen.
Was sind Beispiele für religiöse Analogien im Fußball?
Das Stadion wird als „heilige Stätte“ gesehen, Vereinswappen als Totems verehrt und Gesänge sowie Choreografien ähneln gottesdienstlichen Riten.
Was ist ein Initiationsritual im Fußball?
Der Prozess der Aufnahme in eine Fangruppe wird oft als solches Ritual betrachtet, das den Übergang in eine neue soziale Identität markiert.
Was bedeutet „Heilig“ und „Profan“ im Stadion?
Die Trennung zeigt sich darin, dass der Spieltag und der Stadionbesuch aus dem gewöhnlichen Alltag (profan) herausgehoben und sakral überhöht werden.
- Citar trabajo
- Bernd Schlüter (Autor), 2011, Fußball als Religion?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204254