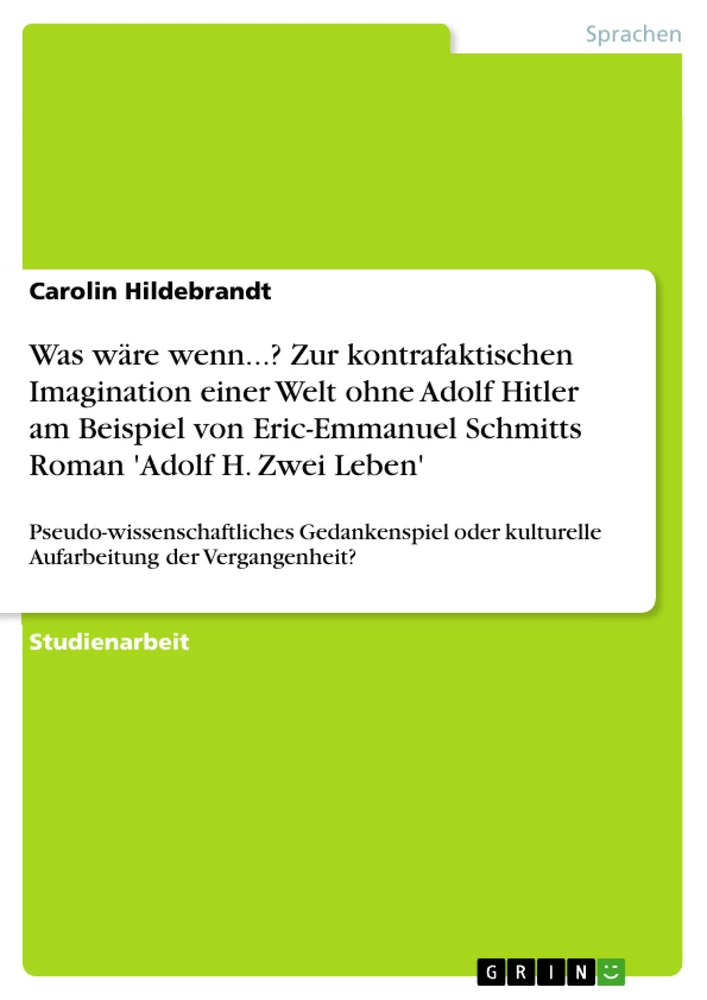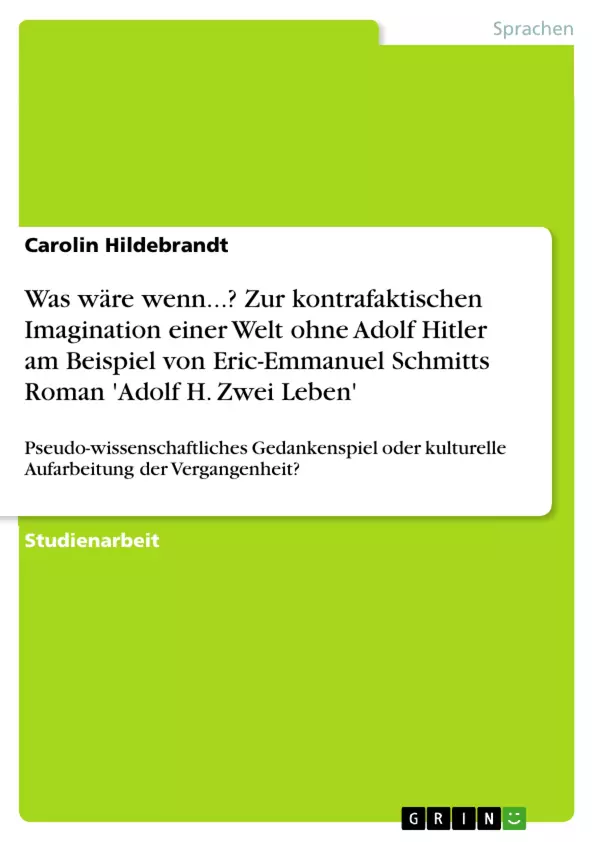Wenn in diesem Moment nicht diese Zeilen verfasst würden, dann hätte dieser spezielle Umstand vermutlich keine entscheidenden Auswirkungen auf das Weltgeschehen. Oder vielleicht doch? Die versteckte Offenheit der Historie stellt den Menschen immer wieder aufs Neue vor ein unlösbares Gefühl der Ungewissheit. Gerne wähnt er sich im sicheren Raum der Absehbarkeit und vor allem der Abgeschlossenheit dessen, was er ‚Geschichte‘ zu nennen gelernt hat. Das kontrafaktische Denken erschüttert diese trügerische Sekurität in ihren Grundmauern, indem es gezielte Stellen im scheinbar linearen Verlauf von der Vergangenheit bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Frage stellt und dadurch aufzeigt, dass die chronologische Geschichtsschreibung keineswegs nur so und nicht anders verlaufen konnte, wie wir sie heute kennen und interpretieren, sondern, dass vielmehr eine unendliche Zahl von Alternativen zur Verfügung standen, die, teilweise nur bedingt durch einen seltsamen Zufall, eben nicht in die Dimension der Realität eingetreten sind. Obgleich zweifelsohne eine grundsätzliche Abneigung gegenüber (de-)konstrukti-vistischer Überlegungen eines kontrafaktischen Geschichts-verlaufes existiert , ihre Bemühungen oft als „müßiges Gedankenspiel, als unseriöse Spekulation“ deklassiert werden, erkennt man mittlerweile sogar einen Trend zur Achronie - und zwar sowohl in historisch-wissenschaftlichen Werken, wie auch in literarischen Kreisen .
Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, die kontrafaktische Narration als literarisches Genre zum einen und als historisches Phänomen einer Gedächtniskultur zum anderen zu analysieren. Weiterhin wird die Frage nach der Bedeutung beziehungsweise nach dem Erkenntnispotential des Kontrafaktischen fokussiert. Hierfür bedarf es zunächst einer ausführlichen Begriffsklärung, die unter Punkt (2) versuchen wird, das schier grenzenlose Feld der Historie(-nschreibung) im hier gegebenen Rahmen zweckdienlich zu erfassen. Zur gezielten Anwendung im literaturwissenschaftlichen Kontext wird der Roman Adolf H. - Zwei Leben von Eric-Emmanuel Schmitt im Fokus der Betrachtungen stehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
oder: Was wäre, wenn diese Arbeit ungeschrieben bliebe?
2. Die Bedeutung(s-losigkeit) der kontrafaktischen Geschichte
oder: Fakten, Fakten, Fakten im Alternativspiel des Weltgeschehens
2.1 Das Wesen des Kontrafaktischen
2.2 Von Ereignis und Struktur
2.3 Exkurs: The Butterfly Effect
3. Zu Eric-Emmanuel Schmitts „Adolf H. - Zwei Leben“
oder: Die ‚Führer‘-lose Welt führt uns hinter den Mond
3.1 Dualistische Struktur und Doppelgesicht
3.2 Vorstrukturiertheit oder Singularität?
3.3 Realitätspotential?
3.4 Erkenntnis oder Entertainment?
4. Schlusswort
oder: Was wäre, wenn diese Arbeit ungeschrieben blieben wäre?
5. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist kontrafaktisches Denken?
Es ist das gedankliche Durchspielen von Alternativen zur tatsächlichen Geschichte (Was wäre wenn...?), um die Offenheit historischer Verläufe aufzuzeigen.
Worum geht es in Eric-Emmanuel Schmitts Roman „Adolf H. - Zwei Leben“?
Der Roman entwirft zwei parallele Lebensläufe: den des realen Adolf Hitler und den eines fiktiven Adolf H., der an der Kunstakademie angenommen wurde.
Welches Erkenntnispotential bietet die kontrafaktische Narration?
Sie hilft zu verstehen, welche Rolle Zufälle und individuelle Entscheidungen in der Geschichte spielen und hinterfragt die Unausweichlichkeit historischer Ereignisse.
Was versteht man unter dem „Butterfly Effect“ in der Geschichte?
Die Vorstellung, dass kleine, unscheinbare Ereignisse (wie eine abgelehnte Bewerbung) massive, weltverändernde Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Historie haben können.
Ist kontrafaktische Geschichte wissenschaftlich anerkannt?
Obwohl oft als Spekulation kritisiert, gibt es in der modernen Geschichtswissenschaft und Literatur einen Trend, kontrafaktische Szenarien als Analysewerkzeug zu nutzen.
- Quote paper
- Carolin Hildebrandt (Author), 2012, Was wäre wenn...? Zur kontrafaktischen Imagination einer Welt ohne Adolf Hitler am Beispiel von Eric-Emmanuel Schmitts Roman 'Adolf H. Zwei Leben', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204316