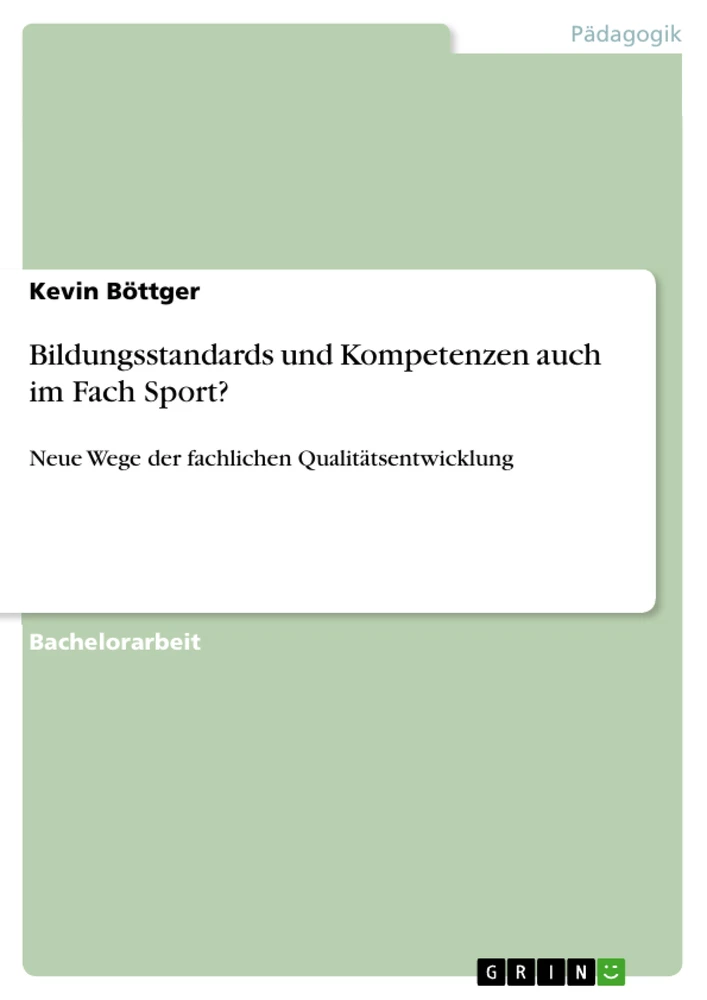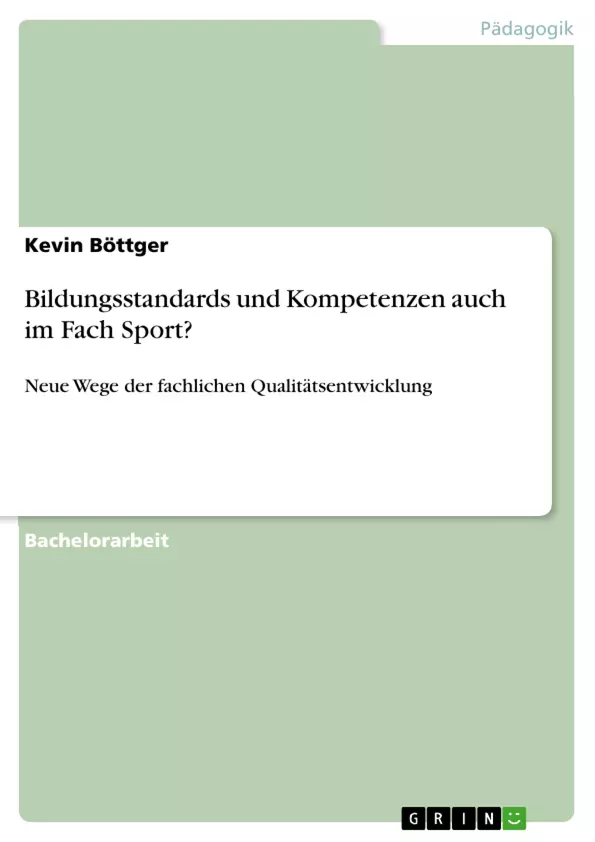Betrachtet man die Entwicklung der vergangenen Jahre, so erkennt man eine Art Paradigmenwechsel im deutschen Schulwesen (Franke, 2008, S.9). Bis in die 1990er Jahre dominierte die Inputsteuerung im Bildungssystem, wobei sich Lehrpläne hauptsächlich auf Inhalte bezogen. Nun geht der Trend zur Outputsteuerung, einem ergebnisorientierten Unterricht. Spätestens seit den großen internationalen Vergleichsstudien TIMSS und PISA sind die Qualitätsverbesserung und -sicherung eins der wichtigsten Themen im deutschen Bildungswesen geworden (Köller, 2007, S.13). Das schlechte Abschneiden machte den Handlungsbedarf aus Sicht der Schulpolitiker mehr als deutlich, so dass als Folge dessen die Bildungsstandards eingeführt wurden „[…], die auf einem theoretisch fixierten, operationalisierbaren und empirisch zu überprüfenden Kompetenzmodell basieren“ (Gogoll, 2009, S.49). Grundlage für die neue Steuerung bildet die Expertise „Zur Entwicklung von Bil-dungsstandards“ aus dem Jahr 2003, die im Auftrag der Bundesregierung und der Kultusministerkonferenz (KMK) innerhalb von nur fünf Monaten erarbeitet wurde. Mit dieser sollte ein grundlegender Wandel zur Verbesserung des Bildungssystems eingeleitet werden, zugleich entstand damit aber auch eines der meist diskutiertesten Themen in der Schuldidaktik und Bildung (Kurz & Gogoll, 2010, S.228 f.; Schierz & Thiele, 2004, S.53).
Standards kennt man ursprünglich aus der Produktion und Wirtschaft. Sie geben Maßstäbe an, bzw. ein einheitliches Muster vor (Ruhloff, 2007, S.48). Ein solcher Transfer auf die Bildung wird von vielen kritisch gesehen und die Ökonomisierung stark hinterfragt, da Standardisierung nicht unbedingt mit Qualität einhergeht (ebenda, S.51). Die Effektivität des Unterrichts soll durch Zielsetzungen gesteigert werden. Es erscheint hierbei jedoch schwierig, die Erwartungen und Interessen von allen Beteiligten Institutionen und Personen auf einen Nenner zu bringen und mit einem einzigen Instrument zu kontrollieren (Herrmann, 2003, S.625-627).
Externe Evaluationen und die daraus entstandenen Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz sind als Fortschritt nicht unumstritten und werden in Anbetracht des vernachlässigten Erziehungs- und Bildungsauftrag hinterfragt. Insgesamt wird jedoch daran festgehalten, dass sie die Zukunft der Qualitätssteuerung sind - auch für nicht getestete Fächer und Themengebiete bei PISA (Menz & Reuter, 2009, S.147)...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Trend der Standardisierung im Bildungswesen
- Schulentwicklung nach 2000
- Bildungsstandards als neues Qualitätsinstrument
- Von der Outputsteuerung zu den Bildungsstandards
- Neujustierung der Bildungserwartungen anhand von Kompetenzen
- Die Bildungsstandards sind da – und nun?
- Bildungsstandards im Fach Sport
- Fachpolitische Ansätze
- Fachwissenschaftlicher Diskurs
- Chancen
- Risiken und Probleme
- Kompetenzmodelle
- Zusammenfassung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Bildungsstandards als neue Wege der fachlichen Qualitätsentwicklung für das Fach Sport in Frage kommen und welche aktuellen Standpunkte dazu vertreten werden. Hierfür wird zunächst der allgemeine Trend im Bildungswesen beleuchtet und die Bildungsstandards als neues Qualitätsinstrument vorgestellt. Im Anschluss werden Chancen, Risiken und Probleme der Standardisierung im Fach Sport diskutiert sowie die Entwicklung von Modellen für das Fach Sport genauer betrachtet. Abschließend wird ein Ausblick darauf gegeben, in welche Richtungen sich der Schulsport mit dem neuen Qualitätsinstrument "Bildungsstandards" entwickeln könnte und welche Perspektiven und Notwendigkeiten sich daraus ergeben.
- Der Trend zur Standardisierung im Bildungswesen
- Bildungsstandards als neues Qualitätsinstrument
- Chancen und Risiken der Standardisierung im Fach Sport
- Entwicklung von Kompetenzmodellen für das Fach Sport
- Perspektiven und Notwendigkeiten der Schulsportentwicklung im Kontext der Bildungsstandards
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Trend zur Outputsteuerung im deutschen Bildungswesen beschreibt und die Einführung von Bildungsstandards als Folge des schlechten Abschneidens in internationalen Vergleichsstudien wie TIMSS und PISA einordnet. Kapitel 2 widmet sich der Standardisierung im Bildungswesen im Allgemeinen, beleuchtet die Schulentwicklung nach 2000 und erklärt die Funktionsweise von Bildungsstandards als Instrument zur Qualitätssicherung. Dabei werden die Neujustierung der Bildungserwartungen anhand von Kompetenzen und die Operationalisierung der Bildungsstandards durch Kompetenzmodelle erläutert. Kapitel 3 fokussiert auf die Bildungsstandards im Fach Sport und unterscheidet zwischen fachpolitischen und fachwissenschaftlichen Ansätzen. Die Chancen und Risiken der Standardisierung im Fach Sport werden analysiert, wobei insbesondere die Problematik der Operationalisierung des Doppelauftrages (Erziehung zum und durch Sport) im Mittelpunkt steht. Abschließend werden unterschiedliche Kompetenzmodelle für das Fach Sport diskutiert, die sich auf verschiedene Bereiche des Bildungsauftrages fokussieren. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Schulsport im Kontext der Bildungsstandards.
Schlüsselwörter
Bildungsstandards, Standardisierung, Outputsteuerung, Kompetenzmodell, Sportunterricht, Qualitätsentwicklung, Doppelauftrag, Bewegungskompetenz, Schulsportentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurden Bildungsstandards im Fach Sport eingeführt?
Die Einführung ist Teil eines Paradigmenwechsels hin zur Outputsteuerung, ausgelöst durch das schlechte Abschneiden Deutschlands in PISA-Studien.
Was ist der Unterschied zwischen Input- und Outputsteuerung?
Inputsteuerung fokussiert auf Lehrplaninhalte; Outputsteuerung konzentriert sich auf die messbaren Ergebnisse und Kompetenzen, die Schüler am Ende erreichen.
Welche Risiken birgt die Standardisierung für den Sportunterricht?
Kritiker befürchten eine Ökonomisierung der Bildung und Schwierigkeiten bei der Messung des pädagogischen „Doppelauftrags“ (Erziehung zum und durch Sport).
Was versteht man unter dem Kompetenzmodell im Sport?
Es handelt sich um theoretische Modelle, die sportliche Leistungen und pädagogische Ziele in überprüfbare Teilkompetenzen zerlegen.
Sind Bildungsstandards für die Qualitätssicherung notwendig?
Obwohl umstritten, gelten sie als zentrales Instrument der zukünftigen Qualitätssteuerung zur Sicherung einheitlicher Bildungsziele.
- Quote paper
- Kevin Böttger (Author), 2012, Bildungsstandards und Kompetenzen auch im Fach Sport?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204321