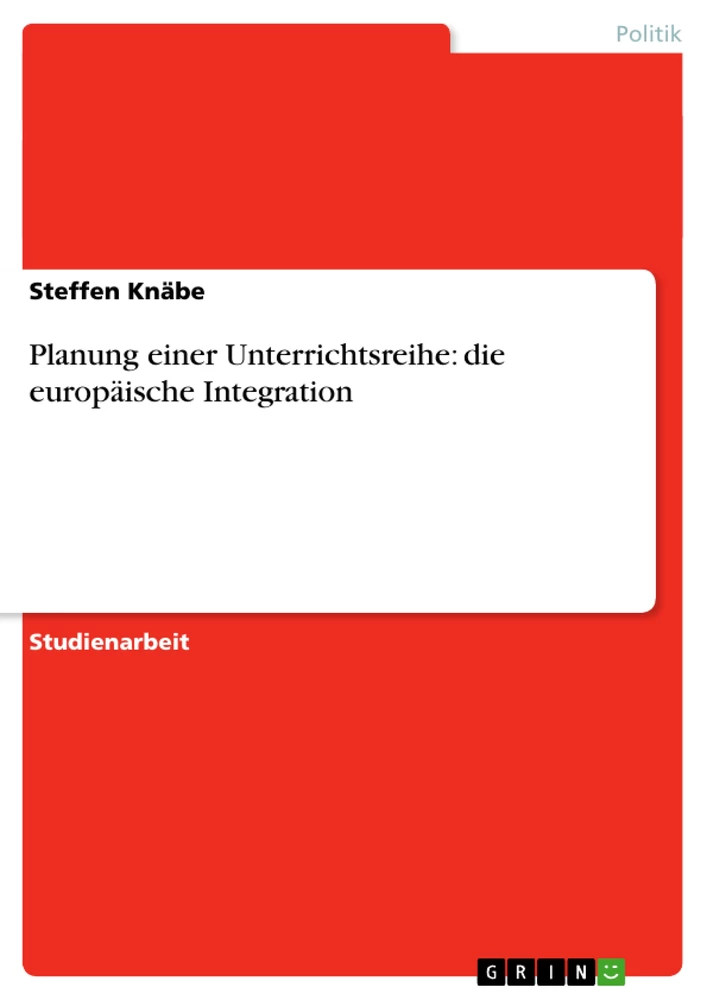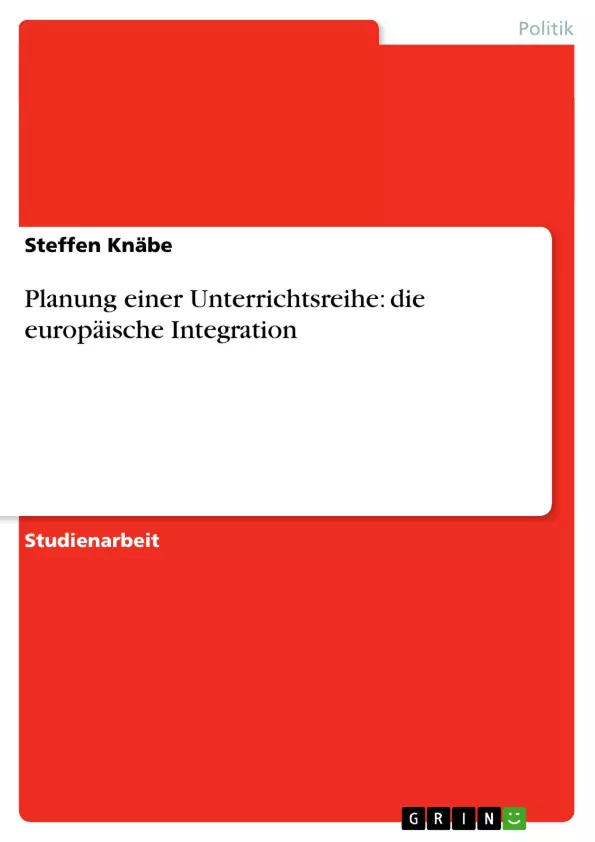Geschichte- eine Wissenschaft, welche die Vergangenheit durchleuchtet und auf Themen trifft, die erstens längst passiert und zweitens als Geschehnisse abgeschlossen sind. Es ist also ein Schulfach, dass meist auf unstrittige Tatsachen- und aus diesen eine Auswahl trifft. Was zweifellos ein Problem darstellen kann, wenn man die Wichtigkeit dieser Ereignisse kategorisieren und sie in den Unterricht einbauen muss. Der politische Unterricht dagegen, zumindest wenn er die Aktualität erreichen will, hat es mit offenen Situationen zu tun, wo selbst Tatsachen umstritten sind und Parteilichkeiten wie unterschiedliche Interpretationen im Vordergrund stehen. Dennoch würde ein Politikunterricht, ohne ein in die Zeitgeschichte hinein ragender möglichst intensiver Geschichtsunterricht, eigentümlich isoliert und würde quasi in der Luft hängen. Deshalb sind auch geschichtliche Grundlagen in der Politik beziehungsweise im Fach Sozialkunde unabdingbar. Aber trotz dieses engen Verhältnisses hat der politische Unterricht doch völlig andere Aufgabenfelder. So soll er zum Beispiel Schülern helfen ihren eigenen Standort in politischen Kontroversen zu finden, sowie auf der Grundlage politischen Sach- und Reflexionswissens kommunikativer Fähigkeiten ausbilden und orientiert an demokratischen Grundwerten im politischen Rahmen sich als mündige Bürger zu verhalten. Es geht also darum, den Schülern die Fähigkeit zu geben, die einfallenden Informationen aufzunehmen, sie zu verarbeiten und zu speichern, um danach begründet politisch urteilen zu können. In folgenden Stichpunkten habe ich die daraus resultierenden speziellen Fähigkeiten aufgelistet:
- eigene Meinungen und Voreinstellungen zu politischen Sach- und Problembereichen im Unterricht durch Konfrontation mit neuen Erkenntnissen und mit bisher vertrauten Sichtweisen kritisch überprüfen
- bei politischen Urteilen zwischen Sach- und Werturteilen unterscheiden
- eigene Meinungen und Werturteile in kontroversen Diskussionen sachlich vertreten, dabei aber unter Umständen auch strategisch argumentieren können, um Mitschüler zu überzeugen
- und andere politische Auffassungen als die eigene im Sinne eines Perspektivwechsels tolerieren
Inhaltsverzeichnis
- Sachanalyse
- Didaktische Perspektive
- Sozialformen & methodisches Vorgehen
- Unterrichtsverlaufsplanung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsreihe „Die europäische Integration“ zielt darauf ab, den Schülern ein tieferes Verständnis der europäischen Integration zu vermitteln. Hierzu werden die historischen Entwicklungen, die Auswirkungen auf den Alltag, das politische System der EU und alternative Zukunftsmodelle beleuchtet.
- Historische Entwicklung der europäischen Integration
- Europäische Integration im Alltag
- Politisches System der EU
- Alternativen der künftigen Entwicklung der europäischen Integration
- Politische Dimension der europäischen Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Sachanalyse
Der Text betont die Bedeutung der Geschichte im Kontext des politischen Unterrichts, da aktuelle politische Prozesse und Debatten auf historische Entwicklungen aufbauen. Er verdeutlicht die Besonderheit des politischen Unterrichts, der mit offenen und umstrittenen Situationen umgeht, im Gegensatz zur Geschichte, die meist auf unstrittige Fakten zurückgreift. Die Einbindung von geschichtlichen Grundlagen in die Sozialkunde wird als essenziell erachtet, um Schülern zu helfen, ihren eigenen Standpunkt in politischen Kontroversen zu finden.
Der Text führt die spezifischen Fähigkeiten aus, die durch den politischen Unterricht vermittelt werden sollen, darunter die kritische Überprüfung eigener Meinungen, die Unterscheidung zwischen Sach- und Werturteilen und die Fähigkeit, eigene Standpunkte in Diskussionen sachlich zu vertreten.
Der Text beleuchtet die Herausforderungen der europäischen Integration, die nicht als geradlinig verlaufende Entwicklung betrachtet werden kann, sondern von Komplikationen und Rückschlägen geprägt ist. Es wird hervorgehoben, dass die Europäische Union für viele Bürger ein fernes Gebilde ist, das schwer zu durchschauen ist.
Didaktische Perspektive
Der Text betont die Bedeutung von Motivationsprinzipien im politischen Unterricht, da Sozialkunde kein besonders beliebtes Fach ist. Die Motivation der Schüler hängt stark vom Lehrer ab und erfordert eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung. Die erste Stunde soll die Schüler auf das Thema einstimmen und mit dem Motivator „Aktualität der Themen“ positiv beeinflussen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Geschichte für den Politikunterricht wichtig?
Ohne zeitgeschichtliche Grundlagen würde der Politikunterricht isoliert wirken. Geschichte liefert die Basis, um aktuelle politische Kontroversen und Strukturen der EU besser zu verstehen.
Was unterscheidet den Politikunterricht vom Geschichtsunterricht?
Während Geschichte oft abgeschlossene Fakten behandelt, befasst sich Politik mit offenen Situationen, umstrittenen Tatsachen und unterschiedlichen Interpretationen der Gegenwart.
Welche Fähigkeiten sollen Schüler im Politikunterricht erwerben?
Sie sollen lernen, Sach- von Werturteilen zu unterscheiden, eigene Meinungen kritisch zu prüfen, strategisch zu argumentieren und andere Sichtweisen zu tolerieren.
Was sind die Schwerpunkte der Unterrichtsreihe zur EU-Integration?
Die Reihe behandelt die historische Entwicklung, die EU im Alltag der Bürger, das politische System der EU sowie Zukunftsmodelle der europäischen Einigung.
Wie können Schüler für das Fach Sozialkunde motiviert werden?
Durch den Motivator "Aktualität", eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung und Methoden, die den Schülern helfen, ihren eigenen Standort in Kontroversen zu finden.
- Quote paper
- Steffen Knäbe (Author), 2002, Planung einer Unterrichtsreihe: die europäische Integration, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20442