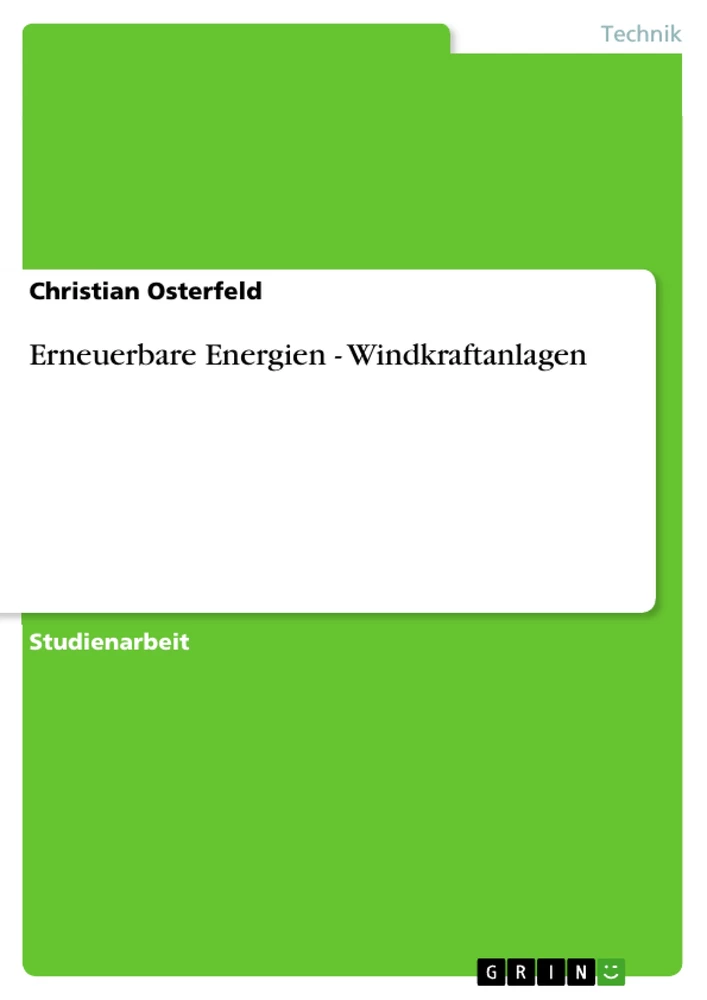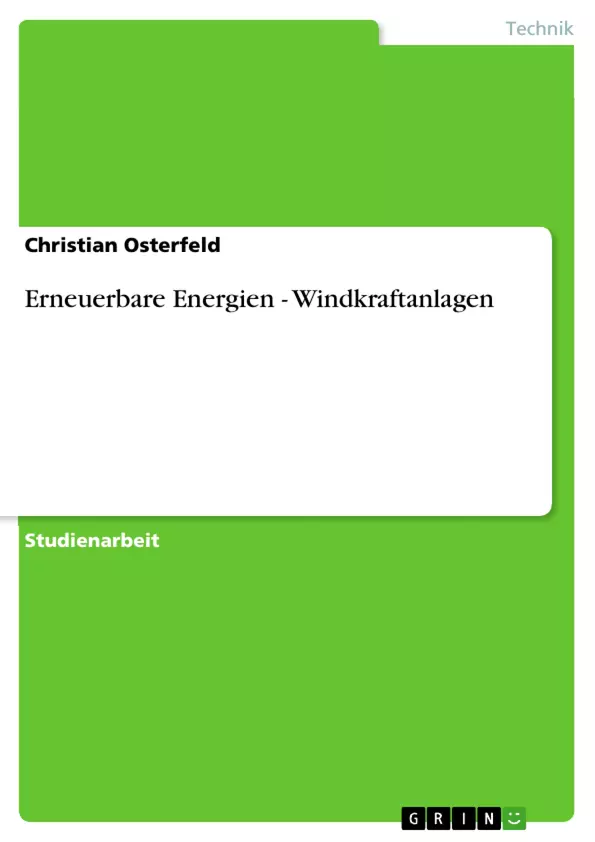Die Nutzung der Windenergie ist keine neue Technologie, sondern die Wiederentdeckung einer traditionsreichen Technik. Die heutigen Windkraftanlagen entwickelten sich aus der Windmühlentechnik und dem Wissen über die Aerodynamik. Die erste Windmühle ist im Iran bereits 600 nach Christus dokumentiert. Windmühlen aus dem persisch-afghanischen Grenzgebiet Seistan soll es bereits 644 nach Christus gegeben haben. Vermutlich wurden die Windmühlen zum Getreidemahlen genutzt. Dieser Anlagentyp mit vertikaler Drehachse fand vor allem im arabischen Raum Verbreitung.
Der Anfang der Stromerzeugung mittels Windenergietechnik fand in Dänemark statt. „Bereits im Jahr 1901 hatte der Däne Poul la Cour mit einer Versuchsanlage zur Erzeugung elektrischen Stroms die Bevölkerung eines kleinen dänischen Ortes namens Askov mit Strom versorgt.“
Albert Betz, Leiter der Aerodynamischen Versuchsanstalt Göttingen, wies 1920 nach, dass physikalisch bedingt höchstens 59,3 Prozent der Energie des Windes nutzbar sind. Seine 1925 zusammengefasste Theorie zur Formgebung der Blätter von Windrotoren ist auch heute noch Grundlage für die aerodynamische Auslegung der Anlagen.
...
2. Aktuelle Entwicklungen im 21. Jahrhundert
Mit dem Folgegesetz, dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das am 01. April 2000 in Kraft trat und dem später (Mitte 2011) von der deutschen Regierung beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland setzte sich der Ausbau der regenerativen Energien und somit auch der Windenergie weiter fort. „Seit dem Rekordjahr 2002 (mit einer neu installierten Leistung von 3200 MW) ging der Zubau an Windenergieleistung im Inland pro Jahr um ca. 30% zurück.“ Bis 2020 soll sich der Anteil der Erneuerbaren an der Stromversorgung jedoch mehr als verdoppeln (mindestens 35 % bis spätestens 2020). Um dies zu ermöglichen, wurde die Strategie entwickelt, das Meer als Standort für die WKA zu nutzen. Die Jahre 2003 bis 2007 wurden für den Bau und Betrieb erster Pilot-Offshore-Windparks genutzt. Die installierte Leistung der Pilot-Windparks betrug 500 MW. Die Jahre 2007 bis 2010 galten als Ausbaujahre, in denen die Leistung der Parks erhöht wurde. Ziel war es, die installierte Leistung auf 2000 bis 3000 MW zu erhöhen.
Der technische Fortschritt, den die Windenergie seit den 80iger Jahren gemacht hat, ist enorm. Die heutigen Anlagen arbeiten mit einem Wirkungsgrad von 40-50%.
Inhaltsverzeichnis
I. Die Windenergie von den Anfängen bis zur Gegenwart
1. Ein kurzer historischer Abriss
2. Aktuelle Entwicklungen im 21. Jahrhundert
II. Prinzip und Aufbau von Windkraftanlagen
1. Physikalische Grundlagen
1.1. Luftmasse m
1.2. Bewegungsenergie E
1.3. Leistung P
1.4. Leistungsbeiwert cp und Luftwiderstandsbeiwert cw
2. Technische Grundlagen
2.1. Das Fundament
2.2. Der Turm
2.3. Das Maschinenhaus
3. Offshore – Parks
III. Kosten und Rahmenbedingungen
IV. Suche nach Energiespeichern
1. Direkte Speicherung
2. Umwandlung in Chemie
3. Umwandlung in mechanische oder Lageenergie
4. Transformation von Windstrom zu Wasserstoff und Methan
V. Vor- und Nachteile von Windkraftanlagen
1. Vorteile
2. Nachteile
VI. Literaturverzeichnis
I. Die Windenergie von den Anfängen bis zur Gegenwart
1. Ein kurzer historischer Abriss
Die Nutzung der Windenergie ist keine neue Technologie, sondern die Wiederentdeckung einer traditionsreichen Technik. Die heutigen Windkraftanlagen[1] entwickelten sich aus der Windmühlentechnik und dem Wissen über die Aerodynamik. Die erste Windmühle ist im Iran bereits 600 nach Christus dokumentiert. Windmühlen aus dem persisch-afghanischen Grenzgebiet Seistan soll es bereits 644 nach Christus gegeben haben.[2] Vermutlich wurden die Windmühlen zum Getreidemahlen genutzt. Dieser Anlagentyp mit vertikaler Drehachse fand vor allem im arabischen Raum Verbreitung.[3]
Der Anfang der Stromerzeugung mittels Windenergietechnik fand in Dänemark statt. „Bereits im Jahr 1901 hatte der Däne Poul la Cour mit einer Versuchsanlage zur Erzeugung elektrischen Stroms die Bevölkerung eines kleinen dänischen Ortes namens Askov mit Strom versorgt.“[4]
Albert Betz, Leiter der Aerodynamischen Versuchsanstalt Göttingen, wies 1920 nach, dass physikalisch bedingt höchstens 59,3 Prozent der Energie des Windes nutzbar sind. Seine 1925 zusammengefasste Theorie zur Formgebung der Blätter von Windrotoren ist auch heute noch Grundlage für die aerodynamische Auslegung der Anlagen.
Einer der ersten, der die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse aufgriff, war der bekannte Stahlbauingenieur Hermann Honnef. Er „plante den Bau von geradezu gigantischen Windkraftwerken.“[5] Die Realisierung dieser Anlagen hätte einige Probleme mit sich gebracht, aber man kann Hermann Honnef trotzdem als „ein[en] Pionier der großen Windkraftanlagen“[6] bezeichnen.
1957 wurde von Ulrich W. Hütter die Grundlage für alle modernen WKA gelegt: das Windtestfeld, das später nach ihm benannt wurde, ist in der Nähe von Geislingen an der Steige auf der Schwäbischen Alb in Betrieb genommen worden.
Anfang der 1980er-Jahre setzte sich das Dänische Konzept bei WKA durch. Unter dem dänischen Konzept versteht man, dass der Rotor mit einer festen Drehzahl dreht und eine direkte Netzeinspeisung stattfindet. Durch die feste Drehzahl ist aber keine Anpassung an die Windverhältnisse möglich. In Dänemark wurden damals die Grundlagen für die moderne Windenergienutzung gelegt. Heutzutage wird das dänische Konzept aber kaum noch verwendet.
1982 wurde in der Nähe von Brunsbüttel der „Growian“ mit einer Leistung von 3 MW gebaut. Mit ihm sollte die Windenergienutzung vorangebracht werden, allerdings wurde er sechs Jahre später wegen technischer Probleme wieder abgebaut.[7]
Mit dem Bewusstwerden der Endlichkeit von Erdöl nach dem Golfkrieg und dem Zweifel an der nuklearen Sicherheit, der durch die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl verstärkt wurde, begann auch der Aufschwung der Windenergie in Deutschland. Das Stromeinspeisungsgesetz von 1991 verpflichtete die Elektrizitätsversorgungsunternehmen, elektrische Energie aus regenerativen Umwandlungsprozessen abzunehmen und zu vergüten.[8]
Das sogenannte ‚250 MW-Wind-Programm’ vergab Förderungen für die Installation und den Betrieb von WKA an geeigneten Standorten. Bis 1996, dem Ende des Projektes, wurden „insgesamt 1577 Windanlagen mit einer Nennleistung von 390,5 MW“[9] gefördert.
Die Entwicklung führte zu immer größeren Anlagen mit verstellbaren Rotorblättern und variabler Drehzahl.
2. Aktuelle Entwicklungen im 21. Jahrhundert
Mit dem Folgegesetz, dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das am 01. April 2000 in Kraft trat und dem später (Mitte 2011) von der deutschen Regierung beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland setzte sich der Ausbau der regenerativen Energien und somit auch der Windenergie weiter fort. „Seit dem Rekordjahr 2002 (mit einer neu installierten Leistung von 3200 MW) ging der Zubau an Windenergieleistung im Inland pro Jahr um ca. 30% zurück.“[10] Bis 2020 soll sich der Anteil der Erneuerbaren an der Stromversorgung jedoch mehr als verdoppeln (mindestens 35 % bis spätestens 2020). Um dies zu ermöglichen, wurde die Strategie entwickelt, das Meer als Standort für die WKA zu nutzen. Die Jahre 2003 bis 2007 wurden für den Bau und Betrieb erster Pilot- Offshore-Windparks genutzt. Die installierte Leistung der Pilot-Windparks betrug 500 MW. Die Jahre 2007 bis 2010 galten als Ausbaujahre, in denen die Leistung der Parks erhöht wurde. Ziel war es, die installierte Leistung auf 2000 bis 3000 MW zu erhöhen.[11]
Der technische Fortschritt, den die Windenergie seit den 80iger Jahren gemacht hat, ist enorm. Die heutigen Anlagen arbeiten mit einem Wirkungsgrad von 40-50%. Nachfolgend soll ein Beispiel verdeutlichen, wie weitreichend die Stromproduktion beispielsweise einer 1,5 MW-Anlage ist: Sie produziert je nach Standort etwa 3-5 Millionen Kilowattstunden. Mit dieser Leistung kann man ca. 1000-2000 4-Personen-Haushalte versorgen.
Zum 1.1.2012 wird eine Novelle des EEG in Kraft treten, die Mitte 2011 verabschiedet wurde. Mit dieser bewährten Regelung soll die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien weiter kontinuierlich steigen sowie eine bessere Markt- und Systemintegration ermöglicht werden. Die Grundsätze – vorrangige Abnahme des Stroms und feste Einspeisevergütungen – bleiben dabei erhalten.[12]
Aus den Daten des World Wind Energy Report 2010 wird ersichtlich, dass Deutschland international zu den größten drei Erzeugern von Windstrom gehört (vgl. Abb. 1). Im europäischen Raum ist Deutschland mit 27.215 Megawatt im Jahre 2010 erneut auf Platz 1, gefolgt von Spanien mit 20.676 Megawatt.[13]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Windenergiekapazitäten der weltweit führenden Länder in Megawatt,
Quelle: http://www.wwindea.org/home/images/stories/pdfs/worldwindenergyreport2010_s.pdf, S. 8
[abgerufen: 19.12.2011]
Aus o. g. Report geht weiterhin hervor, dass der Nettozubau an Windkraftleistung 2010 gegenüber dem Vorjahr rückläufig war und bei 1.488 MW (2009: 1.880 MW) lag. Trotz des Zubaus verringerte sich die Stromerzeugung und ging aufgrund einer ungewöhnlich windschwachen Witterung zurück.[14]
Im Bericht des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)[15] für das Jahr 2010 wird ersichtlich, dass die Windenergie mit einem prozentualen Anteil von 36,5% an der Strombereitstellung aus erneuerbaren Energien in Deutschland neben der Wasserkraft (19,9%) den größten Teil ausmacht (vgl. Abb. 2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.: Strombereitstellung aus erneuerbaren Energien in Deutschland 2010
Quelle: BMU auf Basis AGEE-Stat; http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/
application/pdf/broschuere_ee_zahlen_bf.pdf, S. 15 [abgerufen: 19.12.2011]
Vom gesamten Primärenergieverbrauch Deutschlands 2010 unter Einbeziehung der fossilen Energieträger machten die erneuerbaren Energien gerade 9,4% aus, davon Windenergie 0,9%.[16] Es besteht also noch großer Handlungsbedarf, um das nächste Ziel eines EE-Anteils[17] am Bruttoendenergieverbrauch von 18% in 2020 zu erreichen.
Im Jahr 2010 waren in der Windenergie 96.100 Personen beschäftigt, 2004 waren es nur 63.200.[18]
[...]
[1] Der Übersichtlichkeit wegen nachfolgend mit „WKA“ abgekürzt.
[2] vgl. Hau 2003, S. 2.
[3] vgl. Heier 2007, S. 33.
[4] Ohlhorst 2009, S. 87.
[5] vgl. Hau, S. 29.
[6] ebd. S. 30.
[7] vgl. Ohlhorst 2009, S. 95.
[8] vgl. ebd., S. 124.
[9] ebd., S. 132.
[10] ebd., S. 193.
[11] vgl. ebd., S. 220.
[12] vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.): Erneuerbare Energien in Zahlen. Nationale und internationale Entwicklung, Berlin 2011, In: http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/broschuere_ee_zahlen_bf.pdf, S. 8 [abgerufen 19.12.2011].
[13] vgl. World Wind Energy Association (Hrsg.): „World Wind Energy Report 2010, Cairo 2011, In: http://www.wwindea.org/home/images/stories/pdfs/worldwindenergyreport2010_s.pdf, S. 5.
[14] vgl. ebd., S. 11.
[15] vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, S. 15.
[16] vgl. http://bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/Statistik-und-Prognosen/Energiedaten/energie gewinnung-energieverbrauch.html, [abgerufen 19.12.2011].
[17] Erneuerbare Energien-Anteil.
[18] vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), S. 36 [abgerufen 19.12.2011].
Häufig gestellte Fragen
Seit wann wird Windenergie historisch genutzt?
Erste Windmühlen mit vertikaler Drehachse sind bereits um 600 nach Christus im Iran dokumentiert.
Wer legte die physikalischen Grundlagen für moderne Windrotoren?
Albert Betz wies 1920 nach, dass maximal 59,3 % der Windenergie nutzbar sind. Seine Theorie von 1925 ist noch heute Grundlage für die aerodynamische Auslegung.
Was versteht man unter dem "Dänischen Konzept"?
Dabei dreht der Rotor mit einer festen Drehzahl und speist den Strom direkt ins Netz ein. Es war in den 1980ern Standard, wird heute aber kaum noch genutzt.
Welchen Wirkungsgrad haben moderne Windkraftanlagen?
Dank technischem Fortschritt arbeiten heutige Anlagen mit einem Wirkungsgrad von etwa 40 bis 50 %.
Was sind Offshore-Windparks?
Offshore-Windparks sind Windkraftanlagen, die im Meer errichtet werden, um die dortigen konstanten Windverhältnisse besser zu nutzen.
Welche Rolle spielt die Windenergie bei der Stromversorgung in Deutschland?
Im Jahr 2010 machte die Windenergie 36,5 % der Strombereitstellung aus erneuerbaren Energien in Deutschland aus.
- Arbeit zitieren
- Christian Osterfeld (Autor:in), 2011, Erneuerbare Energien - Windkraftanlagen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204484