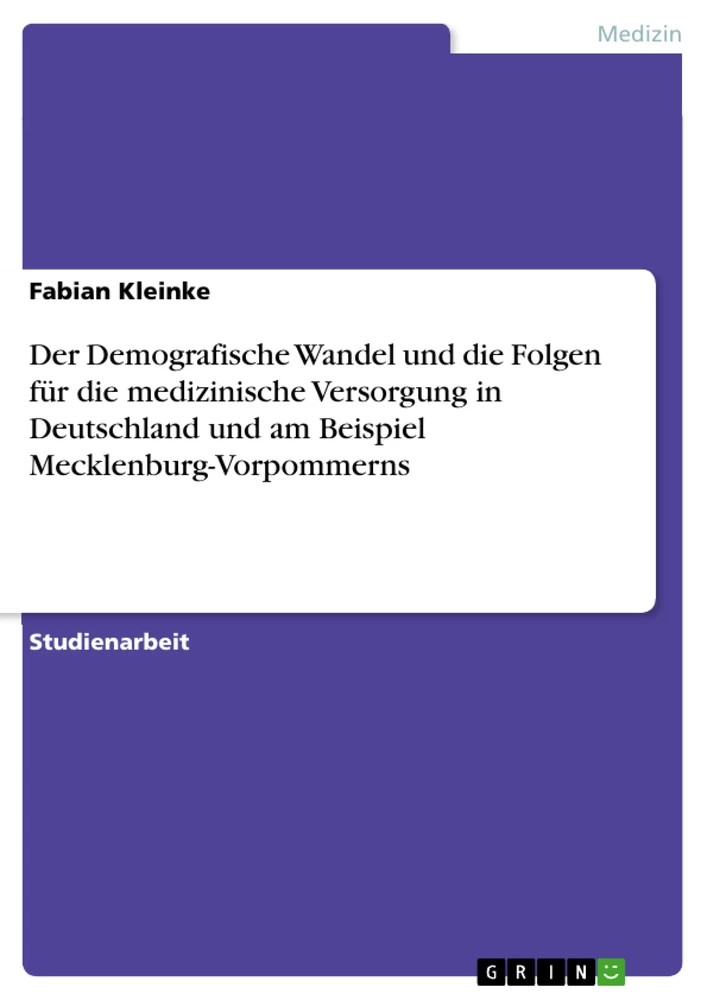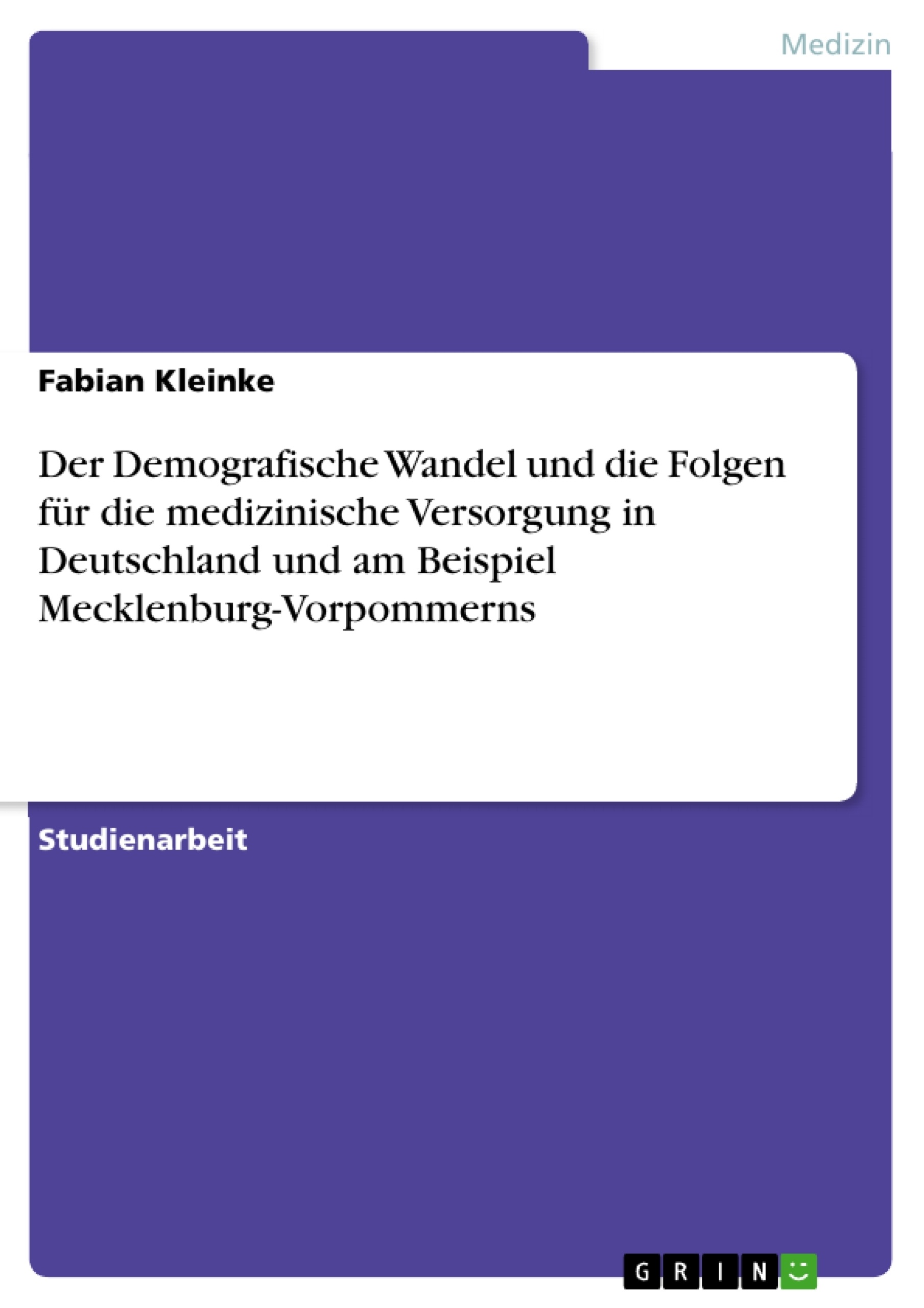Auswirkungen der demografischen Entwicklung sind besonders im Gesundheitswesen zu spüren. Die Bevölkerung wird älter und der Bedarf an medizinischen Leistungen wächst stetig an und damit auch die Zahl der benötigten Mediziner. Kaum ein anderes Thema sorgt aktuell für solchen Diskussionsbedarf wie der bevorstehende Ärztemangel. Doch droht der deutschen Bevölkerung in naher Zukunft wirklich ein Defizit an medizinischer Versorgung? Dabei gehen die Meinungen der Experten auseinander. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) warnt schon jetzt vor einem bevorstehenden Ärztemangel und teilte mit, dass bereits erste Anzeichen zu erkennen sind. Die Ersatzkassen hingegen sprechen von einem Überangebot an Medizinern. (vgl. Internetseite vdek) „Es gibt keinen generellen Ärztemangel, sondern höchstens regionale Engpässe, die zu beheben sind.“ (Thomas Ballast, Internetseite Ärzteblatt)
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Demografische Wandel
2.1 Geburtenrückgang
2.2 Entwicklung der Sterblichkeit
2.3 Die Bevölkerung altert
3. Was kommt auf uns zu, kommende Entwicklungen
3.1 weitere Entwicklungen
4. Einleitung
4.1 Entwicklung der Arztzahlen
4.2 Vertragsärztliche Versorgung
4.3 Bedarfsplanung
5. Situation in Mecklenburg-Vorpommern
5.1 Vertragsärztliche Versorgung
5.2 Kritik an Bedarfsplanung
6. Auswertung Fragebogen
7. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Gestorbene in Deutschland
Abbildung 2: Altersaufbau der in Deutschland lebenden Bevölkerung
Abbildung 3: An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte
T a b elleverzeichnis
Tabelle 1: Entwicklung der Arztdichte: Berufstätige Ärzte je 100.000 Einwohner nach Auswahl an Bundesländern 1991 bis 2009
Tabelle 2: Versorgungsgrad in % der Planungskreise (Stand: 2002)
Tabelle 3: Versorgungsgrad mit an der vertragsärztlichen Tätigkeit teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten nach Fachgebieten, MV im Regionalvergleich, am 01.03.2010
Tabelle 4: Herkunft der befragten Studenten
Tabelle 5: Verteilung der Antworten beider Gruppen
A b k ü rz u n g s v e rz eichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich der demografische Wandel auf die ärztliche Versorgung aus?
Eine alternde Bevölkerung erhöht den Bedarf an medizinischen Leistungen, während gleichzeitig viele Mediziner in den Ruhestand gehen, was regional zu Versorgungsengpässen führen kann.
Besteht in Deutschland ein genereller Ärztemangel?
Die Arbeit zeigt kontroversen Positionen auf: Während Berufsverbände vor einem Mangel warnen, sehen Krankenkassen eher ein Problem der regionalen Fehlverteilung als einen generellen Mangel.
Welche Besonderheiten gibt es in Mecklenburg-Vorpommern?
Als dünn besiedeltes Flächenland ist Mecklenburg-Vorpommern besonders stark von der Überalterung und Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung von Landarztpraxen betroffen.
Was wird an der aktuellen Bedarfsplanung der Ärzte kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass die Planung oft unflexibel ist und die tatsächliche Krankheitslast sowie die Erreichbarkeit von Praxen in ländlichen Räumen nicht ausreichend berücksichtigt.
Welche Rolle spielt der Geburtenrückgang für das Gesundheitssystem?
Langfristig führt er zu einer schrumpfenden Zahl an Beitragszahlern bei gleichzeitig steigenden Ausgaben für die Versorgung der älteren Generation.
Was ergab die Befragung von Medizinstudenten in der Arbeit?
Die Auswertung gibt Aufschluss über die Bereitschaft künftiger Ärzte, in ländlichen Regionen zu arbeiten und welche Anreize dafür notwendig wären.
- Citar trabajo
- Fabian Kleinke (Autor), 2011, Der Demografische Wandel und die Folgen für die medizinische Versorgung in Deutschland und am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204524