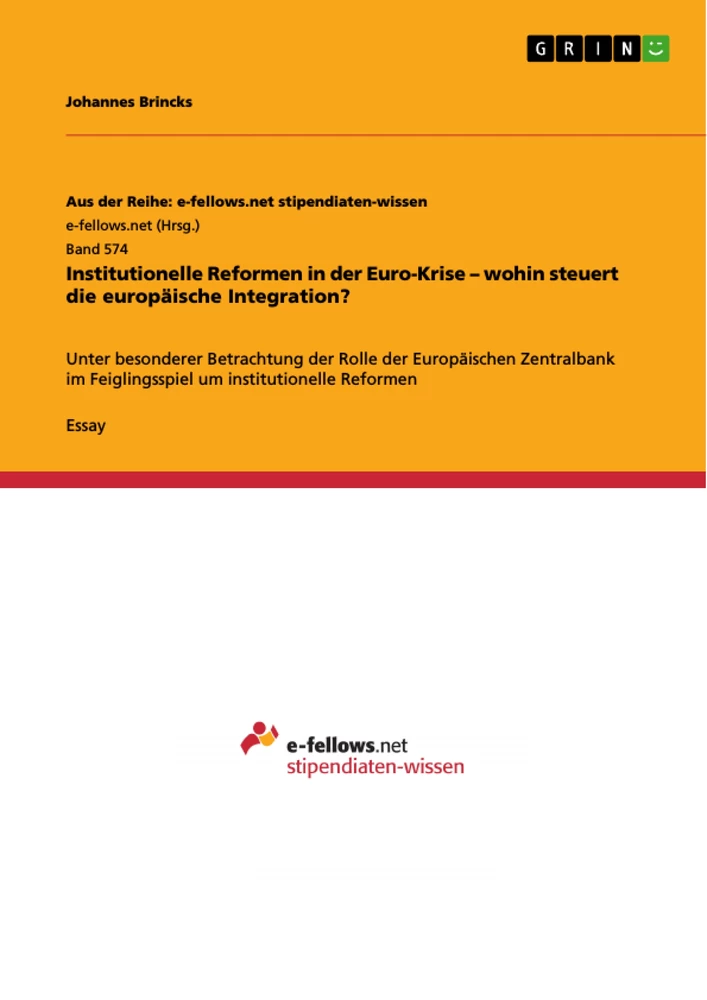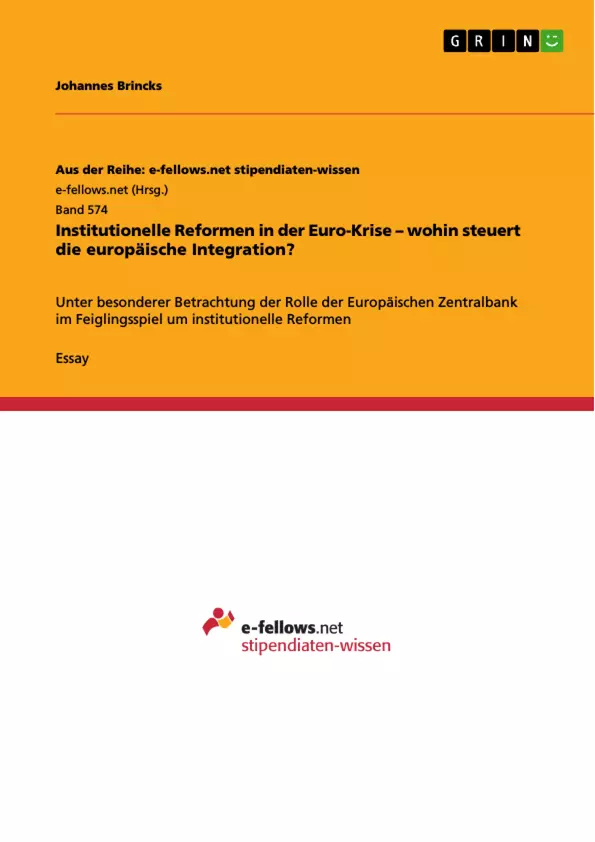Die Verhandlungen europäischer Staaten um Reformen und Hilfen werden als Feiglingsspiel betrachtet. Der Einfluss der EZB und ihrer Staatsanleihenankaufprogramme wird erörtert.
Inhaltsverzeichnis
1 Theorien zur Erklärung institutioneller Reformen
1.1 Grundzüge der Entstehung des aktuellen Designs der europäischen Währungsunion
1.2 Theorien zur Dynamik der Integration
2 Das Feiglingsspiel als Verhandlungsmuster in der Eurokrise
2.1 Die Regeln des Feiglingsspiels
2.2 Die Spieler in der Schuldenkrise und ihre Absichten
3 Die Rolle der Europäischen Zentralbank
3.1 Charakteristika der EZB
3.2 Der Eingriff der EZB in das Feiglingsspiel
4 Folgen des Eingriffs und Ausblick
1 Theorien zur Erklärung institutioneller Reformen
1.1 Grundzüge der Entstehung des aktuellen Designs der europäischen Währungsunion
Das aktuelle Design der Währungsunion stellt eine zentralisierte Geldpolitik einer dezentralisierten Fiskalpolitik gegenüber. Die Geldpolitik wird von einer unabhängigen Zentralbank betrieben und ist vorrangig der Geldwertstabilität verpflichtet. Sie orientiert sich damit an den vormaligen, so genannten Hartwährungsländern unter den heutigen Euro-Ländern, insbesondere Deutschland. Diese hatten gegenüber den "Weichwährungsländern" eine starke Ausgangsposition bei den Verhandlungen zur Einführung der Währungsunion, da sie zum einen auf diese weniger stark angewiesen waren und zum anderen durch innenpolitischen Druck eine glaubhafte Selbstverpflichtung zum Beharren auf einer unabhängigen Zentralbank anstelle einer Wirtschaftsregierung sowie einer an Geldwertstabilität orientierten Geldpolitik hatten.[1]
1.2 Theorien zur Dynamik der Integration
Insbesondere für die Hartwährungsländer um Deutschland war die Europäische Integration zur Verwirklichung der Währungsunion essentiell. Die Entwicklung der europäischen Integration wurde bzw. wird unter anderem mit drei Theorien erklärt.
In der Theorie des Intergouvernementalismus entscheiden die Regierungen der einzelnen Staaten über Absprachen zur internationalen Zusammenarbeit wie die Schaffung gemeinsamer Märkte. Dabei haben sie lediglich einen zusätzlichen Nutzen für ihr Land im Blick und können sich dementsprechend frei für oder gegen die Vereinbarungen entscheiden.
Der Neofunktionalismus beschreibt eine Eigendynamik der Integration. Die Integration wird also nicht mehr Stück für Stück unter Erwartung eines zusätzlichen Nutzens beschlossen, sondern geschieht de facto nicht-optional. Grund dafür ist die so genannte Pfadabhängigkeit, welche durch hohe Exitkosten entsteht. Die Länder müssen den Integrationsprozess fortsetzen, um bestehende Privilegien erhalten zu können bzw. keine Verluste zu erleiden. So werden beispielsweise Regulierungen unerwartet durch vorherige Schritte der Integration nötig, z.B. gemeinsame Normen durch die Schaffung eines gemeinsamen Marktes.
Der Postfunktionalismus schließlich stellt der beschriebenen Eigendynamik der Integration einen Widerstand seitens Teilen der Bevölkerung gegenüber. Zu diesem kommt es durch die Politisierung der Integration, d.h. das Bilden und Verbreiten von Meinungen zur Integration, welche durch ihren Fortschritt zunehmend auf Interesse stößt.
Der Postfunktionalismus wurde insbesondere in den letzten Jahren, in denen tatsächlich EU-Abkommen den durchschnittlichen Bürger stärker als zuvor betrafen und es auch zu Gegenbewegungen und einem Erstarken EU-skeptischer Parteien in beinahe allen europäischen Staaten kam, zur Erklärung aktueller Entwicklungen genutzt.
2 Das Feiglingsspiel als Verhandlungsmuster in der Eurokrise
Die aktuellen Verhandlungen um Hilfen einerseits und Reformen, Regulierungen sowie mögliche Sanktionen andererseits können spieltheoretisch als Feiglingsspiel betrachtet werden.
Ein Feiglingsspiel ist ein spieltheoretisches Problem zwischen zwei Spielern. Jeder Spieler versucht dabei das Spiel (hier: die Verhandlungen) für sich zu entscheiden, indem er nicht von seiner Position abweicht. Weicht ein Spieler von seiner Position ab, so verliert er und der andere siegt. Weicht jedoch keiner der Spieler ab, so stellt dies den ungünstigsten Ausgang für beide Spieler dar.
Das Feiglingsspiel beinhaltet nur zwei Spieler. Dennoch können Verhandlungen im Rahmen der Schuldenkrise als Feiglingsspiel betrachtet werden, da man die beteiligten Länder den zwei Gruppen der ehemaligen Hart- und Weichwährungsländern zuordnen und die Verhandlungen so vereinfacht als bilateral ansehen kann.
Die ehemaligen Hartwährungsländer sind dabei gleichzeitig die liquideren. Sie versuchen in erster Linie Reformen in den überschuldeten Staaten durchzusetzen, für deren Rettung sie nur ungern bürgen oder zahlen. Sie wollen die Stabilitätsunion erhalten. Die ehemaligen Weichwährungsländer stellen im Wesentlichen die Gruppe der Staaten, die Hilfen in Anspruch nehmen oder dies womöglich in naher Zukunft tun müssen, und haben die Absicht Hilfen für überschuldete Staaten unkomplizierter und an weniger starke Auflagen gebunden zu vergeben. Sie setzen sich also für eine Transferunion ein. Lenkt bei den Verhandlungen keine der beiden Parteien ein, so kommt es zur Zahlungsunfähigkeiten von Staaten und einem nachfolgenden Kollaps des europäischen Finanzsystems. Dieser stellt das schlechteste Szenario für beide Seiten dar, da er mehr Schaden verursacht als einerseits die Hilfen kosten würden und andererseits die ersparten Unannehmlichkeiten der diskutierten Reformen rechtfertigen könnten.
[...]
[1] Kap. 1 und 2 folgen Schimmelfennig (2012).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 'Feiglingsspiel' im Kontext der Euro-Krise?
Es beschreibt ein spieltheoretisches Verhandlungsmuster zwischen "Hartwährungsländern" (die Reformen fordern) und "Weichwährungsländern" (die Hilfen benötigen), bei dem keine Seite nachgeben will, um die eigene Position zu stärken.
Welche Rolle spielt die EZB in diesem Szenario?
Die Europäische Zentralbank greift durch Programme wie den Staatsanleihenankauf in das Verhandlungsspiel ein, was die Dynamik zwischen den beteiligten Staaten verändert.
Was besagt die Theorie des Neofunktionalismus?
Der Neofunktionalismus geht davon aus, dass die Integration eine Eigendynamik entwickelt (Pfadabhängigkeit), bei der weitere Integrationsschritte aufgrund hoher Exitkosten fast zwingend werden.
Was unterscheidet eine Stabilitätsunion von einer Transferunion?
Eine Stabilitätsunion setzt auf strenge Fiskalregeln und Eigenverantwortung der Staaten, während eine Transferunion dauerhafte finanzielle Unterstützungsmechanismen zwischen den Mitgliedern vorsieht.
Welche Folgen hat der Postfunktionalismus für die EU?
Der Postfunktionalismus beschreibt den wachsenden Widerstand in der Bevölkerung gegen die Integration, was zu einer Politisierung und dem Erstarken EU-skeptischer Parteien führt.
- Arbeit zitieren
- Johannes Brincks (Autor:in), 2012, Institutionelle Reformen in der Euro-Krise – wohin steuert die europäische Integration?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204734