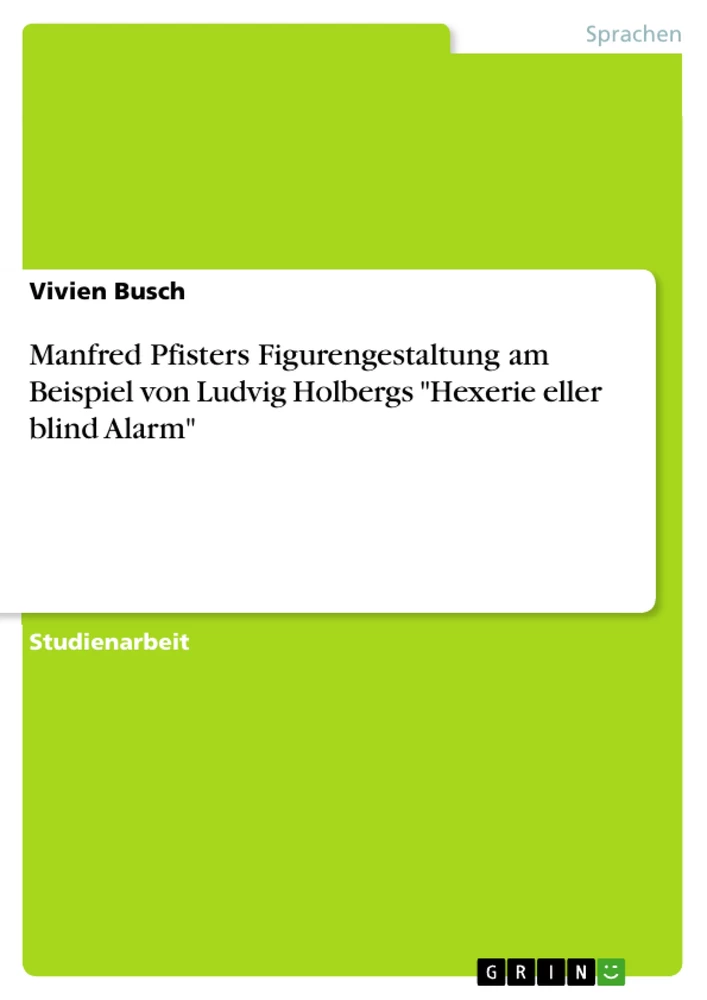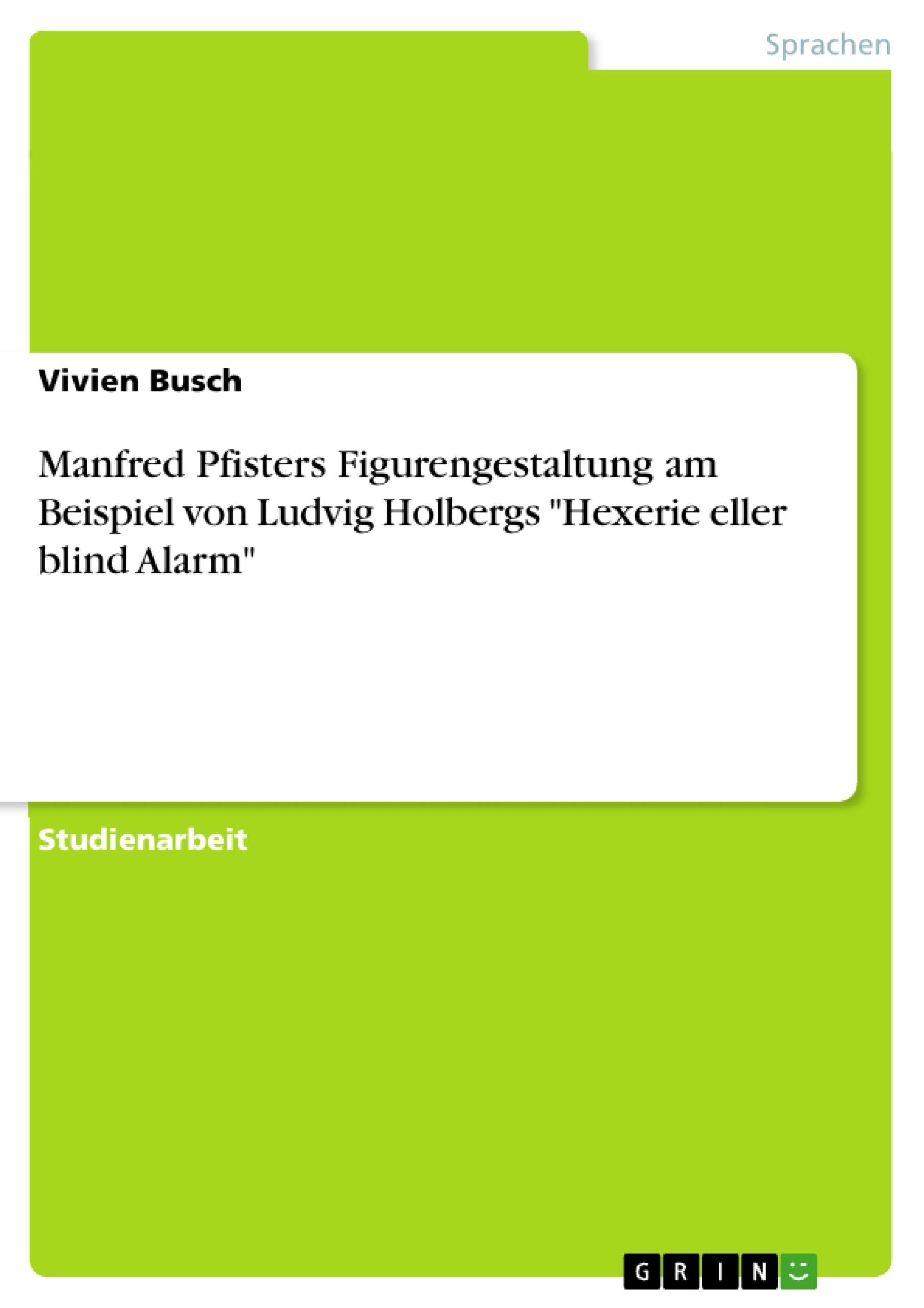Manfred Pfister hat mit seiner Studie "Das Drama. Theorie und Analyse" ein Buch vorgelegt, das mittlerweile seit vielen Jahren als Standardwerk der Dramentheorie gilt. Pfister hat es sich darin zur Aufgabe gemacht, die enorm große Bandbreite dramatischer Texte einzufangen und systematisch zu beschreiben. Dabei beabsichtigt er „eine allgemeine und systematische, nicht aber eine normativ-präskriptive Theoriebildung“. In dieser Arbeit wird zunächst die dramatische Kommunikationsform nach Pfister dargestellt; der zweite Teil der Arbeit setzt sich mit dem Aspekt der Figurengestaltung nach Pfister auseinander. In einem dritten Schritt soll der vorangegangene theoretische Aspekt der Figurengestaltung helfen, Ludvig Holbergs "Hexerie eller blind Alarm" auf seine Figuren hin zu untersuchen. Dabei wird die Rechtschreibung in Holbergs Stück so wie sie ist übernommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Dramatische Kommunikationsform nach Pfister
- Figurengestaltung nach Pfister
- Figur vs. Person vs. Charakter
- Personal und Konfiguration
- Figurenkonzeption
- Figurencharakterisierung
- Figurengestaltung in Holbergs Hexerie eller blind Alarm
- Handlung
- Hexerie eller blind Alarm und die commedia dell'arte
- Personal und Konfiguration
- Figurenkonzeption
- Figurencharakterisierung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Ludvig Holbergs Komödie "Hexerie eller blind Alarm" im Kontext der Dramentheorie von Manfred Pfister. Dabei werden die dramatische Kommunikationsform, die Figurengestaltung und die Beziehung des Stücks zur Commedia dell'Arte untersucht.
- Dramatische Kommunikationsform nach Pfister
- Figurengestaltung in dramatischen Texten
- Analyse von "Hexerie eller blind Alarm"
- Beziehung zur Commedia dell'Arte
- Holbergs Kritik an Aberglaube und Sensationsgier
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Arbeit ein und stellt die Relevanz von Pfisters Dramentheorie sowie Holbergs "Hexerie eller blind Alarm" heraus. Im zweiten Kapitel wird die dramatische Kommunikationsform nach Pfister beleuchtet. Dabei werden die Unterschiede zwischen narrativen und dramatischen Texten, die Rolle des Kommunikationssystems und die Bedeutung der Figurenrede hervorgehoben.
Kapitel 3 widmet sich der Figurengestaltung nach Pfister. Es werden die Begriffe "Figur", "Person" und "Charakter" abgegrenzt, die Konfigurationen und das Personal analysiert sowie die verschiedenen Konzeptionen und Charakterisierungstechniken erläutert.
Im vierten Kapitel wird die Figurengestaltung in Holbergs "Hexerie eller blind Alarm" anhand der zuvor präsentierten Theorie untersucht. Die Handlung des Stücks wird zusammengefasst und die Beziehung zur Commedia dell'Arte beleuchtet. Außerdem werden das Personal und die Konfigurationen des Stücks analysiert. Die Figurenkonzeption und -charakterisierung werden anhand von Beispielen aus dem Text verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Dramentheorie von Manfred Pfister, die Figurengestaltung in dramatischen Texten, die Analyse von Ludvig Holbergs "Hexerie eller blind Alarm", die Commedia dell'Arte, Aberglaube, Sensationsgier und Klatschsucht.
- Arbeit zitieren
- Vivien Busch (Autor:in), 2010, Manfred Pfisters Figurengestaltung am Beispiel von Ludvig Holbergs "Hexerie eller blind Alarm", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204794