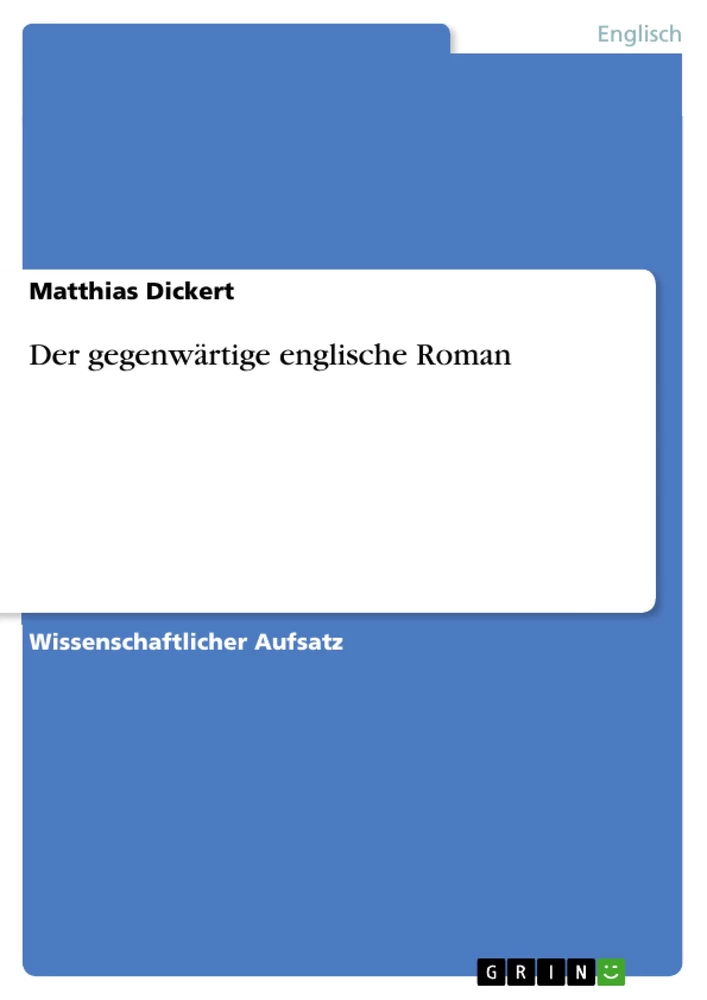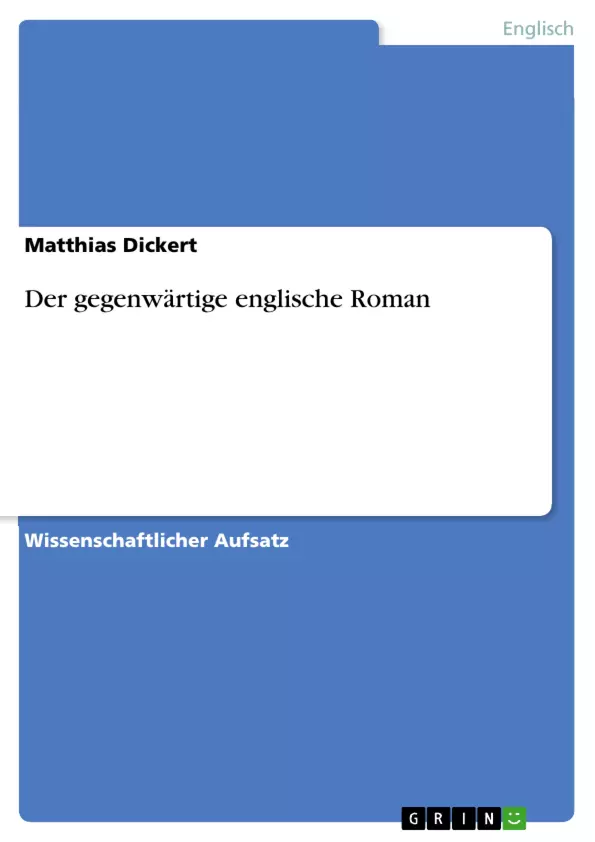Der englische Roman des 20. Jahrhunderts kann in vielen Bereichen als Fortsetzung des 19.
Jahrhunderts gelten, da wichtige Elemente wie Struktur und Themenvielfalt übernommen und integriert wurden.
Dabei kristallisierten sich Realismus und Naturalismus als seine beiden Hauptströmungen heraus (Bradbury, 1973, S. 175).1
Dennoch setzen parallel zu dieser Eingliederung bekannter Elemente stilistische und themenmäßige Neuerungen ein, die völlig neue Facetten und Strömungen in den Roman als literarischem Genre implantieren.2
So begann etwa mit den Werken von Joseph Conrad eine bisher unbekannte Illusionskritik, die durch die Überlagerung der erzählten Geschichte durch Erzählvorgang und Interpretationsverhalten dem Roman völlig neue Wege eröffnete (Seeber, 1999, S. 317).
Psychologie und Existentialismus verschafften sich ebenfalls zunehmend einen literarischen Zugang und fanden ihre wohl intellektuellste Verwendung bei Virginia Wolf und James Joyce.
[...]
1 Neben Realismus und Naturalismus als literarische Strömungen verweist die Forschung immer wieder auf die Strömung des Postmodernismus als wichtigem Ansatz. So spricht Lodge (1992) im Zusammenhang mit der Entwicklung des modernen englischen Romans zwischen Dokumentation, Realismus und Postmodernismus von einem „supermarket of styles“ (ebd., S. 209). Broich (1993) konstatierte für Großbritannien einen ´gedämpften Postmodernismus`, da der englische Roman – von der langen Tradition des realistischen Erzählens herkommend – nur sporadisch modernistische Einflüsse zulässt. Daraus entwickelt sich für Zerweck (2007) ein heterogener Ansatz, den er auch als Sammelbegriff für gegensätzliche kulturelle Phänomene aus verschiedenen Kontexten ansieht.
2 Zur Kontinuität der Romanentwicklung zwischen 19. und 20. Jahrhundert vgl. bes. Schirmer/Esch, (1973, S. 345). Seeber (1999) spricht bezüglich des Verhaftetsein im 19. Jahrhundert von einem „außerordentlichen Beharrungsvermögen“ des Romans des 19. Jahrhunderts, der oft nur „moderne Themen“ wie Sexualität, Entfremdung oder eine gestörte zwischenmenschliche Kommunikation integrierte (ebd., S. 309). Einen historisch-politisch geprägten Ansatz verfolgt Firdous (1993). Für ihn ist der Roman ein „carrier of bourgeois ideology“ (ebd., S. 26), weil für ihn die Entwicklung des Romans besonders im 19. Jahrhundert an den europäischen Kolonialismus gekoppelt ist und er für ihn „imperial messages enthält“ (ebd., S. 30/32). Vgl. hierzu auch Moon (1963).
Der gegenwärtige englische Roman
„Der Roman ist das einzige im Werden begriffene und noch nicht fertige Genre“
(Michail M. Bakhtin, 1989.)
Der englische Roman des 20. Jahrhunderts kann in vielen Bereichen als Fortsetzung des 19. Jahrhunderts gelten, da wichtige Elemente wie Struktur und Themenvielfalt übernommen und integriert wurden.
Dabei kristallisierten sich Realismus und Naturalismus als seine beiden Hauptströmungen heraus (Bradbury, 1973, S. 175).[1]
Dennoch setzen parallel zu dieser Eingliederung bekannter Elemente stilistische und themenmäßige Neuerungen ein, die völlig neue Facetten und Strömungen in den Roman als literarischem Genre implantieren.[2]
So begann etwa mit den Werken von Joseph Conrad eine bisher unbekannte Illusionskritik, die durch die Überlagerung der erzählten Geschichte durch Erzählvorgang und Interpretationsverhalten dem Roman völlig neue Wege eröffnete (Seeber, 1999, S. 317).
Psychologie und Existentialismus verschafften sich ebenfalls zunehmend einen literarischen Zugang und fanden ihre wohl intellektuellste Verwendung bei Virginia Wolf und James Joyce. So gelten Mrs. Dalloway (1925) oder Ulysses (1922) als klassische Beispiele für den experimentellen Roman. Die Verwendung von neuen Stilformen wie der 'stream-of-consciousness-technique' oder der Epiphanie-Technik symbolisierten gleichsam den Bruch mit dem klassischen Realismus und verdeutlichten den Spagat zwischen Tradition und Moderne in der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg.
Weltwirtschaftskrise und die politische Radikalisierung der Literatur als ihre logische Konsequenz auf gesellschaftliche Entwicklungen boten für viele Autoren, die im Schatten des Ersten Weltkrieges aufgewachsen waren, eine politische Plattform, die in Orwells satirischer Tierfabel Animal Farm (1945) und der Antiutopie Nineteen Eighty-Four (1949) die literarische Ära nach dem Zweiten Weltkrieg einleitete.[3]
Die Auswirkungen dieser globalen Auseinandersetzungen brachten nicht nur gesellschaftliche Veränderungen mit massiver Tragweite wie etwa die Aufteilung der Welt in Hemisphären mit sich, sondern boten dem Religiösen die Chance aus seinem literarischen Nischendasein herauszukommen. So vermischten etwa Graham Greene mit The Heart of the Matter (1948), William Golding mit Lord of the Flies (1954) oder selbst Joyce Cary in seinen beiden Trilogien rein religiöse Themen mit philosophischen oder politischen Elementen.
Diese Renaissance von Philosophie und Religion bedeutete eine Rückkehr zu den Wurzeln des Romans selbst. Watt (1976) drückt dies wie folgt aus:
„In the novel, more than perhaps in any other literary genre the qualities of life can atone for defects of art“ (ebd., S. 343).
Das Spezifische der britischen Nachkriegsjahre war jedoch ein massiver gesellschaftspolitischer Wandel, der in vielen Bereichen neue Möglichkeiten eröffnete. Die sukzessive Auflösung des ehemaligen Empire verdeutliche Ende der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts die Reduzierung der ehemaligen Weltmacht auf einen europäischen Nationalstaat. Jahrhundertelang etablierte Klassengegensätze und die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Ungleichheiten gepaart mit der Hinwendung zu einer Massen- und Konsumgesellschaft ebneten den Weg für literarische Freiräume, die zunehmend auch durch Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund abgedeckt wurden, die eine völlig neue künstlerische und inhaltliche Kreativität mit sich brachten, die „new and engaging“ und „experimental“ war sowie ein „new subject matter“ beinhaltete (Mc Leod, 1961, S. 10)[4].
Die angesprochene gesellschaftliche Veränderung in der 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bot – wie bereits erwähnt – für Autoren die Möglichkeit, eigene, neue Wege zu gehen oder Altes und Neues zu verbinden – ein Ansatz, der sich bis heute gehalten hat.[5]
Eine wirkliche, gerade von intellektuellen Kreisen immer wieder geforderte literarische Neuerung setzte aber erst durch die Bewegung der 'Angry Young Men' ein. Autoren wie John Wain, Kingsley Amis oder später John Braine platzierten ihre Hauptpersonen als Anti-Helden zum Establishment, wenn auch nicht im politisch-radikalen Sinne (Blamires, 1979, S. 473).[6]
Die Vertreter dieser Richtung vermischten dabei Aufbau und Technik des pikaresken Romans mit dem realistischen Erzählstil viktorianischer Erzähler. Neben dieser neuen Strömung kann man die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch als Neubeginn von Ethik und Ästhetik ansehen. Autoren wie William Golding, Doris Lessing, Iris Murdoch und Muriel Spark rückten moralische Anliegen in den Mittelpunkt des Geschehens. Sie knüpften so an eine an religiösen und philosophischen Denksystemen orientierte Weltordnung an. Konflikte zwischen Gut und Böse (Golding), die Bedeutung des Schicksals (Murdoch), das Spiel mit Fiktion und Realität (Spark) oder die Aufspaltung der Wirklichkeit durch ein aufgeteiltes Unterbewusstsein (Lessing) führten neue Schwerpunkte in den modernen Roman ein.[7]
Bode (2005) spricht im Zusammenhang mit der Entwicklung des modernen Romans von drei statt bisher zwei Sinnorientierungen als Zentren des Romans selbst. So nennt er zunächst die subjektive Ebene (das Subjekt ist semantischer Integrationspunkt der narrativen Darstellung), dann die objektive (ein in der dargestellten Wirklichkeit objektiv vorhandener Sinn wird nachvollzogen oder aufgedeckt). Diese beiden Ansätze erweitert er mit dem Begriff „Autoreferentialität“, die eine Art Sinnorientierung beschreibt, die sich aus der Thematisierung der Möglichkeiten narrativer Sinnstiftung (vgl. die Romane von Joyce und
Beckett) ergibt (ebd., S. 314-319).[8]
[...]
[1] Neben Realismus und Naturalismus als literarische Strömungen verweist die Forschung immer wieder auf die Strömung des Postmodernismus als wichtigem Ansatz. So spricht Lodge (1992) im Zusammenhang mit der Entwicklung des modernen englischen Romans zwischen Dokumentation, Realismus und Postmodernismus von einem „supermarket of styles“ (ebd., S. 209). Broich (1993) konstatierte für Großbritannien einen ´gedämpften Postmodernismus`, da der englische Roman – von der langen Tradition des realistischen Erzählens herkommend – nur sporadisch modernistische Einflüsse zulässt. Daraus entwickelt sich für Zerweck (2007) ein heterogener Ansatz, den er auch als Sammelbegriff für gegensätzliche kulturelle Phänomene aus verschiedenen Kontexten ansieht.
[2] Zur Kontinuität der Romanentwicklung zwischen 19. und 20. Jahrhundert vgl. bes. Schirmer/Esch, (1973, S. 345). Seeber (1999) spricht bezüglich des Verhaftetsein im 19. Jahrhundert von einem „außerordentlichen Beharrungsvermögen“ des Romans des 19. Jahrhunderts, der oft nur „moderne Themen“ wie Sexualität, Entfremdung oder eine gestörte zwischenmenschliche Kommunikation integrierte (ebd., S. 309). Einen historisch-politisch geprägten Ansatz verfolgt Firdous (1993). Für ihn ist der Roman ein „carrier of bourgeois ideology“ (ebd., S. 26), weil für ihn die Entwicklung des Romans besonders im 19. Jahrhundert an den europäischen Kolonialismus gekoppelt ist und er für ihn „imperial messages enthält“ (ebd., S. 30/32). Vgl. hierzu auch Moon (1963).
[3] Fraser (1970) sieht eine gesellschaftliche Hilflosigkeit der Autoren während und nach dem Zweiten Weltkrieg und spricht ihnen pauschal eine klare gesellschaftliche Konzeption ab (ebd., S. 160).
Bradbury (1973) betont in diesem Zusammenhang ebenfalls die Bedeutung des Zweiten Weltkrieges und der nachfolgenden Jahre. Für ihn waren Modernisten wie Conrad, Proust, Mann, Wolf oder Faulkner bereits verstorben oder unbedeutend geworden. Die Zeit nach 1945 war für ihn insofern wichtig, da sich die Welt (und damit auch England) gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch massiv veränderte. Die parallel einsetzende Vereinsamung des modernen Menschen förderte literarisch eine neue Mischung von Realismus und Experiment. Das Ergebnis ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts war eine Öffnung des zwischen Realismus und Moderne stehenden Romans zu einer neuen Mischung. Als Beispiele dieser neuen Form nennt er Autoren wie Beckett mit seiner Trilogie Molloy, Malone Dies, The Unnameable (1951-1953), Durells Alexandria Quartet (1957-1960) oder Storeys Roman Redcliffe (1966). Hier findet sich unter anderem ein neues Stilmittel im Roman, die Mischung zwischen mythischen, symbolischen und grotesken Stilmitteln (ebd., S. 169; 176; 177).
[4] Zum Begriff des ´Thatcher effects` vgl. besonders Sked/Cook (1993, S. 516-517). Zu ihren Auswirkungen auf die Literatur vgl. bes. Bradford (2007, S. 29-47).
[5] Als ein Beispiel dieser Symbiose kann etwa die Verbindung des neuen Campusromans mit dem alten, viktorianisch geprägten Industrieroman aufgeführt werden. David Lodge gelang 1988 mit ´ Nice Work ` eine Integration von Elizabeth Gaskells Roman ´ North and South ` 1854/55, in dem sein Roman ohne Detailwissen von ´ North and South ` nur unzureichend interpretiert werden kann. Lodge wird von Nünning (2001) hier als Vorreiter für Gattungsmischungen im Sinne eines „novelist at the crossroads“ (ebd., S. 180) bezeichnet. Dazu zählt auch die Rückkehr zur Social Novel, wie sie sich etwa in Rowlings Roman The Casual Vacancy (2012) zeigt.
[6] Zur Kritik an den 'Angry Young Men' vergleiche besonders Seeber (1999). Seeber reduziert diese Gruppierung literaturhistorisch auf ein soziologisches Phänomen und spricht ihnen ästhetisches Interesse ab (vgl. ebd., S. 384).
[7] Für Amerika kann an dieser Stelle Vonneguts Roman 'Slaughterhouse-Five' (1969) genannt werden.
[8] Firdous (1993) betont hier einen mehr historisch-philosophischen Ansatz, indem er den Einbau des subjektiven Elementes in den realistischen Roman auf Didèrot, Hobbes, Hume und Locke zurückführt (ebd., S. 16/17) und das Subjekt und sein Wachsen mit dem Objektiven für ihn im modernen Roman die Elemente sind, die ihn zusammenhalten (ebd., S. 21/22). Diese subjektive Ebene fand ihrerseits einen neuen Impuls in der Wiederkehr des Religiösen innerhalb der neueren Migrationsliteratur. Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund mussten sich in Großbritannien in einem objektiven Rahmen bewegen, der mitunter ausländerfeindlich oder zumindest ausländerkritisch war.
Häufig gestellte Fragen
Wie wandelte sich der englische Roman im 20. Jahrhundert?
Während Realismus und Naturalismus fortbestanden, führten Autoren wie Joyce und Woolf experimentelle Techniken wie den Stream of Consciousness ein, um Psychologie und Existenzialismus abzubilden.
Wer waren die "Angry Young Men"?
Dies war eine Gruppe von Autoren in den 1950ern (z.B. John Wain, Kingsley Amis), deren Protagonisten als Anti-Helden gegen das soziale Establishment rebellierten.
Welche Bedeutung hat George Orwell für den modernen Roman?
Orwell nutzte Satire (Animal Farm) und die Antiutopie (1984), um politische Radikalisierung und gesellschaftliche Entwicklungen nach den Weltkriegen literarisch zu verarbeiten.
Was ist die "Stream-of-Consciousness-Technik"?
Es ist eine Erzähltechnik, die den ungefilterten Gedankenfluss einer Figur wiedergibt, um die subjektive Realität und das Unterbewusstsein darzustellen.
Wie beeinflusste die Auflösung des Empire die Literatur?
Das schwindende Weltmachtprestige und die Zuwanderung führten zu neuen künstlerischen Impulsen durch Autoren mit Migrationshintergrund, die neue Themen und Perspektiven einbrachten.
- Arbeit zitieren
- Matthias Dickert (Autor:in), 2012, Der gegenwärtige englische Roman, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204799