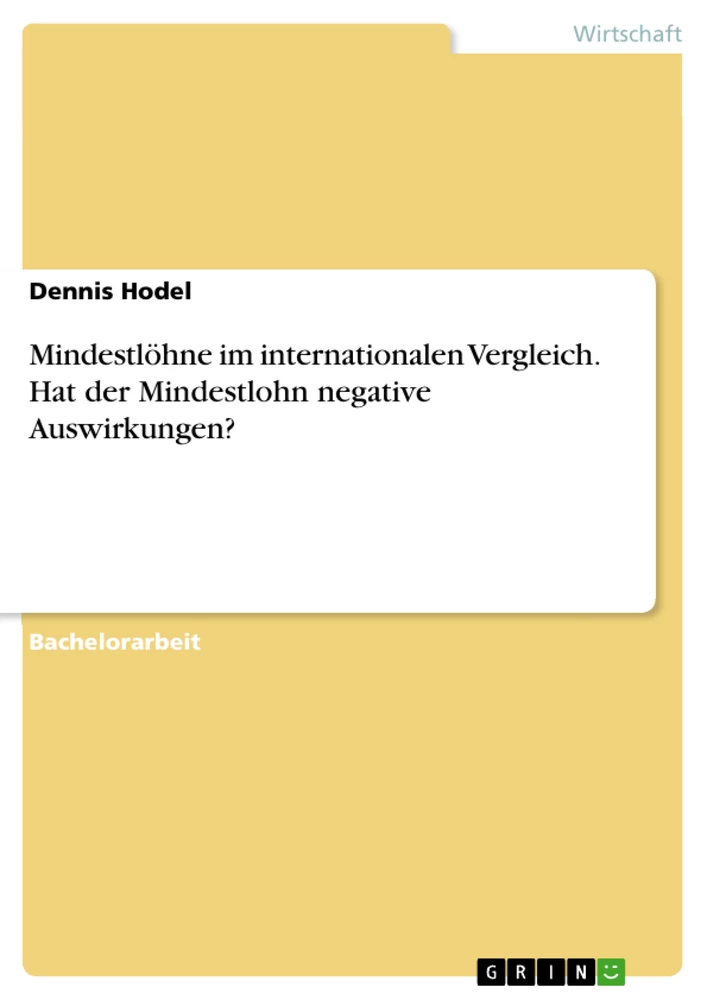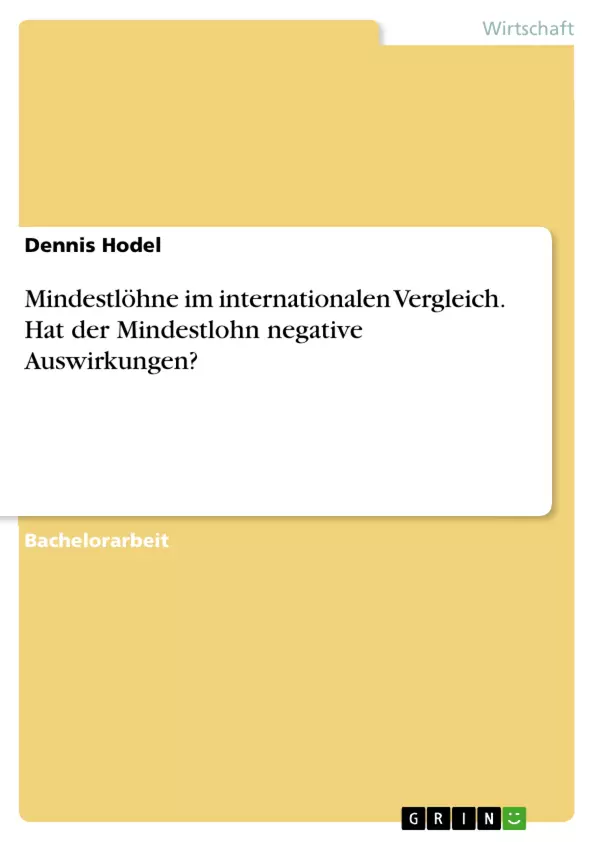In dieser Arbeit soll die Hypothese untersucht werden, ob die Einführung eines Mindestlohns negative Auswirkungen auf die Beschäftigungen hat und die Einführung einer gesetzlichen Lohnuntergrenze zu negativen Beschäftigungseffekten führt.
Bei einem gesetzlichen Mindestlohn handelt es sich um eine Lohnuntergrenze, die gesetzlich festgelegt ist und nicht unterschritten werden darf. Die Festlegung bzw. Erhöhung eines Mindestlohnes erfolgt je nach Land in unterschiedlicher Form. Es gibt Regierungen die den Mindestlohn gesetzlich festlegen (bspw. USA, Frankreich), Mindestlöhne durch Kollektivverhandlungen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden (bspw. Griechenland, Belgien), branchenspezifische Mindestlöhne (bspw. Deutschland, Österreich) und Mischsysteme bei denen eine unabhängige Kommission der Regierung Vorschläge unterbreitet (bspw. Großbritannien, Irland).
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil behandelt die aktuelle politische Diskussion bzw. die Ansichten der Parteien zum Thema Mindestlohn ab. Anschließend werden die Gründe für die Ausbreitung des Niedriglohnsektors dargestellt.
Im Zweiten Teil wird sich mit dem Standardmodell der neoklassischen Theorie beschäftigt. Wie wirkt sich ein Mindestlohn im neoklassischen Sinne auf dem Arbeitsmarkt aus?
Im dritten Kapitel wird die Theorie einer empirischen Überprüfung unterzogen. Hält die Theorie der Empirie stand? Führt ein Mindestlohn zwingend zu negativen Beschäftigungswirkungen? Hier werden die Auswirkungen von Lohnuntergrenzen auf die Zielgröße Beschäftigung ausgewählter Branchen in Deutschland anhand von Studien dargestellt. In den nachfolgenden Abschnitten wird ein Einblick über Beschäftigungswirkungen von den Mindestlöhnen in Großbritannien und auf internationaler Ebene gegeben.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Darstellungsverzeichnis
Teil I
1. Einführung
1.1. Zielsetzung
1.2. Was ist ein Mindestlohn?
1.3. Aktuelle politische Diskussion in Deutschland
2. Der Niedriglohnsektor
2.1. Die Makroebene
2.2. Die Mikroebene
Teil II (Theorie)
3. Die Theorie des neoklassischen Arbeitsmarktes
3.1. Das Standardmodell
3.2. Das Monopson
Teil III (Empirie)
4. Mindestlöhne
4.1. Mindestlöhne in Deutschland
4.1.1. Tarifautonomie
4.1.2. Ergebnisse
4.2. National Minimum Wage - Mindestlohn in Großbritannien
4.2.1. Überblick
4.2.2. Ergebnisse
4.3. Mindestlöhne International
4.3.1. Ergebnisse
5. Fazit
6. Diskussion
Literaturverzeichnis
Anhang
Häufig gestellte Fragen
Führt ein Mindestlohn zwangsläufig zu Arbeitsplatzverlusten?
Die Arbeit untersucht diese Hypothese kritisch. Während die Neoklassik negative Effekte vorhersagt, zeigen empirische Studien oft keine oder nur geringe negative Beschäftigungswirkungen.
Wie unterscheiden sich Mindestlohnsysteme international?
Es gibt staatlich festgelegte Sätze (USA, Frankreich), Branchenlösungen (Österreich) oder Empfehlungen durch unabhängige Kommissionen (Großbritannien).
Was sagt die neoklassische Theorie zum Mindestlohn?
Im Standardmodell wird ein Mindestlohn als Preisuntergrenze gesehen, die zu einem Angebotsüberhang an Arbeit und somit zu Arbeitslosigkeit führen kann.
Welche Rolle spielt das Monopson am Arbeitsmarkt?
In einem Monopson (nur ein Arbeitgeber) kann ein Mindestlohn theoretisch sogar zu einer Erhöhung der Beschäftigung führen, da er die Marktmacht des Arbeitgebers einschränkt.
Was sind die Gründe für den wachsenden Niedriglohnsektor?
Die Arbeit analysiert Ursachen auf Makro- und Mikroebene, wie den Strukturwandel, Globalisierung und Veränderungen in der Tarifautonomie.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Dennis Hodel (Author), 2012, Mindestlöhne im internationalen Vergleich. Hat der Mindestlohn negative Auswirkungen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204914