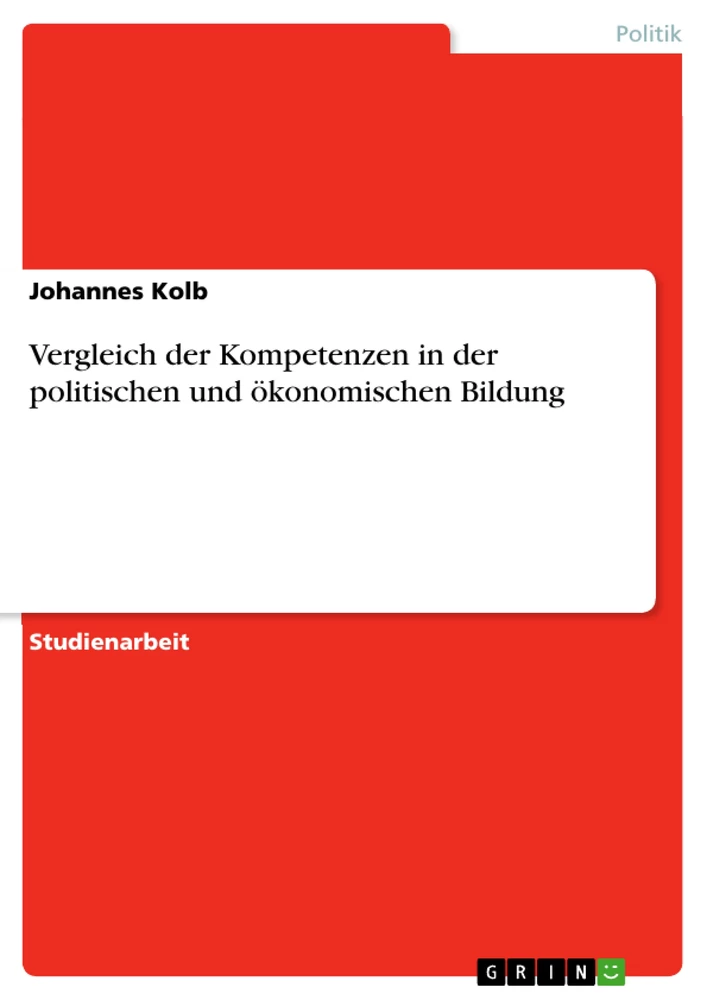Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage nach den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zweier Kompetenzmodelle. Das modifizierte Modell der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE) für das Fach der politischen Bildung und der Entwurf der deutschen Gesellschaft für Ökonomische Bildung (DEGÖB) für ein eigenständiges Wirtschaftsfach werden verglichen und zu einem gemeinsamen Entwurf zusammengebracht, der beiden Vorschlägen gerecht wird und damit politische und ökonomische Inhalte gleichermaßen beinhaltet.
Gliederung
1. Einleitung
2. Vergleich der Kompetenzmodelle
2.1 Das Verhältnis politischer und ökonomischer Bildung
2.2 Grundlagen der Kompetenzorientierung
2.3 Der GPJE – Entwurf
2.4 Der DEGÖB – Entwurf
2.5 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
2.6 Ein gemeinsames Kompetenzmodell
3. Fazit
4. Literaturangaben
1. Einleitung
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage nach den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zweier Kompetenzmodelle. Das modifizierte Modell der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE) für das Fach der politischen Bildung und der Entwurf der deutschen Gesellschaft für Ökonomische Bildung (DEGÖB) für ein eigenständiges Wirtschaftsfach werden verglichen und zu einem gemeinsamen Entwurf zusammengebracht, der beiden Vorschlägen gerecht wird und damit politische und ökonomische Inhalte gleichermaßen beinhaltet.
Die Kompetenzorientierung als bildungstheoretisches Prinzip hat sich nach der unterdurchschnittlichen Leistung deutscher Schülerinnen und Schüler bei der ersten PISA – Studie 2000 in Deutschland seit 2003 durch die Einführung einheitlicher Bildungsstandards in einigen Fächern durch die Kultusministerkonferenz etabliert (vgl. Sander 2007, S. 72). Für das Fach der politischen Bildung wurde von der KMK allerdings noch kein Beschluss zur Erstellung von Bildungsstandards gefasst (vgl. www.kmk.org, letzter Zugriff 23.03.09). Dennoch wird sich auch diese Domäne der Entwicklung nicht entziehen können.
In den letzten Jahren musste die Politische Bildung im schulischen Bereich zugunsten ökonomischer Inhalte die Anteile politischer Inhalte reduzieren. Für das Fach stellt sich die Problematik, dass zwar gemeinsam Politik und Wirtschaft unterrichtet wird, aber dass dafür keine gemeinsame Didaktik vorhanden ist (vgl. Tschirner 2008, S. 75f.). Es bietet sich daher an, im Rahmen der Kompetenzorientierung im Unterricht, eine gemeinsame Konzeption von Bildungsstandards in diesem Fach zu entwickeln.
Die Hausarbeit ist folgendermaßen aufgebaut. Zunächst werden das Verhältnis von politischer und ökonomischer Bildung und die Problematik der fehlenden Didaktik erläutert. Danach folgt eine Darstellung der Kompetenzentwicklung in Deutschland. Im Anschluss daran werden die beiden Vorschläge der GPJE, sowie die Erweiterung, und der DEGÖB vorgestellt. Diese werden im Folgeteil verglichen und danach in einem gemeinsamen Modell zusammengebracht. Am Schluss folgt ein Fazit.
2. Vergleich der Kompetenzmodelle
2.1 Das Verhältnis politischer und ökonomischer Bildung
Seitdem 1998 die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) erstmals die Forderung an die Kultusministerkonferenz gestellt hat, dass wirtschaftliche Inhalte verstärkt in allgemein bildenden Schulen unterrichtet werden sollen, kam diese Forderung mehr und mehr auf. Aus heutiger Sicht war die Folge, dass Ökonomie sich zwar nicht als eigenständiges Fach etablieren konnte, aber dass es inzwischen tatsächlich einen Zuwachs an ökonomischen Inhalten in allgemein bildenden Schulen gibt. Dies fand größtenteils durch die Ausweitung ökonomischer Inhalte in den Fächern der Politischen Bildung statt und hatte zur Folge, dass eine Reduktion der politischen Inhalte in den Lehrplänen stattgefunden hat (vgl. Tschirner 2008, S. 72ff.).
Bisher ist allerdings noch nicht klar, welche Ziele die ökonomische Bildung haben und wie sie vermittelt werden soll. Außerdem wurde die von verschiedenen Seiten geforderte Zusammenfügung der beiden Fachdidaktiken von Politik und Wirtschaft noch nicht durchgeführt, da von den universitären Vertretern meist eher die Unterschiede der beiden Felder hervorgehoben werden. Inzwischen seien allerdings Annäherungen zu erkennen. Thematisch gibt es natürlich einige Schnittmengen bei den Themen Wirtschaftsordnung, Wirtschaftspolitik und internationaler politischer Ökonomie. Didaktisch könnte die ökonomische Bildung innerhalb der politischen Bildung als kategoriale Bildung zu integrieren sein. Im Moment fehlt dem Fach allerdings eine gemeinsame Didaktik und die ökonomischen Inhalte in den Lehrplänen sind weniger problemorientiert als vielmehr stoffzentriert, so dass die Lehrpersonen selbst für die Didaktik zuständig sind (vgl. Tschirner 2008, S. 74ff.). Die neue Kompetenzorientierung, die im Folgenden erläutert wird, könnte hier ansetzen und ein gemeinsames Kompetenzmodell für Politik und Wirtschaft erschaffen.
2.2 Grundlagen der Kompetenzorientierung
Nachdem die deutschen Schülerinnen und Schüler bei der ersten PISA – Studie 2000 unterdurchschnittlich abgeschnitten hatten, wurde die Kompetenzorientierung der wichtigste Begriff in bildungstheoretischen und erziehungswissenschaftlichen Fragen. Die deutschen Curricula waren vorher sehr stark „Input“ – orientiert, sie waren also zu sehr auf die Beschreibung des Wissens, welches die Lernenden erhalten sollen, fixiert und damit zu stoffzentriert. Neuerdings spricht man von der „Output“ – Orientierung. Es geht dabei nicht um angesammeltes Wissen, sondern um tatsächliche Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Lösung von Problemen oder Aufgabenstellungen. Seit 2003 wurden daraufhin von der Kultusministerkonferenz einheitliche Bildungsstandards für Haupt- und naturwissenschaftliche Fächer festgelegt (vgl. Moegling 2008, S. 13).
Die Kompetenzdefinition von Weinert hat sich bei den KMK – Konferenzen durchgesetzt. Für ihn beinhalten Kompetenzen zum einen verfügbare oder erlernbare kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen und zum anderen psychosoziale Fähigkeiten, also die motivationalen, volitionalen (willentlichen) und sozialen Bereitschaften, variable Situationen zu lösen und die Fertigkeiten verantwortungsvoll zu nutzen. Kompetenz umfasst also die Kenntnisse über etwas, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, Aufgaben zu lösen, die Bereitschaft zu der Handlung und der verantwortliche Umgang damit. Es wird des Weiteren zwischen Kompetenz, also der Fähigkeit, und Performanz, der tatsächlichen Handlung unterschieden. Unterricht sollte stets nicht nur die Fähigkeit berücksichtigen, sondern auch die tatsächliche Anwendung (vgl. Moegling 2008, S. 13).
Bildungsstandards beziehen sich auf Kompetenzen. Sie legen in den Curricula den Grad der Ausprägung einer Kompetenz in einer jeweiligen Domäne, also dem Fach oder Fachgebiet fest, den die Schülerinnen und Schüler nach einer gewissen Phase erreicht haben sollten (vgl. Moegling 2008, S. 20).
2.3 Der GPJE – Entwurf
Für das Fach der politischen Bildung gibt es seitens der KMK bis jetzt noch keinen Entwurf für Bildungsstandards in Deutschland. Daher hat die GPJE einen konsensualen Entwurf für Bildungsstandards und Kompetenzen für die Politische Bildung erstellt, der als Grundlage für ein einheitliches Modell für Deutschland dienen soll. Dieses Modell hat sich durchgesetzt und wurde von verschiedenen Seiten weiterentwickelt. Es gibt auch andere Kompetenzmodelle, die hier allerdings nicht genauer erläutert werden (vgl. Moegling 2008, S. 17).
Betrachten wir zunächst das GPJE – Modell. Oberstes Ziel der politischen Bildung sei die politische Mündigkeit, also, dass alle gesellschaftlichen Individuen in der Demokratie sich orientieren, urteilen und handeln können. Diese Hauptkompetenz sei die Voraussetzung dafür, dass alle Individuen am öffentlichen Leben teilhaben können, und dass die Demokratie erhalten und weiterentwickelt werden kann. Der Politikbegriff für das Kompetenzmodell umfasst politische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte, die im Zusammenhang betrachtet werden sollen. Des Weiteren wird für den Unterricht selbst zwischen drei Ebenen unterschieden. Diese sind aktuelle politische Fragen und Probleme, mittel- und langfristige Fragestellungen, die auch den Blick über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg zu weltpolitischen Aspekten mit einbeziehen sollen und übergeordnete Themenbereiche, also grundlegende Fragen des menschlichen Zusammenlebens, die sozialwissenschaftliche Theorien, Menschenbilder oder alternative Ordnungssysteme beinhalten. Außerdem wird im Entwurf erklärt, dass der Beutelsbacher Konsens, also u.a. das Überwältigungs- und Belehrungsverbot im Politikunterricht und das Gebot der Kontroversität, ein wichtiges Prinzip des Unterrichts darstelle. Es wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass im Fach Politische Bildung – dies ist im Übrigen der Vorschlag der GPJE für einen einheitlichen Begriff des Fachs für alle Bundesländer – kein Null- oder Endpunkt des Wissens oder der Fertigkeiten besteht, bei dem ein Individuum gar nichts oder alles weiß oder kann. Es besteht immer ein gewisses Vorwissen, auf dem aufgebaut werden kann und es kann im Unterricht immer nur darum gehen, die Kompetenzen zu verbessern (vgl. GPJE 2004, S. 9ff.).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Vergleichs der Kompetenzmodelle?
Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem GPJE-Modell (Politik) und dem DEGÖB-Entwurf (Wirtschaft) zu finden und einen gemeinsamen Entwurf für den Unterricht zu erstellen.
Was bedeutet „Kompetenzorientierung“ in der Bildung?
Es bezeichnet den Wechsel von der reinen Stoffvermittlung (Input) hin zur Vermittlung tatsächlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten (Output), die zur Problemlösung befähigen.
Warum ist eine gemeinsame Didaktik für Politik und Wirtschaft wichtig?
Da beide Felder im Schulalltag oft gemeinsam unterrichtet werden, fehlt ohne einheitliche Didaktik ein problemorientierter Ansatz, was die Vermittlung der Inhalte erschwert.
Was besagt das GPJE-Modell für politische Bildung?
Das oberste Ziel ist die politische Mündigkeit, die es Individuen ermöglicht, sich in der Demokratie zu orientieren, zu urteilen und zu handeln.
Welchen Einfluss hatte die PISA-Studie auf diese Entwicklung?
Nach dem schlechten Abschneiden deutscher Schüler im Jahr 2000 wurde die Kompetenzorientierung und die Einführung einheitlicher Bildungsstandards zum zentralen Thema der Bildungspolitik.
- Quote paper
- Erstes Staatsexamen Johannes Kolb (Author), 2009, Vergleich der Kompetenzen in der politischen und ökonomischen Bildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204944