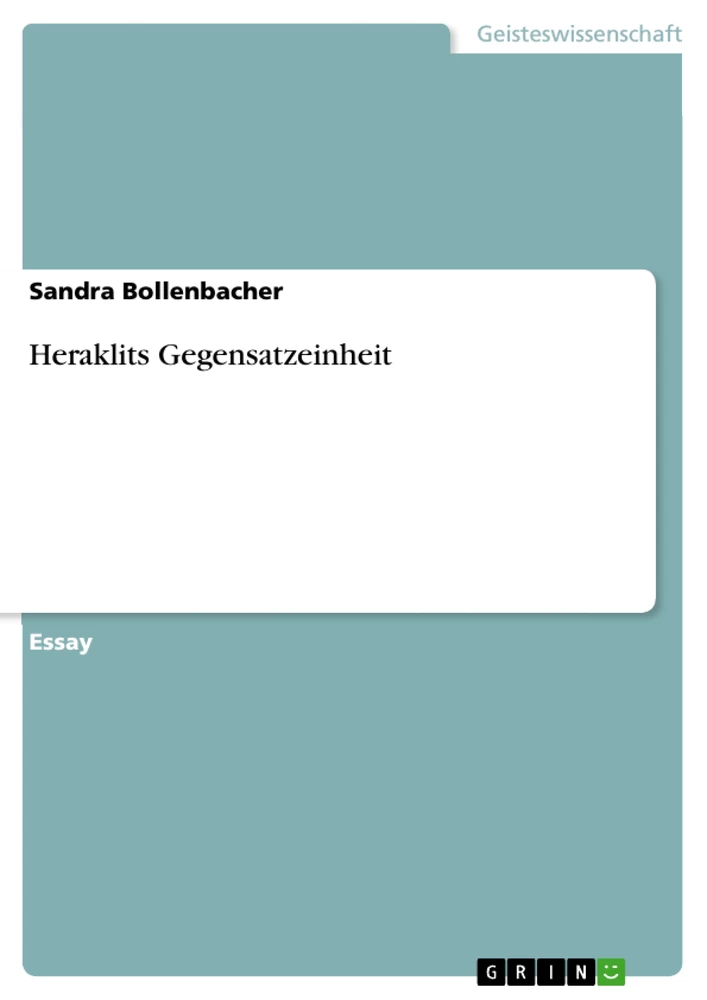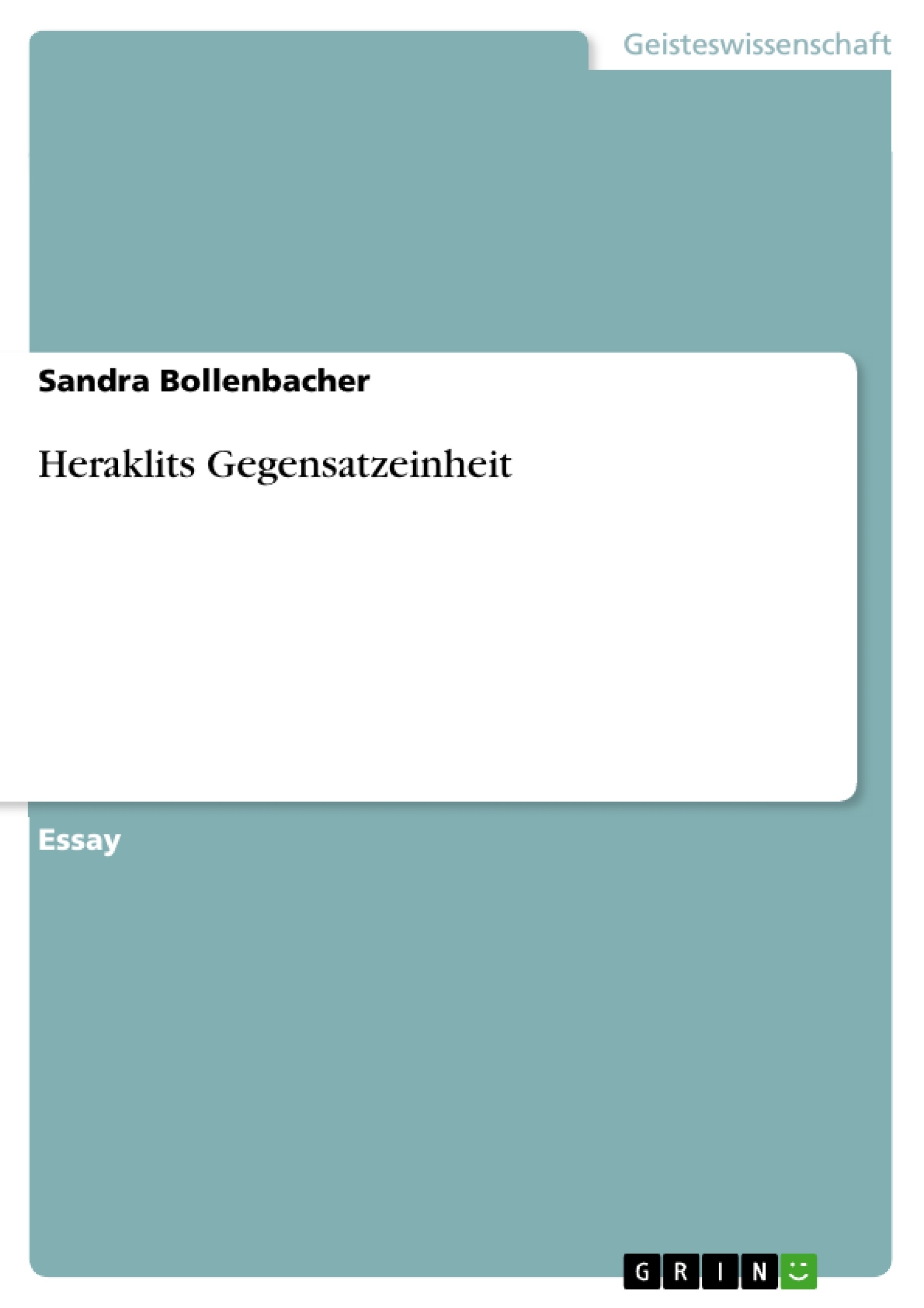Heraklit von Ephesos, der um circa 500 v. Chr. lehrte, trägt – nicht zu Unrecht – den Beinamen „der Dunkle“. Einerseits liegt es daran, dass von seinem Buch nur Fragmente überliefert wurden, welche oftmals ohne Zusammenhang noch schwerer zu deuten sind. Hinzu kommt das Problem, das man bei allen Texten hat, deren Original nicht mehr existiert, sondern nur Übersetzungen und Zitate: Diese wurden teilweise bewusst oder unbewusst zu einer bestimmten Deutung hin gelenkt, wie es zum Beispiel bei den Überlieferungen durch den christlich geprägten Clemens von Alexandria der Fall sein könnte. Andererseits, und dies ist der Hauptgrund für Heraklits Beinamen, redet Heraklit „oft in Bildern“ und gibt somit Rätsel auf, was durch seine Ausdrucksweise unterstützt wird, welche „gehoben“ und „feierlich“ ist und sich „des öfteren dem genaueren Zugriff des Interpretierenden [entzieht].“
Im Gegensatz dazu steht, dass Heraklit mit seinem Werk lehren und somit Erleuchtung bringen möchte. Passend dazu präsentiert er den alles lenkenden Logos unter anderem als Feuer oder Blitz (vgl. z.B. Fragment 75).
Dunkelheit und Licht, ein Gegensatzpaar, das eine Einheit bildet, und sich in dem Fall sogar auf Heraklit selbst bezieht. Diese Einheit von Gegensätzen, die „Überzeugung, daß alles eins ist“, ist die „Quintessenz des heraklitischen Logos“ und findet sich in seiner Lehre an vielfacher Stelle immer wieder.
Eine Einheit von Gegensätzen wirft allerdings sofort die Frage auf, ob Heraklit hierbei nicht gegen den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch verstößt. Dass dem nicht so ist, zeigt Heraklit logisch anhand etlicher Beispiele auf.
Einleitung
Heraklit von Ephesos, der um circa 500 v. Chr. lehrte,[1] trägt – nicht zu Unrecht – den Beinamen „der Dunkle“. Einerseits liegt es daran, dass von seinem Buch nur Fragmente überliefert wurden, welche oftmals ohne Zusammenhang noch schwerer zu deuten sind. Hinzu kommt das Problem, das man bei allen Texten hat, deren Original nicht mehr existiert, sondern nur Übersetzungen und Zitate: Diese wurden teilweise bewusst oder unbewusst zu einer bestimmten Deutung hin gelenkt, wie es zum Beispiel bei den Überlieferungen durch den christlich geprägten Clemens von Alexandria der Fall sein könnte. Andererseits, und dies ist der Hauptgrund für Heraklits Beinamen, redet Heraklit „oft in Bildern“ und gibt somit Rätsel auf[2], was durch seine Ausdrucksweise unterstützt wird, welche „gehoben“ und „feierlich“ ist und sich „des öfteren dem genaueren Zugriff des Interpretierenden [entzieht].“[3]
Im Gegensatz dazu steht, dass Heraklit mit seinem Werk lehren und somit Erleuchtung[4] bringen möchte. Passend dazu präsentiert er den alles lenkenden Logos unter anderem als Feuer oder Blitz (vgl. z.B. Fragment 75)[5].
Dunkelheit und Licht, ein Gegensatzpaar, das eine Einheit bildet, und sich in dem Fall sogar auf Heraklit selbst bezieht. Diese Einheit von Gegensätzen, die „Überzeugung, daß alles eins ist“,[6] ist die „Quintessenz des heraklitischen Logos “[7] und findet sich in seiner Lehre an vielfacher Stelle immer wieder.
Eine Einheit von Gegensätzen wirft allerdings sofort die Frage auf, ob Heraklit hierbei nicht gegen den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch verstößt. Dass dem nicht so ist, zeigt Heraklit logisch anhand etlicher Beispiele auf.
Hauptteil
Ungefähr ein Drittel der überlieferten Fragmente beschäftigen sich mit Gegensatzeinheiten. Auch, wenn man nicht sagen kann, zu welchem Teil sie Heraklits ursprünglichen Text einnahmen, so kann man doch aus der Quantität der überlieferten Fragmente, die die Gegensatzeinheit zum Thema haben, auf ihre Wichtigkeit schließen. So versucht Heraklit in vielen unterschiedlichen Beispielen eben jene Gegensatzeinheit und ihre Widerspruchsfreiheit klar zu machen. Zu einem großen Teil präsentiert er einfache Beispiele aus dem Leben, die jeder nachvollziehen kann:
(Fragment 54)
Die Ärzte, schneidend, brennend, in jeder vorstellbaren üblen Weise quälend, beschweren sich: ihr Honorar entspreche nicht ihrer Arbeit, während sie eben diese guten Dinge tun.
(Fragment 55)
Meer: das sauberste und zugleich das verfaulteste Wasser, für Fische trinkbar und lebenerhaltend, für Menschen nicht trinkbar und tödlich.
(Fragment 58)
Der Weg hinauf und hinab ist ein und derselbe.
Bei diesen Fragmenten lässt sich am einfachsten erklären, dass kein Widerspruch vorliegt, und zwar mit dem Begriff der Perspektive:
(Fragment 54): Obwohl die Behandlung des Arztes im Moment der Behandlung unangenehm ist und kurzzeitig Schmerzen erzeugt, so bewirkt sie über den Moment hinaus doch Heilung und Linderung der Schmerzen.
(Fragment 55): Dass hier kein Widerspruch vorliegt, ist sehr einfach zu sehen, denn ob das Meer nun verfault, untrinkbar und tödlich ist oder sauber, trinkbar und Leben erhaltend, hängt davon ab, aus der Perspektive welcher Lebewesen man das Meer betrachtet, Menschen oder Fische.
(Fragment 58): Auch, wenn man zuerst versucht ist zu sagen, dass ein Weg nicht gleichzeitig bergauf und bergab gehen kann, so ist es doch einleuchtend, wenn man sich vorstellt, am Fuße oder auf der Spitze eines Berges zu stehen und auf eben jenen Weg zu schauen. Von unten betrachtet geht der Weg bergauf, von oben betrachtet bergab – und doch ist es derselbe Weg. Genauso kann sich die Betrachtungsweise ändern, wenn man auf dem Weg bergauf geht und sich dann umdreht – nun führt der Weg wieder hinab.[8]
Passend dazu, jedoch weniger explizit, sind Fragmente 105-108. In diesen Fragmenten geht es um den subjektiven Wert von Hackstreu, Gold, Kot, Wasser, Staub, Asche und wilden Zuckererbsen. Die genannten Tiere bevorzugen für den Menschen wertlose Dinge (Kot, Staub) wobei sie für die von den Menschen als wertvoll erachteten Dinge (Gold) keine Verwendung haben. Dies zeigt, dass man auch hier Gegensatzpaare finden kann: Gold ist zugleich wertvoll wie auch wertlos. Kot verschmutzt und reinigt.
Besonders deutlich wird die Gegensatzeinheit bei:
(Fragment 49)
Sie verstehen nicht, wie Sichabsonderndes sich selbst beipflichtet: eine immer wiederkehrende Harmonie, wie im Fall des Bogens und der Leier.
Die Saiten der Leier sind wie beim Bogen gespannt. Die Spannung der Saiten ist eine Gegensatzeinheit, gebildet aus dem Ziehen der Saiten in zwei entgegen gesetzte Richtungen (zum Beispiel nach oben und nach unten). Ebenso kann man die beim Spielen erzeugten Vibrationen der Saiten (hin und her), die den Ton bilden, wie auch die Melodie selbst, die aus hohen und tiefen, lauten und leisen Tönen besteht, als Gegensatzeinheiten sehen.[9] Iyer beschreibt es als „a joining together or harmony that allows opposing forces to work in unison.”[10]
[...]
[1] Osborne, Catherine. Presocratic Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2004. xii.
[2] Mansfeld, Jaap (Hrsg. und Übers.). Die Vorsokratiker I. Stuttgart: Reclam, 1999. 231.
[3] Ibid.
[4] Vgl. Englisch: to enlighten.
[5] Falls nicht anders angegeben, sind alle Fragmente aus Mansfelds Die Vorsokratiker I.
[6] Mansfeld, 232.
[7] Ibid.
[8] Vgl. Osborne, 86.
[9] Vgl. Hussey, Edward. „Heraclitus.“The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy. Anthony A. Long (Hrsg.) Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 96.
[10] Iyer, Lars. "Logos and Difference: Blanchot, Heidegger, Heraclitus."Parallax 11, no. 2 [35] (April 2005): 14-24. MLA International Bibliography, EBSCO host (accessed July 4, 2010). 15.
- Quote paper
- Sandra Bollenbacher (Author), 2010, Heraklits Gegensatzeinheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204980