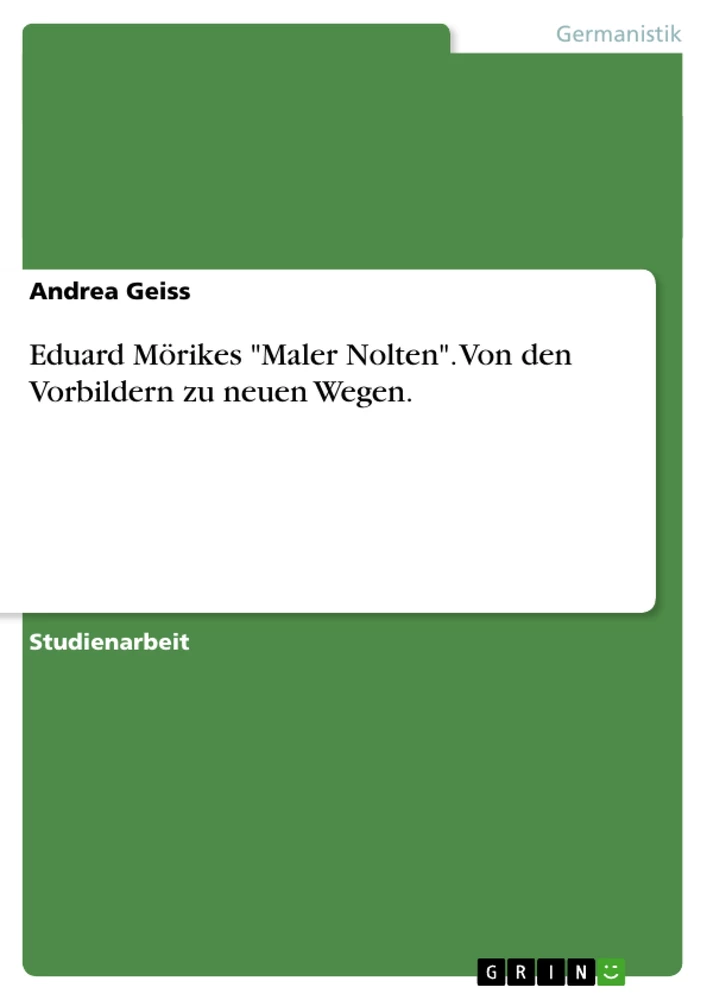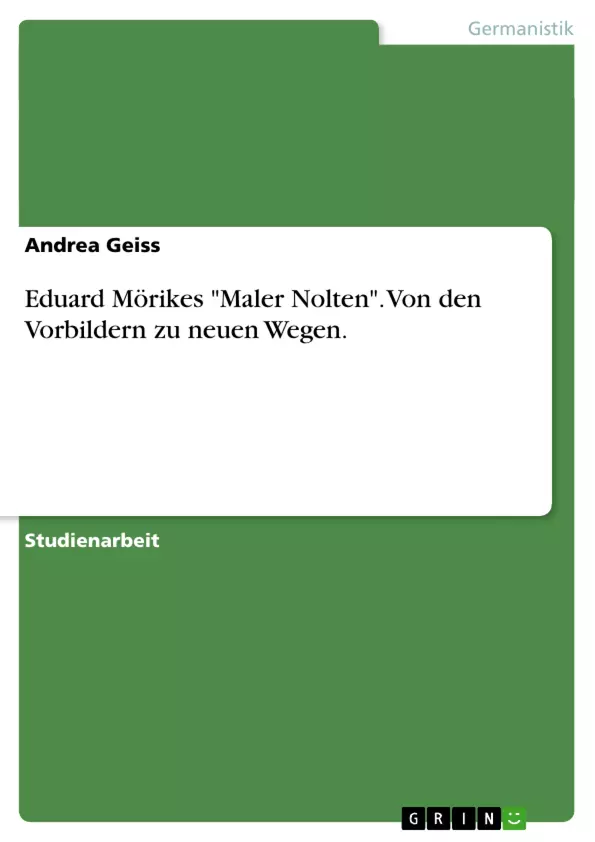Bei dem Versuch, Eduard Mörikes Roman ‚Maler Nolten’ begrifflich zu fassen, stoßen zeitgenössische Romankategorien schnell an ihre Grenzen. Entwicklungsroman, Bildungsroman, Künstlerroman, Schicksalsroman- all diese Definitionen greifen für Mörikes Hauptwerk viel zu kurz. Die vorliegende Hausarbeit versucht aufzuzeigen, in wiefern der ‚Maler Nolten’ für seine Zeit völlig neue Horizonte eröffnet. Der erste Teil der Arbeit vergleicht deshalb zunächst den ‚Maler Nolten’ mit Johann Wolfgang Goethes klassischem Bildungsroman ‚Wilhelm Meisters Lehrjahre’. Zahlreiche Berührungspunkte machen einen solchen Versuch sinnvoll; es soll gezeigt werden, wie Mörikes ‚Maler Nolten’ das klassische Modell des zielgerichteten Bildungs- und Entwicklungswegs des Helden bricht und ad absurdum führt. (Dies hat bereits dazu geführt, dass der ‚Maler Nolten’ auch als ‚Anti-Meister’ definiert wurde.) Eduard Mörikes Roman erschöpft sich aber gerade nicht in einer Negativ-Folie des ‚Wilhelm Meister’. Die anschließenden Untersuchungen im zweiten Teil der Arbeit sollen zeigen, dass Mörike in vielen Bereichen völlig neue Wege geht, zu denen sich in Goethes Werk keine Parallelen finden lassen. Dies gilt vorrangig in der Kategorie des Unbewussten, die der ‚Maler Nolten’ eröffnet. Zentral sind in diesem Zusammenhang die Romanfigur Elisabeth sowie T heobald Noltens Kunstproduktion. Dabei knüpft Mörike an Strömungen der Romantik an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wilhelm Meister und Maler Nolten
- Der lineare Bildungsweg
- Dämonische Vergangenheit
- Weiterführende Motive
- Identität: Das Doppelgänger- und Spiegelmotiv
- Kategorie des Unbewussten: Verkörperung durch Elisabeth
- Das Brunnen-Motiv: Abtauchen ins Unbewusste
- Exkurs: Bergwerke in der Darstellung der Romantik
- Verwirrung statt Erkenntnis
- Unbewusstes und Kunst
- Schicksal oder Selbstbestimmtheit?
- Die Rolle des Erzählers
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Eduard Mörikes Roman „Maler Nolten“ und setzt ihn in Beziehung zu etablierten Romankategorien, insbesondere zum Bildungsroman. Sie zeigt auf, wie „Maler Nolten“ von gängigen Modellen abweicht und neue Horizonte in der Darstellung der Persönlichkeit und künstlerischen Entwicklung eröffnet.
- Der Bruch mit dem linearen Bildungsweg
- Die Bedeutung des Unbewussten in der Darstellung
- Die Rolle der Kunst in der Auseinandersetzung mit dem Selbst
- Die Mehrdeutigkeit von Schicksal und Selbstbestimmtheit
- Die komplexe Erzählstruktur und die Rolle des Erzählers
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Roman „Maler Nolten“ vor und vergleicht ihn mit Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“. Die Analyse zeigt, dass Mörikes Werk vom klassischen Bildungsroman-Schema abweicht, indem es die lineare Entwicklung des Helden untergräbt. Das erste Kapitel behandelt die Konzeption des Bildungswegs im „Maler Nolten“ und untersucht die Unterschiede zu Goethes Werk.
Im zweiten Kapitel werden weitere Motive wie die Identität, das Unbewusste und die Rolle der Kunst im Roman erörtert. Die Analyse konzentriert sich auf die Figuren Elisabeth und Theobald Nolten sowie auf Noltens Kunstproduktion, die als Spiegelbild seines inneren Zustands fungiert.
Schlüsselwörter
Eduard Mörike, Maler Nolten, Bildungsroman, Entwicklungsroman, Kunst, Unbewusstes, Identität, Doppelgänger, Spiegelmotiv, Elisabeth, Theobald Nolten, Romantik, Erzählstruktur, Erzählerinstanz, Wilhelm Meister, Goethe.
Häufig gestellte Fragen
Gilt Eduard Mörikes "Maler Nolten" als klassischer Bildungsroman?
Nein, der Roman bricht das klassische Modell des zielgerichteten Bildungswegs und wird daher oft als "Anti-Meister" (in Anlehnung an Goethes Wilhelm Meister) bezeichnet.
Welche Rolle spielt das Unbewusste in Mörikes Werk?
Mörike eröffnet neue Horizonte, indem er das Unbewusste thematisiert, insbesondere verkörpert durch die Figur der Elisabeth und Noltens Kunstproduktion.
Wie unterscheidet sich der Bildungsweg Noltens von Goethes Wilhelm Meister?
Während Wilhelm Meister einen linearen Entwicklungsweg beschreitet, führt Noltens Weg durch psychologische Verwirrung und eine dämonische Vergangenheit ad absurdum.
Was symbolisiert das Brunnen-Motiv im Roman?
Das Brunnen-Motiv steht für das "Abtauchen ins Unbewusste" und knüpft damit an Strömungen der Romantik an.
Wie wird das Thema Identität im "Maler Nolten" behandelt?
Identität wird durch Motive wie den Doppelgänger und das Spiegelmotiv hinterfragt, was die Zerrissenheit des Künstlers verdeutlicht.
- Citar trabajo
- Andrea Geiss (Autor), 2003, Eduard Mörikes "Maler Nolten". Von den Vorbildern zu neuen Wegen., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20501