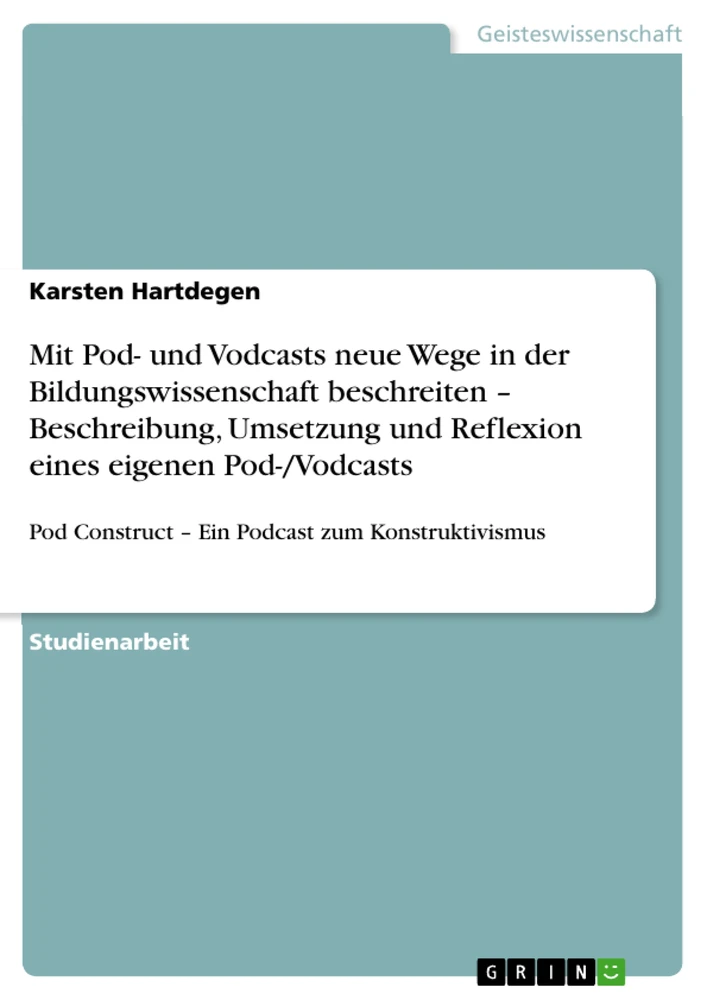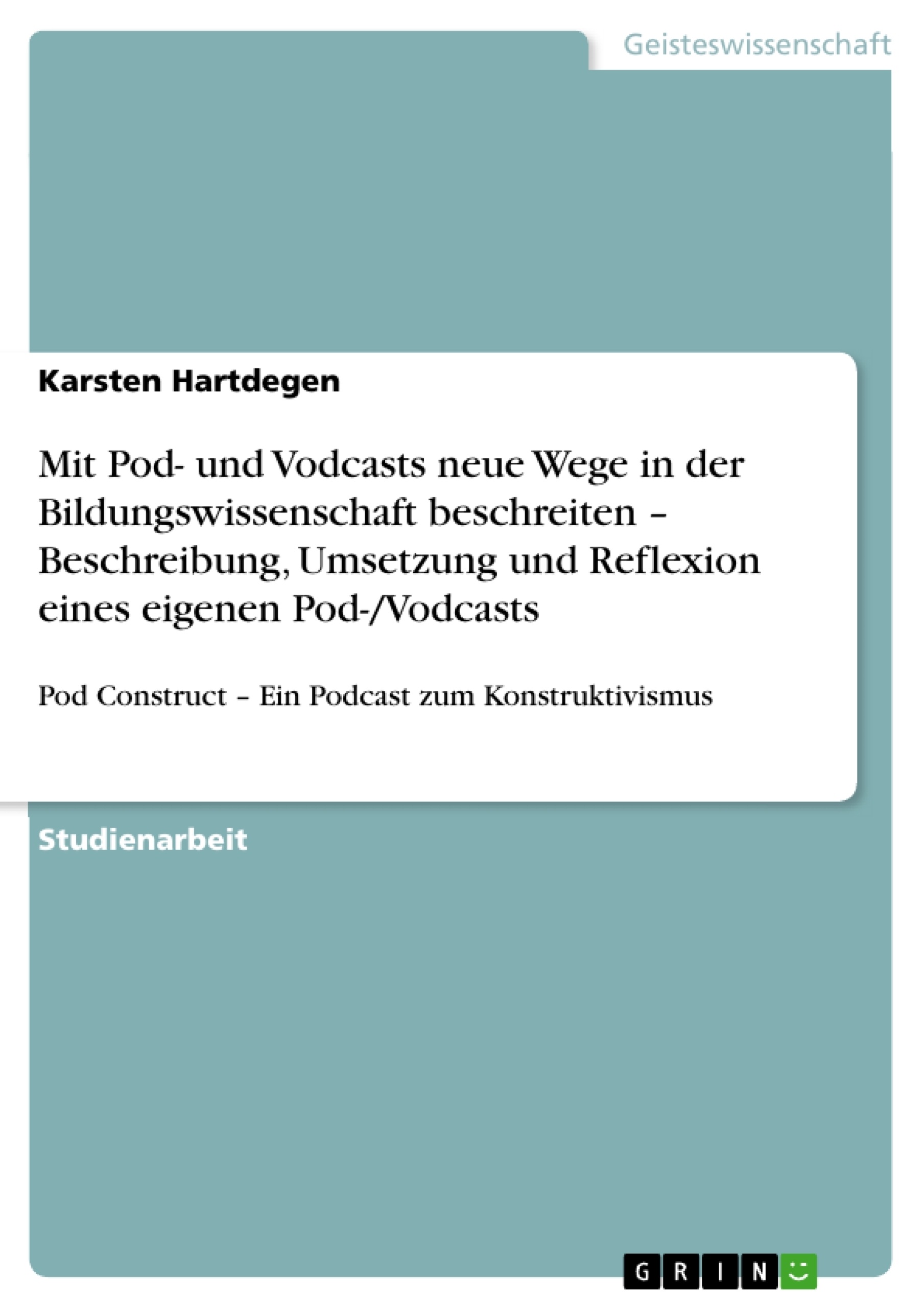Das Internet eignet sich in hervorragender Weise als Transportmedium, um Informationen jedweder Art in einfacher Form schnell und unkompliziert an viele Personen zu verteilen. Neben Textbeiträgen, die seit Beginn des Internets die Webseiten dominieren, können seit rund 10 Jahren Informationen zunehmend als Audiodateien im vielfach verwendbarem MP3-Format einfach per Download zur Verfügung gestellt werden (Walter, 2006, S. 16).
Viele Protagonisten der Volksbildung haben Anfang des 20. Jahrhunderts das Radio als ein neues Medium zur demokratischen Meinungsbildung verstanden und auch eigene Radiosendungen produziert. Durch die sinnvolle Verwendung des Mediums hofften die Vorkämpfer, dass sich Chancen für die politische Meinungsbildung ergäben, indem die Trennung zwischen aktiven Medienproduzenten und passiven, rezipierenden Zuhörern aufgehoben würde. Anfang des 21. Jahrhunderts scheint es, dass diese Utopie umsetzbar ist, weil jeder mit einem herkömmlichen PC, der über einen Internetzugang, eine Soundkarte mit Lautsprechern und ein Mikrofon verfügt, eine Sendung als Podcast erstellen und publizieren kann. Dazu ist keine komplizierte Hard- und Software notwendig. Durch das einfache Produzieren von Podcasts kann ein vormals passiver Rezipient ein aktiver Autor, Produzent und politisch agierender Bürger werden (Schmidt et al., 2007; Campbell, 2005; Göth et al., 2007).
Podcasts könnten – so die Hoffnung vieler Pädagogen und Instruktionsdesigner – als Learning Object mit entsprechender moderner Webtechnologie eine E-Learning-Revolution ermöglichen (Bett & Wedekind, 2003; Lee & Chan, 2007; Beldarrain, 2006; Schenk, 2008).
Aufgrund der Rezeptionsgewohnheiten bei anderen Tools des Webs 2.0 dürfen jedoch Zweifel an dieser optimistischen Einschätzung angemeldet werden. User generierte Inhalte werden zurzeit lediglich von einer Minorität produziert und dagegen von einer Rezipientenmajorität mit hohem Unterhaltungs- und Informationsbedürfnis passiv konsumiert (Fisch & Gscheidle, 2006; Gscheidle & Fisch, 2007; van Eimeren & Frees, 2009; Bu-semann & Gscheidle, 2009; Ebner & Schiefner, 2009; Göth et al., 2007).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Pod-/Vodcasts
- Funktionen und Motive von Pod- und Vodcasts in der Bildungswissenschaft
- Substitutional Use
- Supplementary Use
- Creative Use
- Bildungswissenschaftlicher Hintergrund des Themas „Konstruktivismus“, Funktionalität und Zielgruppe
- Konzeption und Instruktionsdesign des Podcast
- Bewertung der Umsetzung der Konzeptidee
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Rolle von Podcasts in der Bildungswissenschaft und untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen des Mediums im Kontext des Lehrens und Lernens. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Konstruktion einer eigenen Podcast-Reihe zum Thema "Konstruktivismus" und der anschließenden Reflexion der Konzeption und Umsetzung.
- Definition und Funktionsweise von Podcasts
- Bildungswissenschaftliche Perspektiven auf Podcasting im Kontext von selbstorganisiertem Lernen und Storytelling
- Anwendung des Konstruktivismus im Podcast-Design
- Evaluation und Reflexion der Podcast-Reihe
- Zukünftige Potenziale und Herausforderungen von Podcasts in der Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Einleitung in die Thematik Podcasts in der Bildungswissenschaft und Vorstellung der Zielsetzung der Hausarbeit.
- Kapitel 2: Definition Pod-/Vodcasts: Definition des Begriffs "Podcast" und Unterscheidung zwischen Audio-Podcasts, Enhanced Podcasts und Videopodcasts.
- Kapitel 3: Funktionen und Motive von Pod- und Vodcasts in der Bildungswissenschaft: Beschreibung der drei wichtigsten Einsatzformen von Podcasts in higher education: Substitutional Use, Supplementary Use und Creative Use. Darlegung des bildungswissenschaftlichen Nutzens von Podcasts im Kontext von selbstorganisiertem Lernen und Storytelling.
- Kapitel 4: Bildungswissenschaftlicher Hintergrund des Themas „Konstruktivismus“, Funktionalität und Zielgruppe: Erklärung der konstruktivistischen Lerntheorie und Darstellung der Relevanz des Themas für die Hausarbeit.
- Kapitel 5: Konzeption und Instruktionsdesign des Podcast: Detaillierte Beschreibung der Konzeption und des Instruktionsdesigns des eigenen Podcasts zum Thema "Konstruktivismus".
- Kapitel 6: Bewertung der Umsetzung der Konzeptidee: Evaluation und Reflexion der Podcast-Reihe anhand des Instruments "Learning Object Review Instrument" (LORI).
- Kapitel 7: Zusammenfassung und Ausblick: Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der Hausarbeit und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich des Podcasting in der Bildungswissenschaft.
Schlüsselwörter
Podcasts, Bildungswissenschaft, Konstruktivismus, selbstorganisiertes Lernen, Storytelling, Instruktionsdesign, Evaluation, Learning Object Review Instrument (LORI), Multimedia, E-Learning, Blended Learning, Didaktik, Motivation, Motivationssteigerung, Motivationsprobleme, Motivationserfolg, Motivationspotenziale, Motivationstheorie, Motivationstraining, Motivationale Aspekte, Motivationale Ziele, Motivationale Faktoren, Lernmotivation, Motivationale Prozesse, Motivationale Ziele, Motivationale Strategien, Motivationale Interventionen, Motivationale Techniken, Motivationale Instrumente, Motivationale Ressourcen, Motivationale Kulturen, Motivationale Veränderung, Motivationale Entwicklung, Motivationale Optimierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie können Podcasts in der Bildungswissenschaft eingesetzt werden?
Man unterscheidet drei Einsatzformen: Substitutional Use (Ersatz), Supplementary Use (Ergänzung) und Creative Use (kreative Eigenproduktion durch Lernende).
Was ist der bildungswissenschaftliche Nutzen von Podcasts?
Sie unterstützen selbstorganisiertes Lernen, Storytelling und können die Lernmotivation durch eine persönliche Ansprache steigern.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus beim Podcast-Design?
Das Design orientiert sich an der Idee, dass Wissen aktiv konstruiert wird; Podcasts dienen dabei als Werkzeuge, um komplexe Themen wie den Konstruktivismus selbst zu vermitteln.
Was ist das LORI-Instrument?
Das „Learning Object Review Instrument“ dient der systematischen Bewertung und Reflexion der Qualität von digitalen Lernobjekten wie Podcasts.
Sind Podcasts die Lösung für alle Motivationsprobleme?
Obwohl sie Potenziale bieten, zeigt die Arbeit auch Skepsis auf, da die Mehrheit der Nutzer Inhalte eher passiv konsumiert statt sie aktiv zur Wissenskonstruktion zu nutzen.
- Arbeit zitieren
- Karsten Hartdegen (Autor:in), 2010, Mit Pod- und Vodcasts neue Wege in der Bildungswissenschaft beschreiten – Beschreibung, Umsetzung und Reflexion eines eigenen Pod-/Vodcasts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205113