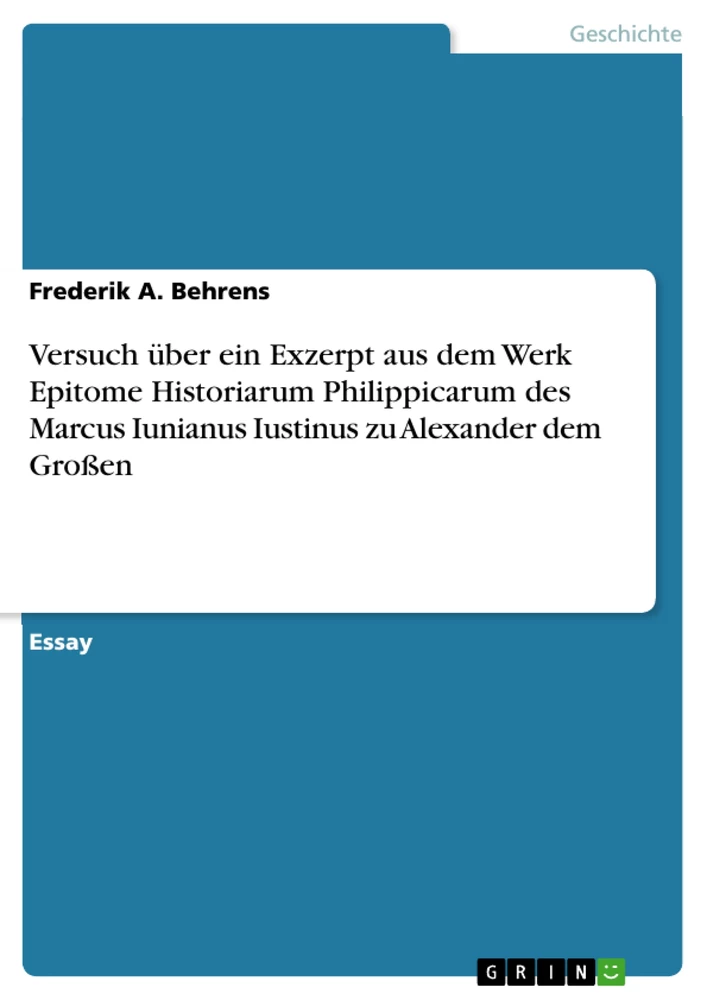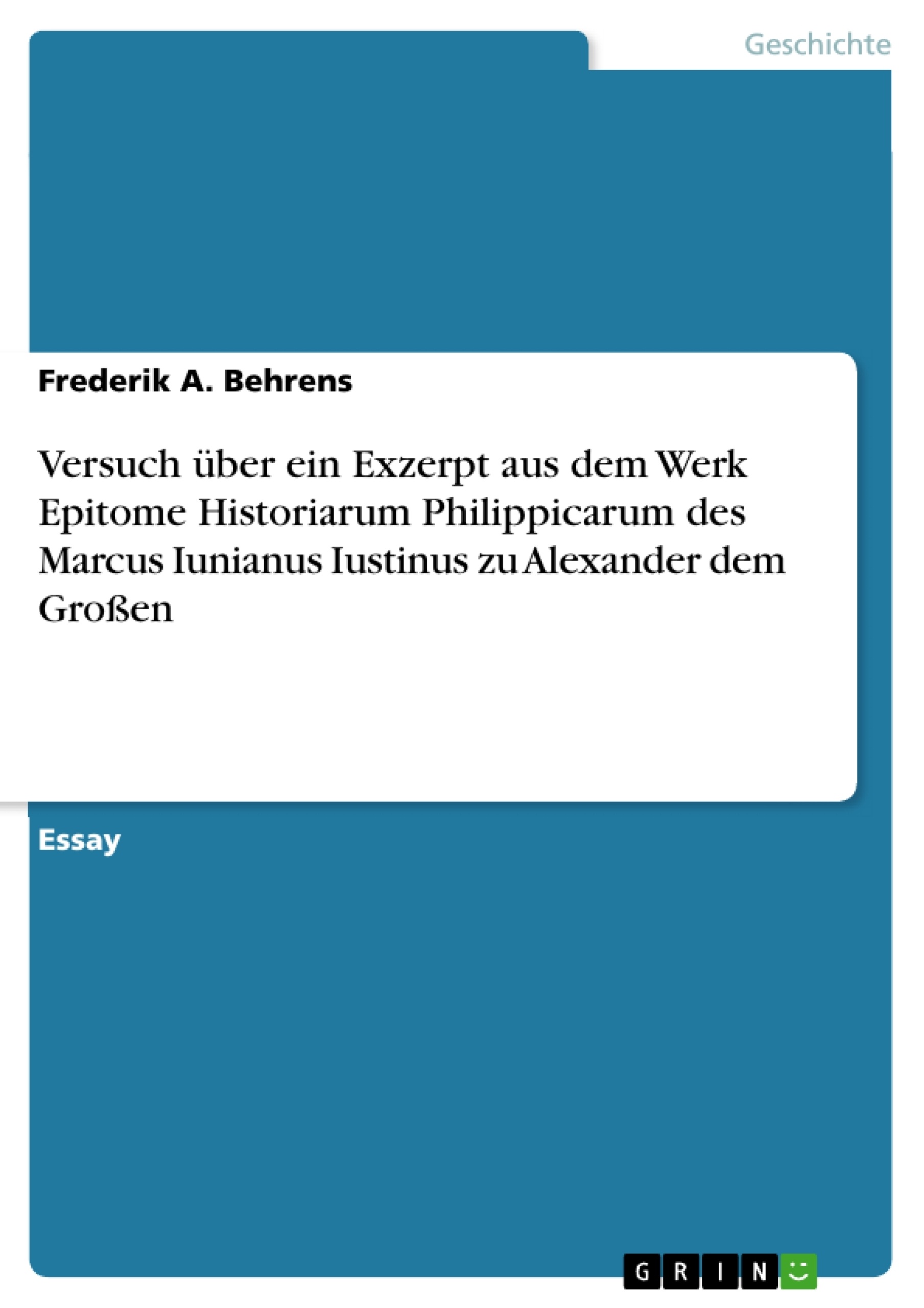Bei dem in diesem Essay zu interpretierenden Quellentext handelt es sich das achte Kapitel des neunten Buches des Historiarum Philippicarum libri XLIV des römischen Historikers Marcus Iunianus Iustinus. Ich beginne meine Untersuchung mit einer Beschreibung und historischen Kontextualisierung derjenigen Quellentexte und Autoren, die für die kritische Bewertung des hier im Fokus stehenden Exzerpts von zentraler Bedeutung sind. Es folgt eine relativ ausführliche Zusammenfassung des Inhaltes der Quelle, da ich dieses Vorgehen im Rahmen meiner Essay-Konzeption für sinnvoll erachte. Anschließend widme ich mich dann ausführlich der kritischen Beleuchtung der relevanten Quellen und Autoren, die mit einem bewertenden Resümee des hier thematisierten Exzerpts ihren Abschluss findet. Der Analyse der historischen Hintergründe bezüglich der Quellen und Autoren wird viel Raum gegeben, da es mir anders kaum möglich erscheint, zumindest annähernd substantielle Kritik an dem Exzerpt zu üben bzw. dieses zu interpretieren. Außerdem ergibt sich meines Erachtens die Problematik der Quellenlage aus dieser Analyse fast von selbst.
Bei dem in diesem Essay zu interpretierenden Quellentext handelt es sich das achte Kapitel des neunten Buches des Historiarum Philippicarum libri XLIV des römischen Historikers Marcus Iunianus Iustinus (im Folgenden: Justinus). Ich beginne meine Untersuchung mit einer Beschreibung und historischen Kontextualisierung derjenigen Quellentexte und Autoren, die für die kritische Bewertung des hier im Fokus stehenden Exzerpts von zentraler Bedeutung sind. Es folgt eine relativ ausführliche Zusammenfassung des Inhaltes der Quelle, da ich dieses Vorgehen im Rahmen meiner Essay-Konzeption für sinnvoll erachte. Anschließend widme ich mich dann ausführlich der kritischen Beleuchtung der relevanten Quellen und Autoren, die mit einem bewertenden Resümee des hier thematisierten Exzerpts ihren Abschluss findet. Der Analyse der historischen Hintergründe bezüglich der Quellen und Autoren wird viel Raum gegeben, da es mir anders kaum möglich erscheint, zumindest annähernd substantielle Kritik an dem Exzerpt zu üben bzw. dieses zu interpretieren. Außerdem ergibt sich meines Erachtens die Problematik der Quellenlage aus dieser Analyse fast von selbst.
Die genauen Lebensdaten Justinus' sind nicht bekannt, die gegenwärtigen Datierungen schwanken zwischen dem 2. bis 4. Jahrhundert. Auch seine Biographie ist der Forschung weitgehend unbekannt, er scheint aber nicht aus Rom selbst stämmig gewesen zu sein, wenngleich er sich dort einige Zeit aufgehalten habe, wie aus seinem Vorwort hervorgeht.
Das von ihm verfasste Geschichtswerk ist in lateinischer Sprache gehalten und stellt laut eigener Aussage einen Auszug bzw. eine Zusammenfassung zentraler Passagen der Historiae Philippicae dar (Der Neue Pauly spricht von 10 – 15% des ursprünglichen Textes), eines sehr umfangreichen, im Original nicht erhaltenen Geschichtswerkes, das von (Gnaeus Pompeius) Trogus verfasst wurde. Dabei war es vermutlich Justinus' Intention, einen Leserkreis zu erreichen, dessen Interesse an Geschichte über diejenige Roms hinausging, und denen er einen leichteren Zugang oder ersten Einstieg und Überblick über Trogus' Monumentalwerk ermöglichen wollte. Eine in diesem Zusammenhang ungeklärte, aber interessante Frage ist es beispielsweise, ob und inwiefern Justinus eigene Ansichten und (politische) Positionen in seine Darstellung einfließen ließ.
Pompeius Trogus war seines Zeichens ebenfalls römischer Historiker, der in der Zeit des Kaiser Augustus wirkte. Der Fokus des von Justinus rezipierten bzw. auszugsweise zusammengefassten Haupwerks des Trogus, die Historiae Philippicae in 44 Büchern , liegt jedoch auf dem von Philipp II. gegründeten Königreich Makedonien. Insgesamt handelt es sich dabei um eine allgemeine Universal- bzw. Weltgeschichte mit ausführlicher Beschreibung der Historie der unterschiedlichen Regionen unter Herrschaft Alexanders des Großen und seiner Nachfolger. Das geographische und chronologische Aufbauprinzip des Werkes folgt dabei der Idee der Abfolge der Weltreiche bzw. -herrschaft: von den Assyrern über u.a. die Perser und Makedonen bis schließlich Rom.
Der Umstand, dass Trogus in seinem Werk eine signifikant hohe Menge an Material aus Texten von führenden griechischen Historikern rezipierte, und eine solch umfangreiche, selbständige Kompilation vermutlich die Möglichkeiten eines Römers überstiegen, gab in der Geschichtswissenschaft Anlass zu der (bis heute nicht unumstrittenen) Annahme, dass Trogus selbst auf eine griechischsprachige Sammlung von Texten als Vorlage zurückgegriffen habe.
Wie bereits erwähnt ist Trogus' Werk nicht erhalten geblieben, neben den Auszügen des Justinus - der prologoi bzw. Zusammenfassungen der 44 Bücher - finden sich lediglich Fragmente z.B. in der Historia Augusta, oder bei Autoren wie Hieronymus oder Augustinus.
Im 8. Kapitel des neunten Buches des Historiarum Philippicarum vergleicht Justinus die Figuren bzw. Charaktere Philipps II. und seines Sohnes Alexander des Großen und stellt sie einander gegenüber. Da es meiner Ansicht nach ganz dem Wesen und der Intention der Quelle entspricht, möchte ich es mir nicht nehmen lassen, den Inhalt des Textes nach meinem Geschmack und Gutdünken hier auszugsweise zusammenzufassen:
Im ersten Absatz geht es zunächst nur um Philipp, dessen Charakter überwiegend negativ konnotiert beschrieben wird als waffenverliebt, heimtückisch, verschlagen, heuchlerisch, Intrigen stiftend, sich geschickt verstellend und treuelos; gleichzeitig habe er aber eine gleichermaßen ausgeprägte Fähigkeit zu Weichherzigkeit und Liebenswürdigkeit. Auch seine rhetorischen Fähigkeiten - „sprühend vor Geist und Wendigkeit“ - sowie Anmut und Würde seiner Einfälle werden hervorgehoben.
Im nächsten Absatz folgt dann die Gegenüberstellung beider Charaktere mit dem einleitenden Satz, Alexander überbiete seinen Vater noch an Tugenden und Lastern. Unterschiedlich sei z.B. beider Kriegstaktik: Während Philipp sich auf List und Tücke verließe, bevorzuge Alexander die offene Schlacht. Dem klugen Taktieren und maßvollen Zügelns des Zorns des einen wird der 'hohe Mut' und uferlose Rachsucht des anderen entgegensetzt. Als sehr unterschiedlich wird auch die Auswirkung der bei beiden oft zutage tretender Trunkenheit beschrieben; während Philipp seine deliriöse Wut „vom Gelage weg“ eher am Feind auszulassen beliebte, habe sich Alexanders Zorn auch blutig gegen die eigenen Leute gerichtet. Während Philipp daran gelegen hätte, geliebt zu werden und im Freundeskreis nicht den König hervorzukehren, ginge es Alexander darum, gefürchtet zu sein, gerade auch im eigenen Lager. Es folgen noch weitere Vergleiche betreffend beider Beziehungen zu Wissenschaft, Rhetorik, Großmut gegen Besiegte und allgemeine Lebensführung, und Justinus beschließt das Kapitel mit der Konklusion, Philipp habe „durch solcherlei Künste“ die Grundmauern der Weltherrschaft gebaut, Alexander jedoch „krönte das Werk mit höchstem Ruhm“. Soweit zum Inhalt der Quelle.
Was habe ich soeben getan? Es ist vielleicht so etwas eine subjektive selektive Zusammenfassung (von mir selbst geschrieben) einer subjektiven selektiven Zusammenfassung (das Historiarum Philippicarum von Justinus) einer subjektiven selektiven Zusammenfassung (die Historiae Philippicae von Trogus) einer subjektiven selektiven Zusammenfassung (eines oder mehrerer anonymer Kompilatoren griechischer historiographischer Schriften) einer subjektiven selektiven Zusammenfassung (der griechischen Autoren, z.B. Kleitarchos und Theopompos) einer subjektiven selektiven Zusammenfassung (eventueller Informanten mit Berichten aus zweiter oder dritter Hand, z.B. Soldaten und Offiziere) einer subjektiven selektiven Zusammenfassung (eventueller primärer Augenzeugen) von möglichen, bereits subjektiv selektiv wahrgenommenen Ereignissen … aber Scherz beiseite, ich versuche, das im folgenden etwas ernsthafter in Worte zu fassen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wer war Marcus Iunianus Iustinus?
Justinus war ein römischer Historiker (vermutlich 2.-4. Jh. n. Chr.), der einen Auszug (Epitome) aus dem umfangreichen Werk des Pompeius Trogus verfasste.
Was ist das Hauptthema der 'Historiae Philippicae' von Trogus?
Das Werk ist eine Universalgeschichte, deren Fokus auf dem makedonischen Weltreich unter Philipp II. und Alexander dem Großen sowie dessen Nachfolgern liegt.
Wie vergleicht Justinus Philipp II. und Alexander den Großen?
Justinus stellt beide als gegensätzliche Charaktere dar: Philipp als listigen Taktiker, der geliebt werden wollte, und Alexander als tapferen, aber oft zornigen Herrscher, der eher Furcht verbreitete.
Warum ist die Quellenlage zu Alexander bei Justinus problematisch?
Es handelt sich um eine mehrfache Filterung: Justinus fasste Trogus zusammen, der wiederum griechische Quellen nutzte, die oft auf Berichten aus zweiter oder dritter Hand basierten. Dies führt zu einer hohen Subjektivität.
Was war die Intention von Justinus' Geschichtswerk?
Er wollte vermutlich einem breiteren Leserkreis einen leichteren Zugang zu Trogus' Monumentalwerk ermöglichen und einen Überblick über die Weltgeschichte außerhalb Roms geben.
- Arbeit zitieren
- Frederik A. Behrens (Autor:in), 2012, Versuch über ein Exzerpt aus dem Werk Epitome Historiarum Philippicarum des Marcus Iunianus Iustinus zu Alexander dem Großen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205162